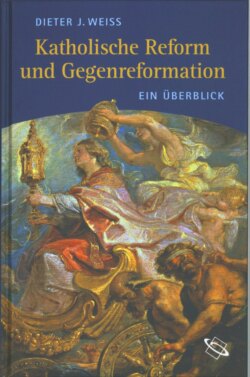Читать книгу Katholische Reform und Gegenreformation - Dieter J. Weiß - Страница 9
Konzeption des Bandes
ОглавлениеAls Überschrift für diesen Band wird bewusst an dem von Hubert Jedin geprägten Begriffspaar katholische Reform und Gegenreformation festgehalten. Dabei soll nicht der Anspruch erhoben werden, mit diesem Doppelbegriff eine Epochendarstellung der Reichsgeschichte zu liefern. Die vorliegende Arbeit verwendet diese Begriffe weniger zur Charakterisierung des Beginns der Frühen Neuzeit bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts als zur chronologischen wie thematischen Präzisierung zentraler Entwicklungen der Reichs- und katholischen Kirchengeschichte dieses Zeitraums unter dem Reformaspekt.
Unter katholischer Reform wird die im Spätmittelalter einsetzende Selbsterneuerung der Kirche verstanden, der das Konzil von Trient ihre prägnante Form gab und die Zielsetzung vorschrieb. Der eigentliche Beginn der neuzeitlichen katholischen Reform wurde von verschiedenen Autoren genauso unterschiedlich angesetzt wie ihre Quellen. Die Möglichkeiten reichen von der Gründung des römischen Oratoriums um 1515 bis zum Abschluss des Tridentinums 1563. Das Konzil von Trient ist nach Vorgehensweise wie inhaltlicher Festlegung in der Tradition der ökumenischen Konzilien zu sehen. Viele der hier vertretenen Ideen wurzeln in der Reformbewegung des Spätmittelalters. Die Beschlüsse des Konzils bilden die Gesetzesfassung von Ideen, die weit zurückreichen. Hubert Jedin formulierte: „Die Trienter Reformdekrete sind keineswegs nur Ursache der katholischen Reformation, sondern mindestens ebenso sehr schon Ausdruck und Wirkung derselben.“ In diesem Zusammenhang werden Ansätze zur Reform besonders in Spanien und Italien, die Entwicklung der neuen Orden und die Instrumente zur Umsetzung der Reformbestimmungen des Konzils behandelt. Das Papsttum, dessen Wirken für die Reform neben seiner Einbindung in die internationale Politik vorgestellt wird, übernahm die Durchführung der kirchlichen Erneuerung. Einen sichtbaren Ausdruck gewann dies in der gesteigerten kulturellen Bedeutung Roms.
Die entscheidenden Kräfte für die katholische Reform kamen aus den Ländern, die von der Reformation nur am Rande berührt wurden. Dieser gesamteuropäische Zusammenhang droht durch das vor allem auf das Heilige Römische Reich fixierte Konzept der Konfessionalisierung in den Hintergrund zu rücken. Mit der katholischen Reform erreichte auch die Kulturhegemonie der Länder der Romania gegenüber dem Reich einen Höhepunkt.
Die doktrinelle Auseinandersetzung mit dem Protestantismus, die Kontroverstheologie, aber auch der Einsatz staatlicher Zwangsmittel gehören zum Bereich der Gegenreformation. In vielen Fällen ging die kirchliche Reform ein enges Bündnis mit der erstarkenden fürstlichen Gewalt ein – im Reich besonders in Bayern und mit zeitlicher Versetzung in Österreich. Hier sind die territorialstaatlichen „Gegenreformationen“ (Ernst Schubert) festzumachen. Als Eckdaten der Gegenreformation werden häufig der Augsburger Religionsfriede und die Westfälischen Friedensschlüsse genannt. Besonders in Bayern setzte der Wille zur politischen Selbstbehauptung als katholisches Territorium schon vor 1555 ein. Die politische Entwicklung im Heiligen Römischen Reich und seinen Territorien unter dem Leitfaden konfessioneller Interessen wird bis zum Jahr 1648 knapp dargestellt. Die Westfälischen Friedensschlüsse markieren den Verzicht des Kaisers und der altgläubigen Reichsstände auf die Rückführung protestantischer Gebiete zur katholischen Religionsausübung.
Für die katholische Reform aber stellt 1648 keine Epochengrenze dar. Die Durchsetzung der tridentinischen Reformbestimmungen erfolgte meist erst in der anschließenden Friedenszeit. Ein Grundproblem bleibt dabei die zu vermutende Diskrepanz zwischen den Normen der kirchlichen Gesetzgebung und dem Eifer religiöser Eliten etwa aus den Reformorden und der tatsächlich gelebten Frömmigkeit der Laien. Das abschließende Kapitel ist dem Barockkatholizismus vorbehalten, um die kulturelle Kraft der erneuerten Kirche und die Erfassung aller Bevölkerungsschichten durch ihre Vorstellungen zu verdeutlichen.