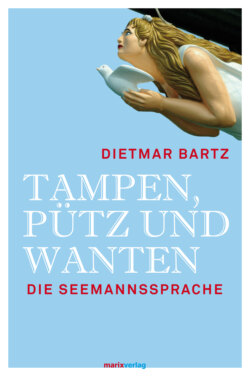Читать книгу Tampen, Pütz und Wanten - Dietmar Bartz - Страница 16
B
ОглавлениеBaare, die, »große Welle«.
Mittelniederdt. bare, niederländ. bare, altnord. bara sind verwandt mit ahd. bore »Höhe«, burjan »in die Höhe heben«, die auf indoeurop. *bher- »hoch« zurückgehen. Verwandt sind empor, Berg und Brigitte »die Erhabene«. →See
Johann Georg Aldenburgk, West-Indianische Reiße (1627): »darnach schleust man den jenigen, der ein mehrers begangen, zu Wasser und Brod, etliche Tage und Wochen in deß Schiffs Gallion, darinn keiner, wann das Meer grosse Baaren und Wellen wirft, trucken bleiben kan.«
Bernardin de Saint-Pierre, Reise eine französischen Officiers nach den Insuln Frankreich und Bourbon (1774): »Während dieser Beschäfftigung hob eine ungeheure Baare die Schaluppe in die Höhe, zerbrach ihren Dregg [einen kleinen Anker], und schmiß sie auf den Sand.«
Knut Jungbohn Clement, Die nordgermanische Welt oder unsere geschichtlichen Anfänge (1840): »wo die Baren sausen und wühlen, wo die Wirbelströmungen des Weltmeers an dessen Vorgebirgen und Inselgruppen kentern«.
→Galion
Baas, der, »Meister, Herr, Aufseher«.
Ab Mitte 18. Jahrh. übernommen aus niederländ. baas, mittelniederl., fries. baes »Meister, Herr«, spätmittelniederländ. bās »Aufseher bei Deicharbeiten«. Herkunft unklar, aus mittelhochdt. baz »besser« ungewöhnlich, weil mittelhochdt. Entlehnungen ins Niederländische sehr selten sind, aus althochdt. basa »Tante«, urspr. »Schwester des Vaters«, später auch Anredeform für einen Haushaltsvorstand, selbst unbekannter Herkunft. Nicht verwandt mit türk. Pascha. Aus dem Niederländ. entlehnt sind französ. bausse »Arbeitgeber« sowie engl. und amerik.-engl. boss »Chef«. Heuerbaas bedeutet »Stellenvermittler für Matrosen« →Heuer, Schlafbaas »Matrosenwirt«, Zimmerbaas »Zimmermeister« (im Schiffbau).
Georg Henisch, Teutsche Sprach vnd Weißheit (1616): »Bas … bedeut bey den Niderlandern ein Herren vnd freund / haußvatter.«
Schiffsbaukontrakt, Altona (1742): »es verbindet sich vorbemeldter Schiffs-Zimmerbaß, eine gute Pladtbordigte 3 Mast Gallioth zu verfertigen«, »offeriret sich der Ehrbare Zimmerbaß Clas Rotermund, alles was Zimmermanns Arbeit daran ist und in diesem Contract so genau nicht specificiret worden, biß auf den letzten Klamp zu verfertigen.«
August Mey, Bilder aus dem Hamburger Hafen (1899): »›Ein Logis hab ich, aber ich wollt’ gern mit einem Schiff nach Amerika.‹ ›Müssen sich an einen Heuerbaas wenden.‹«
back, »zurück, falsch, rückwärtig, hinter«, dt. →achter-.
In nautischer Verwendung ein häufiges Beiwort, etwa back brassen »Segel so stellen, dass sie der Wind gegen den Mast legt«. Niederdt., altnord. bak, altengl. bæc, engl. back, altfries. bek; die Bedeutung »rückwärtig« ist noch in →Backbord erhalten. Herkunft umstritten: von althochdt. bah, german. *baka- »Rücken«, althochdt. bahho »Speckseite«, im Hochdt. überlagert vom ursprüngl. nicht verwandten Backe »Kinnbacke, Wange«, dies wiederum umstrittener Herkunft, vielleicht aus indoeurop. *baghn »kauen« oder *bhag- »zuteilen, als Anteil bestimmen«; mit (Arsch-, nicht Kinn-) Backe zu germ. *brōka- »Hinterteil« unter denkbarem Fortfall des -r- wie zwischen dt. sprechen und engl. to speak.
Die Gartenlaube (1859): »Jetzt trifft der Wind von vorn auf die backgelegten Segel, der dadurch ausgeübte Druck hemmt die Fahrt und in wenigen Minuten liegt das Schiff beigedreht.«
Back, die, »große, tiefe Holzschüssel, in der das Essen für eine Gruppe von Seeleuten aufgetragen wird«, »Gesellschaft von 6 bis 10 Seeleuten, die während der ganzen Reise zusammen speisen«, auch Backmannschaft, verkürzt Backschaft, »zusammenklappbarer Tisch« einer Back(schaft), »von Bord zu Bord reichender Aufbau« auf dem vordersten Teil des Oberdecks, der den Bug mit einschließt.
Engl. back »Gefäß«, niederländ. bak »Trog«, französ. bac »flachbodige Fähre«. Vorformen sind schwach belegt: bacchia ist ein Gefäß in den Schriften Isidors von Sevilla (560–636 n.Chr.), bacchinon eine schmuckverzierte Holzschale bei Gregor von Tours (5. Jahrh.), zu frühroman. *baccinum und dessen Grundform *bacca »Wassergefäß«. Die Bezeichnung stammt aus dem Gallischen oder Keltischen, bezeichnete flache Behälter, gelangte über Entlehnung ins Niederdeutsche und wurde zum Ausgangswort für Back; *bacca könnte über eine iberische Zwischenstufe und italien. regional bacchari »Wein in ein Gefäß geben, Bacchus feiern« auf Bacchus »Gott des Weines« zurückgehen. Verwandt mit Bassin, Becken, Becher, nicht mit →back, →Backbord. Die Erklärung, dass die Back als Brett für die Speise der Seefahrer bei den Germanen im Achterschiff hinter dem Rücken des Steuermanns aufgestellt worden sei und daher ihren Namen habe, ist Seefahrerlatein. Das Kommando Backen und Banken! war der Befehl, die außerhalb der Mahlzeiten weggeräumten Tische und Bänke herzurichten. Bezeichnung einiger Backschaften (): Die Kochsback schaffte (speiste) unter der Back () an Backbord, die Bootsmannsback daneben an Steuerbord, die Bootmannsmaatback unter der Schanze.
Johann Sigmund Wurffbain, Ost-Indianische Krieg- und Ober-Kauffmanns-Dienste (1686): »uber dieses gab man für jeden Tisch oder Packs voll Volck, in 8 Personen bestehend …, zur täglichen Früh-Kost, eine höltzerne Schüssel voll Gersten, mit Zwetschken, Rosinen und Butter gekocht.«
Johann Christoph Wolfs Reise nach Zeilan [Ceylon, Sri Lanka] (1782): »die Einrichtung des Speisens geschah folgender Gestalt: man brachte große hölzerne Backen, die numeriert waren; zu einer jeden Nummer gehörten zehn Personen …, eine jede Backgesellschaft … bekam zwey Krüge.«
Jens Jacob Eschels, Lebensbeschreibung eines alten Seemanns (1835): »das allerärgste für mich war, das gelbe Erbsen-Back auszuschrapen oder was die Leute, die an der Back … speisen, nachlassen, muß der Backs-Junge, und das war ich, an der Officiers-Tafel rein aufessen.«
Als Schiffsaufbau bei Friderich Martens, Spitzbergische oder Groenlandische Reise-Beschreibung (1675): »bey dem Muschelhafen kam ein grosser Eißberg an unser Schiff treiben, also hoch war er, als das vorder Theil vom Schiffe, die Backe genandt.«
Als eine Art Schanzkleid bei Sophie Wörishöffer, Robert der Schiffsjunge (1887): »im Buge ist außerdem gewöhnlich noch eine kleine Überdachung, die Back genannt, welche dazu dient, den Vordertheil des Schiffes gegen hohen Seegang zu schützen.«
In Bedeutung →Auge (1899), →Harpune (1908), →Moses (1702)
Backbord, das, »die linke Schiffsseite, von achtern nach vorn gesehen«.
»Die Benennung erklärt sich daher, daß in der Urzeit das Steuer auf der rechten Seite des Schiffes war, so daß Backbord die dem Steuernden im Rücken liegende Schiffseite war.« (Friedrich Kluge, Seemannssprache, 1911) Jacob Grimm nennt das Wort im Deutschen Wörterbuch 1854 »unhochdeutsch«, weil es nach den Lautgesetzen korrekt der Bachbort heißen müsse. In der dt. Schriftsprache seit dem 15. Jahrh. belegt, aus mittelniederdt. bacbort, niederländ. bakboord, schon altengl. bæcbord. Verwandt mit →back, →Bord, Gegenwort zu →Steuerbord. Französ. bâbord beruht auf einer Entlehnung aus niederländ. bakboord, die vom französ. Adjektiv bas »niedrig, unten« beeinflusst wurde; aus Frankreich stammen wiederum span. babor, port. bombordo, italien. babordo. Im Englischen wurde bæcbord im Laufe des Mittelalters durch ladde-, lade-, latheboard verdrängt, daraus heute larboard, wörtl. dt. »Ladebord« als Seite, auf der Fracht geladen wurde, weil sie zum Kai lag, wenn das Schiffssteuer an der rechten Bordwand angebracht war; ähnlich auch das gebräuchliche engl. port side »backbord«.
Karl Koppmann, Das Seebuch (1876, mit einer Quelle des 15. Jahrh.): »eyn kleyne eylant, … dat sal he laten an bacbort.«
Friderich Martens, Spitzbergische oder Groenlandische Reise-Beschreibung (1675), vom Wal: »das Theil, da der Schwantz abgehauen, machen sie feste, fornen am Schiffe, und den Kopff nach hinten zu, in der Mitte deß Schiffs bey der grossen Wand, an Backbord des Schiffes selten geschicht, daß die Walfische länger seynd, als der Platz von fornen biß in der Mitten zurechnen, wanns nicht zu kleine Schiffe seynd – durch die Backbort aber wird verstanden, wenn ich von fornen nach hinten im Schiff gehe zur rechten Hand.«
Jens Jacob Eschels, Lebensbeschreibung eines alten Seemanns (1835): »nur mußte Alles geschwind von vorne des Schiffs nach hinten geschafft werden, z. B. die schweren Ankertauen, die Schalupen voll Wasser hinten am Steuerbord aufgezogen werden und das Schiff über Steuerbordseite schief gelegt werden, weil wir hören konnten, dass der Schade an der Backbordseite war, da das Wasser hier stark ins Schiff einlief.«
→Steuerbord (1627), →Davit (1864), →krängen (1899)
Badegast, der, ironisch »eine Person an Bord ohne seemännische Funktion«.
Seit dem 19. Jahrh. belegt, wohl entwickelt nach Hüttsgast »die nicht seemännischen Teilnehmer an der Offizierskajüte«, unter dem Eindruck der aufkommenden Badekultur. Die Wortteile gehen auf german. *baþa- »Bad« und *gasti »→Gast« zurück, dies auf indoeurop. unsicher *ghostis »Fremder«.
Albert Berg, Die preußische Expedition nach Ost-Asien (1864): »[Die Ärzte], die Intendanturbeamten und die Seesoldaten werden nicht eigentlich zu den Seeleuten gerechnet und von diesen – sammt allen Passagieren – gelegentlich mit dem Schmeichelnamen Badegäste bezeichnet.«
Reinhold Werner, Das Buch von der Deutschen Flotte (1898): »Hinter dem Großmast spazieren in lebhafter Unterhaltung begriffen – die Badegäste; zu ihnen gehören alle diejenigen Bewohner der Offiziersmesse, welche keine Seeleute von Beruf sind, wie Ärzte, Prediger.«
Bagien →Begienrah
Bai, die, »Meeresbucht«.
Niederdt. sandbai »Bucht mit Sandgrund« (15. Jahrh.) aus niederländ. baai, dies aus mittelfranzös. baie »→Bucht«. Herkunft umstritten, Theorien u.a.: aus span. bahia, port. báia, aber diese Bezeichnungen sind selbst recht jung, von mittellat. baia »Hafen«, aber der Beleg bei Isidor von Sevilla aus dem Jahr 640 bezieht sich nur auf den Namen des römischen Seebades Baiae am Golf von Neapel, aus altfries. *baga »Kurve«, aber ohne weitere Belege und mit unwahrscheinlich frühem Übergang ins Fränkische, aus französ. l’abbayé, lat. abbatía »Abtei« nach einer Abtei, die der französ. Insel la Baie, la Baye (heute Noirmoutier) und der umliegenden Bucht von Bourgneuf bei Nantes ihren Namen gegeben haben könnte. Dagegen spricht die Betonung, aber in dieser Region ist das Wort früh bezeugt. Das dorther stammende Seesalz hieß mittelniederdt. bayesolt, mittelniederländ. bayesout, beide verkürzt zu baye; wohl ehestens nach der Küstenlinie zu französ. bayer, altfranzös. baer, lat. badare »gähnen, klaffen, den Mund aufmachen«, auch als frühneuhochdt. bai »Fenster, Maueröffnung«. Eine Vermischung von und könnte die Doppelbedeutung der Entlehnung engl. bay »Golf, Saline« erklären. Die dt. Schreibung Bay beruht auf einer Übernahme aus dem Englischen. Baiensalz wurde aus dem Golf von Bourgneuf auf Schiffen auch nach Preußen und von dort weiter nach Litauen und Russland gebracht; in Ostseequellen des 15. Jahrh. ist das Wort gut belegt.
Johann Georg Aldenburgk, West-Indianische Reiße (1627): »Es wurde abermal ein Nachen mit etlichen Musquetirern, Hochboßmann vnnd Matroosen wider abgeschicket die rechte Bahje außzuspehen.«
Joachim Heinrich Campe, Sammlung interessanter … Reisebeschreibungen für die Jugend (1787): »endlich erblickte der Officier eine kleine Bai, an deren innerstem Gestade eine Stadt mit einer kleinen Citadelle lag.«
→kreuzen, →kappen (1627), →Brackwasser (1669), →Seemeile (1778)
Bake, die, »umflutetes, feststehendes Orientierungs- oder Signalzeichen für Seeleute«, schwimmend als Bakentonne.
Mittelniederdt. bāke, mittelniederländ. baken, altnord. bāken, altfries. bāken, beken, altengl. bēacn, engl. beacon »Leuchtfeuer«, zu german. *baukna- »Zeichen« und mit altind. bháti »leuchtet«, griech. phainein »sichtbar machen« auf indoeurop. *bhā- »leuchten« zurückzuführen. Eng verwandt ist althochdt. bouhhan »Zeichen«, aus dem am Bodensee noch Bauche »Boje« erhalten ist; weitläufig verwandt sind Phänomen, Fanal, russ. bélyj »weiß«; nicht verwandt mit Pauke, Bauch.
Deutscher Orden, Handelsrechnungen (1428): »zcu Dordrecht bakegelt, off zcu segeln«, etwa »zu Dordrecht [Holland] Bakengeld, um durchzusegeln.«
Hamburger Pilotageordnung (1657): »wir funden aber auff der Insel nichts als forn eine Bake von 4 langen zusammen gebundenen Stangen, auff welchen viel Wurzeln und Gepüsche lag, damit es den Seefahrenden Nachrichten der Insel, weil sie niedrig, geben kunte.«
Johann Hübner, Reales Staats-, Zeitungs- und Conversations-Lexicon (1717): »Baken … hohe Feuerzeichen, Wacht- und Leuchttürme, auf welchen an dem Seestrand des Nachts Feuer gehalten wird, den in der See herumschwebenden Schiffen dadurch Nachricht zu geben, wie sie ihren Kurs richten sollen, damit sich nicht im Finstern aufs Land auflaufen und stranden mögen.«
Henri de Méville, Auf Back und Schanze (1902): »Leuchtturm und Kugelbaake, die letztere das seemännische Wahrzeichen Kuxhavens, bleiben hinter den Schiffe zurück.«
Balje, Balge, die, »Hälfte einer in der Rundung durchgesägten Tonne«, hölzernes Wasch- oder Schöpfgefäß an Bord.
Aus niederländ. balie zu französ. baille, daher auch erloschenes engl. bail, und galloroman. *bajula »Tragzuber« zu lat. baiulus »Träger, Lastträger«, baiulare »tragen« ungeklärter Herkunft.
Adolf Decker, Diurnal der Nassawischen [holländischen] Flotta (1629): »ein jeder soll wol in acht nehmen, daß bey jedwedern stück Canon ein Balie Wasser werd gestelt.«
Cornelis Gijsberts Zorgdrager, Alte und neue Grönländische Fischerei und Wallfischfang (1723): »er machte von Stund an Salzwasser von Peckel-Fleisch warm, gosse selbiges in einen auf den Schiffen gebräuchlichen Zuber, Balie genannt, und ließ sie mit den Füssen darein setzen.«
Jens Jacob Eschels, Lebensbeschreibung eines alten Seemanns (1835): »eine lebendige junge Robbe griffen wir, brachten diese an Bord und hielten sie sechs Wochen lang lebendig in einer Balje mit Seewasser.«
Ballast, der, »auf Schiffen schwere Last zum Gewichtsausgleich, um die Stabilität zu erhöhen«.
Auf Frachtern bestand der Ballast früher oft aus Sand, Steinen oder Eisen, »daß sie nicht umbfallen« (1548), und Wasser, seit Motorpumpen gebräuchlich sind. Bei Booten sind heute Ballastkiele verbreitet. Im Hafen von Amsterdam galt nach einem Erlass von 1496 die Pflicht, alle Käufe und Verkäufe von Ballast über ein Ballast-Comptoir abzuwickeln, wohl um Selbstbedienung in Hafennähe zu verhindern. Niederdt., -länd., engl. ballast; das frühneuniederländ. balglast ist volksetymologisch verformt. Die ältesten Formen sind altschwed., altdän. barlast, wohl von bar »nackt, bloß« sowie last »Last, →Ladung ohne Handelswert«, also nur des Gewichtes wegen. Der Begriff könnte von Südschweden aus im ganzen Hansegebiet bekannt geworden sein, die Herkunft ist unklar: Der Wortteil bar geht über german. *baza- »bar, bloß« auf das gleichbedeutende indoeurop. *bhoso- zurück, das vielleicht von *bhes- »reiben, abreiben, kauen« stammt; dann trägt bar die Ausgangsbedeutung »abgerieben, blank«. Der Wortteil -last »Last, Ladung« aus gleichbedeutendem westgerman. *hlasti- geht zurück auf german. *hlaþ-a- »laden, einfüllen«. Nicht ausgeschlossen ist auch eine Erklärung mit bal »schlecht« als »schlechte Schiffsfracht, die man nur ladet um dem Schiffe den nöthigen Tiefgang zu geben«; dann beruhte barlast auf Volksetymologie. Einige romanische Sprachen haben das Wort für Ballast direkt aus dem Abstraktum Last abgeleitet: französ. lest, span. lastre, port. lastro; andere gingen vom Materiellen aus: span. zahorra, altkatalan. saorra, italien. zavorra aus lat. saburra »Schiffsand, Ballast« von sabulum »→Sand, Kies«.
Anordnung des Sandballastes zur einfachen Berechnung seines Schwerpunktes, 19. Jahrh.
Otto Heinrich, Deutsche Pilgerreisen (1521): »aber die Leut [im Schiff] waren fast alle erschossen oder zerhauwt worden, ussgescheiden etlich hetten sich im Palast in sandt verborgen, denn war nichts geschehen.«
Walter Raleigh, Beschreibung deß goldreichen Königreichs Guiana in America (1599): »deß Sontags zu Morgen warffen wir den Ballast darauß.«
Christoph Fürer von Haimendorf, Reise von Venedig auf Alexandria in Ägypten (1645): »dann kein Schiff von Cypern auff Venedig fahren darff, es lade dann daselbst die saburra oder Pallascht (also nennen die Schiffleut die Stein vnd Sand, so sie zu vnterst ins Schiff laden, adamit selbes sein rechte Schwere oder Gewicht habe, vnd gegen dem Wind desto besser bestehen könne, vnd nicht leichtlich vmbgestürtzt werde.«
→Steuerbord (1627), →Kasko (1731), →Bark (1906)
Bambuse, der, »schlechter Matrose«, »Schiffszimmermann, der nur als Handlanger dient«.
Wohl entlehnt aus niederländ. bamboes »Bambus«, auch »unerfahrener Seemann«, vielleicht bildlich, weil er steif wie ein damals gebräuchlicher Bambusstock herumstand. Dt. Bambus für das tropische Rohrgras stammt ebenfalls aus dem Niederländ. und geht über portugies. Vermittlung auf südindische oder malaiische Dialekte zurück. Als abwertende Bezeichnung schließt bamboes an französ. bamboche »Bambus«, »Marionette, Kleinwüchsiger« an, letzteres von italien. bamboccio »Kindchen«, nach bambino »Kind«. Dann Bambuse eher zu verstehen als »einer, dem alles erklärt werden muss, Lernender, Befehlsempfänger«.
Adolf Schirmer, Lütt Hannes, Ein Seeroman (1868): »die Matrosen nämlich, die gedienten sowohl als die Jungmänner oder Bambusen, wie man jene Burschen nennt, welche noch nicht völlig mit dem Seedienst vertraut sind, ferner der Koch sammt seinem Maat, … sie alle machten Jagd auf einige zwanzig Kaninchen.«
Baratterie, die, »Betrug oder Diebstahl zu Lasten des Eigentümers von Schiff oder Ladung«.
Niederländ. baraterie, engl. barratry, altfranzös. baraterie, barterie gehen zurück auf altfranzös. baras »Betrug, Ärger«. Herkunft unklar; Vermischung mit »Piraterie« (→Pirat) möglich. Die Ausgangsbedeutung kann »Verkehr, Handel, Geschäft« bedeutet und sich abwertend zuerst in den romanischen Sprachen verbreitet haben. Vielleicht liegt griech. prattein »handeln« oder eine german. Wurzel, altbreton. brat, altirisch mrath »Betrug«, altnord. báratta »Wettbewerb, -kampf« zu Grunde.
Johann Hinrich Röding, Allgemeines Wörterbuch der Marine (1794/96): »Baratterie, Betrügerei, die von Schiffern zum Schaden der Reeder und Befrachter gemacht werden kann (z. B. Verfälschung und Bestehlung der Güter oder Nebenwege, die mit dem Schiff ohne Wissen der Reeder gemacht werden).«
Jacob von Eggers, Neues Kriegslexicon (1757): »Barat, Unterschleif, der von einem Schiffer durch Verschweigung oder Unterschlagung der ihm anvertrauten Güter, oder durch einen genommenen Umweg begangen wird.«
Bewaffnete Bark des Mittelmeeres mit Geschützpforten, Stich vom Ende des 18. Jahrh.
Bark, die, ein Großsegler.
Eine Bark trägt drei →Masten, zwei voll getakelte (→Fock-, Großmast) und einen →Besan (Besanmast). Bei mehr Masten wird dies durch den Zusatz »Viermast-«, »Fünfmast-« ausgedrückt. Die Trennung von Bark und Barke als großes und kleines Schiff wird erst ab dem 18. Jahrhundert deutlich; vor diesem Hintergrund ist auch eine zusätzliche Neuentlehnung aus engl., niederländ. bark möglich. Wortgeschichte →Barke.
Johann Hinrich Röding, Allgemeines Wörterbuch der Marine (1794/96): »Barke oder Barkschiff, großes dreimastiges Schiff, das bloß zum Handel eingerichtet ist, und daher um mehr Platz zu behalten nicht so scharf als eine Fregatte sein muß.«
Paul Gerhard Heims, Von der Wasserkante (1897): »Die meisten großen Dampfer sind als Barkschiffe getakelt, d.h. als Dreimaster mit Raaen.«
Hamburgischer Correspondent (13.1.1906, Morgenblatt): »Die in Ballast von hier nach Port Talbot bestimmte Hamburger Viermastbark Alster … lag gestern nachmittag Nordnordwest vom Außenfeuerschiff vor beiden Ankern.«
→Konvoi (1707), →Schot (1720), →Helling (1888)
Barkasse, die, auf Kriegsschiffen das größte Beiboot, im Hafenbetrieb ein Verkehrsboot.
Im 18. Jahrh. ins Deutsche entlehnt, geht es mit französ. barcasse, span. barcaza auf italien. barcaccia zurück, eine Bildung zu barca »Boot, →Barke«. Zunächst führt die Endung -accia abwertend auf »untaugliches, schadhaftes Boot«, wird aber überlagert von der spanischen Vergrößerungsform -za zu barca. Die span. und französ. Bedeutung lautet zum Zeitpunkt der Entlehnung ins Deutsche bereits »großes Boot«, bedient sich aber der Lehnform aus dem Italienischen.
Barkasse des westlichen Mittelmeeres, 18. Jahrh.
Ersch/Gruber, Allgemeine Encyclopädie (1821): »Barkasse ist das größte Boot, das großen Schiffen dazu dient, die Anker zu lichten und auszubringen, Wasser zu heben u. dgl.«
Friedrich Gerstäcker, Reisen um die Welt (1847): »als die beiden Kanonen der Amazone wieder geladen und abgeschossen worden, antwortete aus der jetzt sichtbar werdenden Barkasse und aus den kleinen Jollen eine Salve von Musketen oder Jagdflinten.«
Albert Berg, Die preußische Expedition nach Ost-Asien (1864): »zwischen dem Fock- und dem Grossmast sind die vier grossen Boote eingesetzt – die beiden Barcassen und die beiden Pinassen, je zwei über einander.«
Barke, die, poetisch für »Boot«.
Mittelniederl. barke »kleiner Küstensegler«, auch »großes Ruderboot«, geht über mittelfranz. barque, altfranzös. barge auf frühroman. barca zurück. Weitere Herkunft unsicher: zu frühroman. barra »Stange« →Barre, über lat.*bārica zu griech. bāris »ägyptischer Nachen«, koptisch bāri für ein Boot, das auf dem Nil verkehrte, wobei das Wort allerdings zuerst in einer Inschrift um das Jahr 200 in Portugal bezeugt ist, »aber wohl schon seit Cäsars Tagen bei der Beschreibung festlicher Schiffskämpfe zwischen der ägyptischen und phönizisch-persischen Flotte gebraucht« wurde (Lloyd/Springer, Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen, 1988), zu altnord. borkr »Borke, Rinde« als »ein Boot aus Rinde«. Die Trennung von Barke und →Bark als kleines und großes Schiff wird erst ab dem 18. Jahrhundert deutlich, Barke ist heute veraltend.
Walter Raleigh, Beschreibung deß goldreichen Königreichs Guiana in America (1599): »[Wir] namen vnsern Lauff nach Trinidado, allein mit meim Schiff vnd einer kleinen Barcken.«
Kaspar von Stieler, Zeitungs Lust und Nutz (1695): »Barque, Barke ist ein kleines Schiflein so an dem Strande hinzufahren pfleget.«
Johann Wolfgang von Goethe, Rinaldo (1799): »Zu dem Strande! zu der Barke! / Ist euch schon der Wind nicht günstig, / Zu den Rudern greifet brünstig!«
→Tonnage (1580), →Gat (1673), →Piroge (1741)
Barkun, der, Plural Barkuns, »Auslegerkran, →Davit«, allg. »Hebelbaum«, zuvor »Schiffsbalken«.
Dt. auch Balkuner, Entlehnung aus niederländ. barkoen, mittelniederländ. barcoen, brackoen, dies aus mittelfranzös. bracon »Balken«, dorther auch engl. bracket »Träger«. Das lat. Ausgangswort ist bracchium »Arm«, weiter →Brasse.
Der geöffnete See-Hafen (1702): »Von diesem über die krumme überhängende Höltzer gelegten Quer-Balcken, lauffet ferner zu jeglicher Seite ein strackes Innholtz auf, und werden dazwischen 5 Balckonners oder lange Balken aufgerichtet.«
Max Foß, Marine-Kunde (1901): »die leichteren Boote aber hängen außen in Davits und Barkuhnen in der Nähe des Kreuzmastes.«
Barre, die, »veränderliche Sandbank vor einer Flussmündung oder Hafeneinfahrt«.
Nach Johann Karl Gottfried Jacobsson, Technologisches Wörterbuch (1781) »eine Sandbank oder eine Reihe Klippen im Meer, so vor dem Eingange des Hafens oder Stroms liegen, also daß man nur bei der Flut oder hier und da zwischen denselben durchkommen kann«. Erst seit dem 17. Jahrh. in nautischer Bedeutung belegt, als »Schranke, Absperrung« entlehnt aus altfranzös. barre »Querstange«, mittellat. *barra »Querbalken«. Herkunft unsicher: mit altirisch barr »oberstes, buschiges Ende« über gall. *barros »Wipfel, Haarschopf« zu indoeurop. *bhar-, *bhor- »Hervorstehendes, Borste, Spitze«, mit lat. vārus »entgegengesetzt«, frühroman. vāra »quer«. Verwandt mit Barriere, Barrikade und Bar, ausgehend von einer ursprünglichen Barre »Schranke« zwischen Gast- und Schankraum, die sich selbst zur Bar (zum Tresen) entwickelte und schließlich dem Lokal den Namen gab.
Philippus Baldaeus, Beschreibung der Beruhmten Ost-Indischen Kusten (1672): »wie sie in aller Eil eine Armade von 16 wolausgerüsteten Schiffen von Batavia nach den Indischen Gegenden abfärtigen möchten, um … die Portugesen vor der Bahre von Goa anzugreifen.«
Ludwig Theobul Kosegarten, Rhapsodieen (1794): »Inzwischen arbeitete das Tau so gewaltsam in den Kluysen, daß wir jeden Augenblick fürchten mußten, das Tau gesprengt zu sehn, und mitten in die Barren geworfen zu werden … Indem ich die Barren erreichte, schleuderte die prellende Brandung mich hoch empor.«
Herman Soyaux, Aus West-Afrika (1879): »vor uns gerade aus warf das Meer am Ufer mächtige Schaumberge in die Höhe: es war die Barre, über der die ausströmende Ebbe des Palmas [an der Küste von Guinea] mit den Wellen des Oceans kämpfend verschmolz.«
→Galion (1627), →Tanker (1935)
Barsch, der, ein Raubfisch; die Familie der Echten Barsche (Percidae mit Flussbarsch und Zander) lebt im Süßwasser; viele Barschartige (Percomorphi, u.a. Zacken- und Buntbarsche) leben im Salzwasser.
See- oder Wolfsbarsch (Labrax lupus, Loup de mer).
Mittel-, althochdt., altsächs. bars, niederländ. baars, altengl. bærs, engl. bass, basse, ausgestorben barse. Namengebend war die stachlige Rückenflosse, zu german. *barsa und indoeurop. *bhres- »Spitze«, *bhárs-o- »der mit Stacheln versehene«, *bhar, *bhor »Borste, Spitze.« Verwandt mit barsch, Bart(el), Borste, Bürste. Die althochdt. Nebenformen bersa, bersih entwickeln sich weiter zu mittelhochdt. u.a. birse und bersich, entlehnt zu italien. pesce persico wörtl. »Perser-, Pfirsichfisch«, französ. persègue. Aus der mittelniederländ. Form ba(e)rse entstand französ. bar »Wolfsbarsch«, heute verdrängt von loup de mer, dies von lat. lupus »Wolf«. Die skandinavischen Formen isländ. ögur, altschwed. agh-borre, schwed. abbore, norw. aaborr(e) gehen auf altnord. ọgr »Rotbarsch« zurück und mit litauisch ežegys »Kaulbarsch«, altpreuß. assegis »Barsch« auf indoeurop. *ag-, *ak- »scharf, spitzig«; zu althochdt. agabūz »Flussbarsch« →Butt. Manche Formen haben sich wegen der hervorstehenden Augen des Fisches auch unter dem sprachlich nahen Einfluss von indoeurop. *ok- »Auge« entwickelt, so russ. okuni »Barsch«. Nicht verwandt sind die aus lat. perca, griech. perkē »(Fluss-)Barsch« stammenden Ableitungen, engl. perch, französ. perche zu griech. perknos »getüpfelt«, die auf indoeurop. *perk- »gesprenkelt« zurückgehen; wie die lat. Bezeichnung porcus »Fisch mit Stachelflossen« ist daraus auch dt. Forelle hervorgegangen, beide wegen ihrer farbigen Rückentupfen.
In der Antike gehörten Seebarsche zu den beliebtesten Fischen; Plinius bezeichnet in seiner Naturkunde (nach 77 n. Chr.) eine Schüssel davon als Teil des höchsten Aufwandes eines Festmahls; mit Horaz stimmt er überein, dass die besten aus dem Tiber zwischen den beiden Brücken stammten.
Hans Hajek (Hg.), Daz buoch von guoter spise (1350): »Ein gebacken můs von vischen. Dar zů solt du nemen einen bersich gebeizt in ezzig, vnd wirf in denne in milich.«
Johann Heinrich Zedler, Universal-Lexikon (1733): »Es gibt auch einen Barsch in der See …, teutsch See-Barsch genannt, welcher nicht so groß als der Flussbarsch wird. … Er findet sich gemeiniglich um die Klippen und nähret sich mit kleinen Fischen. Zum essen soll er nicht viel taugen.«
Bätinge →Betinge
Baum, der, »längsschiffs verlaufendes Rundholz«, auf größeren Schiffen fest angebracht (z. B. Klüverbaum) oder einseitig schwenkbar (z. B. Ladebaum), auf Yachten die einseitig befestigte →Spiere, an der das Unterliek (→Liek) eines Segels befestigt ist, vor Häfen ein schweres, verkettetes Holz, um die Fahrt zu sperren.
Der Segelbaummacher, aus »Abbildung Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände«, 1698.
Seit dem hohen Mittelalter wird Baum oft in der Zusammensetzung »Segelbaum« für →Mast benutzt: althochdt. segalpoum, segilpoum, auch mastpoum. Mittel-, althochdt. boum, niederländ. boom, westgerm. *bauma- »Baum, Balken«. Herkunft unklar, vielleicht zu indoeurop. *bheu- »wachsen, gedeihen«. Mit engl. boom »Baum« eng verwandt ist beam »Horizontaltraverse«, jetzt das Maß »Breite über alles«.
Wohl als »Kiel«, zugleich für das ganze Schiff, bei Paul Fleming, Gedichte (1636): »zwei Schiffe kunten sich zu weichen nicht vergleichen. / Der übergebne Baum lief fast wie taub und blind / in sein Verderben hin.«
Als Hafenbaum bei Ernst Christoph Barchewitz, Ost-Indianische Reise-Beschreibung (1730): »auf solcher Fahrt kommt man zuerst auf dem Strohm Jaccatra an den Baum, allwo beständig ein Commando Soldaten aus dem Vierkant die Wache hat; dieser Baum wird allezeit des Abends nach 9 Uhr geschlossen.«
Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch (1854): »auf dem meer ragen die hohen bäume der schiffe.«
Mastbaum →Mars (1496/99), Segelbaum →Besan (1534/54)
Beaufort →Wind
bedaren, »sich beruhigen« (vom Wetter).
Entlehnung aus niederländ. bedaren, schwed. bedara »ruhig, still werden«, mit angelsächs. darian »verbergen«, altsächs. derni »verborgen«, ahd. tarnen »verbergen« zurückzuführen auf westgerman. *darnja- »verborgen«, das – vielleicht mit armenisch dadarem »nehme ab (vom Wind)« – von indoeurop. *dhare »halten, festhalten, zur Ruhe kommen« abstammt.
Wigardus à Winschooten, Seeman (1681): »het weer bedaart«, »das Wetter beruhigt sich.«
Jan TenDoornkaat Koolman, Wörterbuch der ostfriesischen Sprache (1879): »dat wer wil sük hēl nēt wer bedaren«, »Das Wetter will sich nicht wieder beruhigen.«
Begienrah, die, auch blinde Rah, »Rah ohne Segel, nur zum Halten des Segels darüber«.
Entlehung aus niederländ. bagijnera, begijnree, angeblich nach der religiösen Gemeinschaft der Beginen so genannt, »weil diese Raa ohne Segel ist und also dem eigentlichen Zweck einer Raa nicht dient« (Kluge, Seemannssprache), so wie die Beginen unverheiratet waren. Bagien, Bezeichnung für verschiedene Segel, oft Unter- oder Lateinsegel des Kreuzmastes.
Der geöffnete See-Hafen (1702): »Die Bagynen-Ree ist eine absonderliche Ree, welche recht in die Quer unter der Saaling des Bezaan-Masts befindlich, aber kein Segel daran geführet wird.«
beiliegen, »im Sturm mit wenigen Segeln so nahe wie möglich beim Wind liegen, damit das Schiff nur →dwars vertreibt«, Beilager, das, »Position und Besegelung zum Beiliegen«.
Niederländ. een bejlegger maken, bijleggen, im sexuellen Sinn schon althochdt. bilegen, mittelhochdt. bīlegen »beiliegen, beilegen, Beilager halten«.
Joachim Heinrich Campe, Sammlung interessanter … Reisebeschreibungen für die Jugend (1787): »Es erhob sich ein gräulicher Sturm mit so heftigen Windstößen, daß man die Masten durch Abnehmung der Bramstengen verkürzen, die Segel einreffen, und wie es in der Schiffersprache genannt wird, beilegen mußte.«
Elias Hesse, Ost-Indische Reise-Beschreibung (1687): »Den 26. dito musten wir abermahl groß Sturm-Wetter ausstehen, welches auch mit allen Schiffen ein Beylager verursachet; ein so genanntes Beylager bestehet darinn, daß erstlich das Ruder fest gemacht und gebunden wird, und also unbeweglich ist, und nur das Schoovet, als gröstes Seegel, nebst der Posan beystehen: dieses mag man auch wohl das letzte Gericht nennen; dess es also, auf itztbesagte Weise, zum höchsten kommen ist, und lernet ein Seefahrender in solchem Wetter auch wohl beten.«
Heinrich Brarens, System der praktischen Steuermannskunde (1807): »wann er im Sturme auf der See einen Beileger machen muß, so suche er die kleinen Segel vorne und hinten darnach zu stellen, daß sein Schiff ordentlich beilege, d.i. auf dem 6ten Strich vom Winde fortgehe.«
→Schäre (1647)
belämmern, »aufhalten, hindern«, Belämmerung, die, »Hindernis durch im Weg stehende Gegenstände an Bord eines Kriegsschiffs«.
Im Sinne von »langsamer machen«, ndl. belemmeren »hindern«, eine niederdt. Ableitung zu »lahm«, alt-, mittelhochdt., altfries. lam, altengl. lama, altnord. lami, german. *lama, die mit altkirchenslaw. lomiti »brechen« und russ. lom »Bruch« auf indoeurop. *lem- »brechen, zerbrechen« zurückzuführen sind. Verwandt: Lümmel.
John Brinckman, Sämtliche Werke, Bd. 4 (1912): »Is dat Rooder nich klor, sär ick to Jochen Jung; dat ward doch nich uthakte ore bilemmert sin?« »Ist das Ruder nicht frei?, sage ich zu Jochen Jung; es wird doch nicht ausgehakt oder belömmert sein?«
belegen, »ein Tau festmachen«.
Althochdt. bileggen »auf etwas legen, besetzen« im Sinn von »nicht mehr herausgeben, nicht nachgeben« geht zurück auf leggen »legen«, eigentlich »liegen machen«, dies zu althochdt. liggen »liegen«, das über german. *leg-ja- zu einer indoeurop. Wurzel *legh- »sich legen, liegen« führt.
Der belegte Teil eines Taus.
Friedrich Gerstäcker, Reise um die Welt (1847): »so schaute er denn, an ein starkes Tau geklammert, das er um sich und eine der Belegpinnen am grossen Mast geschlagen hatte, lange hinaus auf die Wogen und auf den bedeckten Himmel.«
Sophie Wörishöffer, Robert der Schiffsjunge (1887): »das betreffende Kommando heißt dann: Belegt das Ende.«
benepen sein, »bei Hochwasser auf Grund gelaufen sein«.
»Benepene« Schiffe waren oft nur bei Springflut frei zu bekommen; eine sprachliche Verwandtschaft mit (der schwächer ansteigenden) Nippflut ist naheliegend (→Gezeit). Niederländ. beneepen zijn geht mit dem Verb nijpen »kneifen, klemmen« und Nippel, engl. nipple »Brustwarze« auf eine unbekannte german. Wurzel zurück.
Johann Hinrich Röding, Allgemeines Wörterbuch der Marine (1794/96): »benepen wird von Schiffen gesagt, die bei hohem Wasser auf den Grund fest zu sitzen gekommen sind, und nur bei hohem Wasser wieder flott werden können.«
bergen, »in Sicherheit bringen«, z. B. Segel bei heraufziehendem Sturm, Menschen über Bord, im Wasser treibende Objekte.
Die Reihenfolge des Bergens für den Kapitän bei Schiffbruch – erst die Leute, dann das Gut – legte das Schiffrecht fest, etwa: »Sowan so ein schip tobricht, so scal de schiphere allererst berghen dhe lude und dar na dat rede goet.« (Hamburg 1292)
Mittelhoch-, -niederdt., -länd. bergen, althochdt. bergan, mittelniederländ. berghen, altengl. beorgan, altnord. bjarga, schwed. bärga, got. bairgan, verwandt mit litauisch birginti »sparen«, altkirchenslaw. nebrěšti »außer Acht lassen, missachten«, russ. beréč »hüten«. Die Wurzel ist vielleicht indoeurop. *bhergh- »bergen, verwahren«. Verwandt mit Herberge, borgen, Burg. Engl. salvage »Bergung«, französ. sauvetage, italien. salvamento, salvataggio gehen auf lat. salvare »retten« zurück.
Zur Bergung unterwegs: Rettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, um 1900.
→Fender
Jürgen Andersen, Orientalische Reise-Beschreibungen (1669): »es kamen die Einwohner dieses Orts Outzim, da wir gestrandet, häuffig zu unserm Hause, und gaben denen, die uns geborgen hatten, Geld, daß sie uns nur sehen und hören möchten.«
Daniel Defoe, Robinson Crusoe, übersetzt von Ludwig Friedrich Vischer (1720): »weil das Schiff noch immer auffrecht zu liegen schiene, wünschte ich mich an Boord, um wenigstens etliche mir nöthige Sachen daraus zu bergen – hier bekam ich Anlaß zur Erneuerung meines Schmertzens, dann ich sahe augenscheinlich, daß wann wir am Boord geblieben, wir alle geborgen, das ist lebendig an Land gekommen und ich nicht in einen so Trostlosen von aller Welt verlassenen Zustand gerathen wäre.«
Joachim Nettelbeck, Eine Lebensbeschreibung (1821): »Inzwischen waren auch von allen herumliegenden Schiffen Bööte und Fahrzeuge abgestoßen, um die beiden Menschen zu bergen.«
→Fall (1564), →Takelage (1591), →Ewer (1888), →flott (1907)
Bernstein →Glas
Besan, der, »Segel des hintersten Mastes, auch der Mast selbst«.
Die genauen Entlehnungswege in Europa sind unklar. In Deutschland gab es zwei Übernahmen, eine frühere mit dem Anlaut m- und eine spätere mit dem Anlaut b-, die sich schließlich durchgesetzt hat. Im 17. Jahrh. entlehnt aus niederl. bezaan, mittelniederländ. besane (1480), zuvor mesane, moisan, pusan, dän., schwed. mesan »Gaffelsegel am Hintermast«, span. mesana »Hintersegel, Hintermast«, französ. misaine »Vorsegel, Vormast, Fock«, mittelfranzös. migenne (zuerst 1382), engl. mizzen »Hintersegel« (1462). Die engl. Entlehnung geht direkt auf italien. mezzana »Hintersegel, -mast« (1348) zurück, vielleicht, nachdem 1410 den Engländern eine dreimastige Karacke aus Genua in die Hände fiel. Die frühere dt. Entlehnung mit Anlaut m- stammt direkt aus dem Italienischen, frühneuhochdt. missan (1487), maßane. Das italien. Wort kommt von mezzano, mezzo- »in der Mitte befindlich«, mittellat. medianus; medianum hieß auch das Besansegel der Römer. Wahrscheinlich ging die ursprüngl. Bezeichnung für ein kleines zusätzliches Segel, bei Isidor im 7. Jahrh. nachgewiesen, auf die Position an Bord über. Das lat. Grundwort ist medius »mittlerer, halb« zu griech. mesos und indoeurop. *medh-jo- »Mitte«. Die wechselnde Bedeutung »Vor-« bzw. »Hintermast« ist im Französischen ausgeprägt und erklärbar, weil der Besan als »Mittelsegel« sowohl zwischen Großsegel und Heck wie zwischen Großsegel und Bug betrachtet werden kann. Eine Übernahme von italien. mezzana aus arab. mazzān »Mast«, wazana »wiegen« ist wegen der frühen lat. Formen unwahrscheinlich; vielleicht liegt eine Entlehnung aus dem Italienischen ins Arabische vor. Besanschot an! war der Ruf zur Austeilung von Schnaps oder Rum hinten auf dem Deck am Ende einer Halse, unmittelbar nach dem Dichtholen des Besans; heute allgemeiner eine gerufene Einladung zum Drink nach gutem Manöver oder schwieriger seemännischer Arbeit.
Teil des Hinterschiffs mit Besan und Wanten des Großmastes, vor 1800.
Ritter Grünembergs Pilgerfahrt ins Heilige Land (1486): »der hinder segel vor der popen haist missanen und der fordrest haist drinket.«
Wahrhaftige Historie einer wunderbaren Schiffahrt, welche Ulrich Schmidel von Straubung von 1534 bis 1554 in America getan: »Zum annderen schussen sie den maßane, das ist den hinderen segelpaum auch zu stüeckhen.«
Paul Fleming, Gedichte (1636): »Mach nun die Focke voll und schwängre den Meisan, o günstiger Nordost.«
Schiffsjournal der Seewarte Hamburg (1838): »die Manschaft beschäftiget mit Schampfilasche [→schamfielen] zu versehen … nebst die beschädigten Mesahne zu repariren.«
→Fock (1638), Besanmast →achtern (1681, 1794/96)
Betinge, Bätinge, die, (Plural), »Balken oder Eisensäulen, um die an Deck eines verankerten Schiffes die Ankerketten gelegt wurden«.
Gleichbedeut. engl. bitts, französ. bitte, span. bita, italien. bitta »Ankerbeting« sind wahrscheinlich verwandt mit spätlat. bitus »eine Art Schandpfahl«. Dt. Beting ist vielleicht aus gleichbedeut. schwed. beting übernommen. Zugrunde könnte german. *beit-a- »beißen« im Sinn von »festbeißen, nicht mehr loslassen« liegen.
Der geöffnete See-Hafen (1702): »der Bäting oder 2 lange starcke Höltzer so ohngefehr bey der Focke-Mast stehen und hinunter biß ins [Schiffs-]Raum reichen, durch welches des Schiffs Breite gleichsam in drei Theile getheilet und an selbige noch ein Quer-Holtz gemachet ist, davon die Ende weiter heraus stehen; an diesen werden die Ancker-Touwen befestiget.«
Verklarung, Stadtarchiv Altona (1846): »glaubten, daß das Spill, Beding und Alles brechen würde.«
Beuling, die, »eine Art Zeitzünder für →Brander«.
Übernommen von niederländ. regional beuling »gefüllter Darm, Blutwurst«, dt. auch Zündwurst, französ. saucisson »Wurst, Zündwurst«.
Johann Hinrich Röding, Allgemeines Wörterbuch der Marine (1794/96): »bei einem Brander eine von Segeltuch gemachte Röhre, die mit Pulver gefüllt ist, um das Feuer nach den Stellen wo Pulver und brennbare Sachen liegen, zu führen.«
Bilge, die (früher der), »Kielraum des Schiffes«, in dem sich das Leckwasser sammelt.
Im 19. Jahrh. entlehnt aus gleichbedeutendem engl. bilge, dies aus altfranzös. boulge, buge, französ. bouge, bouchain »Bilge«, aus lat. bulga »lederner Sack, Uterus, Bauch«, italien. bulga »Sack«, und mit got. balgs »Schlauch« und altnord. bylgja »Woge« auf indoeurop. *bhel- »aufblasen, aufschwellen« zurückzuführen. Verwandt mit dt. →Wal, →Blatt, Bulge, Balg, engl. belly »Bauch«.
Edward Phillips, The new world of english words (1696): »billage-water is that which cannot come to the pumps«, »Bilgenwasser ist das, was nicht zu den Pumpen gelangt.«
Lebensgeschichte des Capitain Carl Wolfgang Petersen (1880): »wegen der schiefen Lage desselben wollen die Pumpen nicht schlagen, weil das Wasser statt am Kiele im Bilge stand.«
Generalanzeiger für Stettin (1892): »das Wasser in den Bilgeräumen und der Wasserballast … ist durch die Quarantäneanstalt zu desinfizieren.«
Binnackel, das, »Kompasshäuschen«.
Seit etwa 1870 aus gleichbedeut. engl. binnacle entstanden, dies seit etwa 1750 aus engl. bittacle, dies aus port. bitacola, span. bitacula, franz. habitacle, ital. abitacolo »Kompasshäuschen«, von lat. habitaculum »Wohnstatt«, von lat. habitare »wohnen«, habere »haben«.
Joseph Stöcklein, Der Neue Welt-Bott (1729): »Habitacul, das ist in das Compaß-Zimmer.«
Adolf Schirmer, Lütt Hannes, Ein Seeroman (1868): »Da Petersen soeben fast alle dienstthuenden Leute auf dem Verdeck beschäftigte, und der Mann, der das Steuer zu regieren hatte, durch die totale Windstille zur Unthätigkeit verurtheilt, am Binnakel lehnend, wie das Kompaßhaus genannt wird, zu den Toppen hinaufstarrte, so stieg unser Held die letzte Stufe hinab und glitt übers Verdeck.«
Binne, die, »Deckbeplankung, Decksplanke«.
Niederdt. Form von Bühne »Brettergerüst, Boden«, wohl vom Haus- auf den Schiffbau übertragen, aber schon altengl. bytne »Schiffsboden, Kiel«, avestisch būna- »Boden«, vielleicht aus gleichbedeut. indoeurop. *bhudhnjo.
Leonhart Frönsberger, Kriegssbuch (1565): »ein Schiffsbrucken so ein Feldtzug von nöten, gehören zum wenigsten darzu dreißig guter wolbereiter starcker langer vnd zimlicher breiter Schiff, die da wol versorgt vnd verwart, mit sampt jr zugehörung, als … binnen, latten, sparren höltzern, auch nagel, seyler und kettinen – item dieser obgemeldten Schiff eins sol zum wenigsten siben oder acht schuch breit, sechtzehen oder achtzehen lang sein, vnd ein jegliche binne … so darauff gehört, sol sein so breit als dz schiff ist, vnd an der lenge haben zehen oder zwölff schuch.«
binnen, (nautisch) »in den Hafen, in das Schiff hinein«.
Niederdt., niederländ. Präposition der Richtung, zusammengezogen aus dem Präfix der Einwirkung be-, althochdt. bi-, mittelhochdt. be-, und der Ortsangabe inne, althochdt. innan, mittelhochdt. innen. Außerhalb Norddeutschlands meist als Lokalpräposition («inmitten, innerhalb«) gebraucht, etwa in Binnenland; alle Formen gehen auf die Präposition in zurück.
Michael Richey, Idioticon Hamburgense (1755): »dat schip is binnen kamen.«
Jens Jacob Eschels, Lebensbeschreibung eines alten Seemanns (1835): »die Lootsen entgegneten: weißt du wohl, daß, als du binnen kamst, eine Barkas mit Lootsen während der Gewitterbuy [-bö] bei dir kam.« Ebd.: »als die Sturzsee vorüber war, und die Matrosen, die über Bord gespült worden, wieder binnen kamen, und wir noch etwas, was auf dem Deck herumtrieb, bargen, lief ich in die Kajüte, um zu sehen, ob auch Wasser zu den Pforten einkäme.«
→Hafen (1855)
binnenbords, »im Schiff, ins Schiff hinein«. →binnen, →Bord.
Jens Jacob Eschels, Lebensbeschreibung eines alten Seemanns (1835): »meine beiden schweren Anker, welche mit den Anckerstöcken aufrecht, rund um den Kranbalks-Poller gesorrt [gezurrt], und die Schäfte derselben, mit den Händen binnen Bords, im Schafthock fest an Bord gesorrt waren, hatte die Sturzsee über Bord geschlagen.«
Paul Gerhard Heims, Im Rauschen der Wogen, im Branden der Flut (1890): »wenn dichter weißer Nebel wie ein ungeheures Leichentuch sich über die See breitet, sich um das Schiff hängt, daß es ist, als gebe es gar keine Welt mehr außer der ganz kleinen, stillen, verdrossenen, die hier binnenbords lebt.«
→Bord (1590)
blank, »blinkend, glänzend, klar« (An-, Aussicht).
Mittelnieder-, -hochdt. blank »glänzend«, german. *blanka »weiß« und wie dt. blinken auf indoeurop. *bhleg- zurückzuführen. Aus dem Germanischen in westliche und südliche Nachbarsprachen übernommen, französ. blanc mit Weiterentlehnung zu engl. blank »weiß, leer«, span. blanco, italien. bianco. Das ältere lat. albus wird verdrängt. →Blanker Hans
Schiffsjournal, Seewarte Hamburg (1873): »In der Blänke erheben sich die Köpfe von cumuli über die Kimm.«
Blanker Hans, »personalisierte Bezeichnung der Nordsee«.
Erster Beleg in der Nordfriesischen Chronik Anton Heimreichs (1666), der zufolge der Deichgraf von Risum nach Fertigstellung eines neuen Deiches gerufen habe: »Trutz nun, blanker Hans«; der Deich sei jedoch kurz darauf bei der Zweiten Großen Mandränke 1634 gebrochen.
Der Lyriker Detlev von Liliencron machte den Namen mit seinem Lied »Trutz, Blanke Hans« von 1882/83 bekannt:
Heut’ bin ich über Rungholt gefahren, die Stadt ging unter vor sechshundert Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört. Die Maschine des Dampfers schütterte, stöhnte, aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte: Trutz, Blanke Hans.
Die Gartenlaube (1906): »draußen aber liegt der blanke Hans, die Nordsee, und brüllt – alle Häuser von Klein-Moor verschlang der blanke Hans in einer Nacht.«
Wilhem Poeck, De Herr Innehmer Barkenbusch (1906): »Der blanke Hans liegt in seiner Wiege, hat seine blauen Augen aufgeschlagen und lächelt wie ein unschuldiges Kind.«
Blauer, der Blaue, »Kurzbezeichnung für den Schiffszimmermann«.
Die Herkunft der Bezeichnung ist unklar, hat aber wahrscheinlich nichts mit der Farbe zu tun, sondern mit der Tätigkeit: bläuen, bleuen »schlagen«, althochdt. bliuwan, altengl. bláwan, engl. to blow, german. *blewwa-. »Bläuen« wird volksetymogisch gern mit »blau schlagen« erklärt, »der Blaue« durch die Farbe des Drillichs, seiner Arbeitskleidung.
Friedrich Gerstäcker, Die Flußpiraten des Mississippi (1848): »Sie sind auch vielleicht wirklich so lange gefahren, lachte der Blaue, aber auf Dampfbooten, als Feuerleute und Deckhands, nicht als Flatbootmänner.«
Blauer Peter, »auf Kriegsschiffen eine kleine Flagge am Vortopp, die die Abfahrt anzeigt«.
Übernahme aus gleich bedeutendem engl. Blue Peter, von Captain Frederick Marryat 1823 unter dieser Bezeichnung in sein Signalflaggensystem aufgenommen; in Deutschland war zuvor die Bezeichnung Blaue Flagge üblich. Sie bezeichnet zudem den Buchstaben P; daraus hat sich auch die Bedeutung als Lotsenfahne entwickelt (»P is for pilot«), →Pilot.
Ernst Christoph Barchewitz, Ost-Indianische Reise-Beschreibung (1730): »Als wir nun drey Tage waren am Lande gewesen, sahen wir vor unserm Schiffe die blaue Flagge wehen. welches ein Zeichen war, daß, wer am Lande, wieder am Boort kommen solte, weil der Schiffer fertig, wieder unter Segel zu gehen.«
Schiffsjournal, Seewarte Hamburg (1832): »Morgens 8 h wurde auf den Grossen Top der Princess Louise der Blow Petre aufgeheisst, worauf dasselbe Signal auf dem Flaggstock auf Fort Ladder-Hill aufging und ein Schuss daselbst fiel.«
Victor Laverrenz, Eine Winterfahrt nach Amerika (1902): »Von dem Fockmast unseres Schiffes wehte der blaue Peter, jene bekannte blaue Flagge mit weißem Felde in der Mitte, welche die bevorstehende Abfahrt anzeigt.«
Blinde, die, »unterstes Segel des Bugspriets«, »Schutzdeckel«.
Nebenform von Blende »Abdeckvorrichtung«, dies zu dt. blenden, althochdt. blenten, altengl. blendan, beides verwandt mit blind »trübe, finster, ohne Sehvermögen«. Die Vorstufen sind unsicher: über westgerman. *blandija- aus untergegangenem **blend-a- »sich verfinstern«; hierzu gehört german. *bland-a- »mischen, engl. to blend, womit ursprüngl. die Trübung durch das Einrühren in eine Flüssigkeit bezeichnet wäre. Oder german. *blandjan »blenden«, eine Ableitung zu blind, german. *blenda-, dies mit baltischen und slawischen Verwandten zu indoeurop. *bhlendh- »trübe sein«, das zur indoeurop. Wurzel *bhel- »glänzend, weiß« gehört; dann auch verwandt mit →Flaute, Blüse.
Johann Georg Aldenburgk, West-Indianische Reiße (1627): »da waren jhre Rehe vom Sturm in Stücken gangen, auch die Masten, Segel und Towwerck, davon sie nicht mehr als zweene Segel vnd die Blende hatten.«
Johann Hinrich Röding, Allgemeines Wörterbuch der Marine (1794/96): »Blinde, Luken, welche man bei schwerem Sturm vor die Kajütsfenster setzte, damit solche nicht von der See eingeschlagen werden.«
Dietrich Wilhelm Soltau, Beyträge zur Berichtigung des Adelungschen … Wörterbuchs (1806): »Blinde, zwei Segel am Bugspriet (das unterste derselben wird schlechtweg die Blinde genannt, das oberste heißt die Schiebblinde).«
Block, der, »Gehäuse mit Rolle oder Scheibe(n) zur Führung von Tauwerk«, allgemein »aus Teilen zusammengefügtes Ganzes.«
Engl. block, niederländ. blok, ähnlich in zahlreichen europ. Sprachen. Herkunft unsicher; mit mittelhochdt. bloch, althochdt. biloh, mittelniederländ. beloc, beloke »Verschlossenes« zu german. *bi-lūkan, *lūkan »(be-, ver-)schließen«, dann verwandt mit →Luk und engl. lock »(Tür-)Schloss, Schleusenkammer«, mit mittelhochdt. bloch, bloc, althochdt. bloh, bloc »Holzklotz, Bohle, Stamm« und wie german. *belkon, *balkon »Balken« zu indoeurop. *bhleg- »Bohle, Stamm« und *bhel- »aufblasen, aufschwellen«, dann verwandt mit →Blatt und →Wal.
Schiller/Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch (1881, Quelle von 1542): »2 remen, 4 klene blockke tho enem schipe«, »2 Riemen, 4 kleine Blöcke zu einem [für ein] Schiff«.
Johann Karl Gottfried Jacobsson, Technologisches Wörterbuch (1781): »Blockrolle, Rolle auf einem Schiff, über welche die Schiffstaue gehen, und aus einem Block oder dem Stamm eines Baumes geschnitten sind.«
Blöcke, Stich um 1790.
Sophie Wörishöffer, Robert der Schiffsjunge (1887): »bei sehr grossen Segeln werden in den Kauschen (→Auge) dieser Ecken Flaschenzüge, Blöcke genannt, befestigt.«
→Fall, →Talje, →Moses (1702), →Want (1783), →Gut (1907)
blockieren, »Häfen und Flussmündungen, versperren«, meist durch Kriegsschiffe, Blockade, die, »Versperrung«.
Im 17. Jahrh. aus französ. bloquer »sperren« übernommen, dies von französ. bloc »Klotz« und/oder blocus »Fort, Festung«, das aus mittelniederländ. bloc-hus »Verteidigungsanlage aus Balken, Blockhaus« entlehnt ist. Zur unklaren Ableitung →Blocks.
C. E. S., Das verwarloste Formosa (1677): »es wäre doch eine grosse Bloquade auf so lange Monate gnug, das Volck zu consumiren.«
Joseph Stöcklein, Der Neue Welt-Bott (1726): »erwehnter Losencillo unterhält eine genaue Verständnus mit derjenigen Frantzösisch- und Englischen Rauber-Flotte, welche auf dem stillen Sud-Meer herum creutzet, und bißher viel Spanische Schiffe hinweg genommen, den Haafen und die Stadt Panama ein halbes Jahr blockiert, auch der Spanischen Silberund Gold-Flott aufgepasset hat.«
Reinhold Werner, Das Buch von der Deutschen Flotte (1898): »Im November benutzte letztere jedoch eine passende Gelegenheit, die Blockade zu brechen und ihrer Ordre gemäß im Biskayischen Meerbusen zu kreuzen.«
Blüse, die, »Signalfeuer«, auch →»Leuchtturm«.
Mit dän. blus, engl. blaze, mittelhochdt. blas, altnord. blys, »Fackel, brennende Kerze« zurückzuführen auf gleichbedeut. german. *blasôn, blusjan, dies zu indoeurop. *bhel- »glänzen, weiß«. Verwandt mit →Flaute, →Blinde, blass, Blesse; wohl nicht verwandt mit blasen.
Michael Richey, Idioticon Hamburgense (1755): »blüse, Feuerturm, Warte, Pharus [Leuchtturm], dergleichen Hamburg auf seinem Neuen Werke und auf Helgoland unterhält, zum Behuf der Schiffe, die sich des Nachts am Munde der Elbe nach diesem Feuerrichten.«
Bö, die, »heftiger Windstoß«.
Im 17. Jahrh. entlehnt aus niederländ. bui, auch dorther zu dän. byge, schwed. by. Das Wort geht wohl u.a. mit altruss. buj »tapfer, wild« auf indoeurop. *bheu-, *bhu- »wachsen, anschwellen« zurück. Unsicher ist der Einfluss der Lautmalerei, wofür *fu- »blasen« naheliegt; vgl. auch den zweiten Wortteil von →Taifun. Bö in anderen Sprachen: Engl. squall ist unsicherer Herkunft, geht aber nicht auf lat. squalus »schmutzig, rau« zurück, sondern weist mit squaller »Schreihals« wohl eher auf »Tosen, Lärmen« hin. Französ. grain »Bö«, »Korn«, wohl urspr. in der Bedeutung »kurzer Sturm mit Hagelkörnern«, geht auf lat. granum »Korn« zurück. Span. chubasco beruht auf Entlehnung von port. chuvasco, von chuva »Regen«, das wie span. lluvia auf lat. pluvia »Regen« zurückgeht. Italien. burrasca stammt wie port. borrasca von einer iberische Form von Borea »mittelmeerischer Sturmwind«.
Joachim Nettelbeck, Eine Lebensbeschreibung (1821): »mit einer schweren Buy [Stoßwind], die sich plötzlich erhob, brach der große Mast, 8 oder 10 Fuß überm Deck, gleich einer Rübe, entzwei.«
Albert Berg, Die preußische Expedition nach Ost-Asien (1864): »Am 2. September eine kleine Bö mit Gewitter, in der Ferne einige Wasserhosen.«
Hans Parlow, Die Kaptaube (1902): »Denn dort kamen neue Bänke herangejagt, abermals heulte die Bö, und es schien, als wenn jene jedesmal dichter, und diese immer stärker würde.«
Bodden, der, »flache, unregelmäßig geformte Bucht mit enger Öffnung zum Meer, Strandsee«, namengebend an der Ostsee, auch mit →Brackwasser.
Im 19. Jahrh. aus niederdt. bodeme »flaches Küstengewässer« aufgenommen, zu mittelniederdt. bodden, boddem »Grund«. Dazu mittelhochdt. bodem, althochdt. bodam, altengl. botm, engl. bottom, altnord. botn, dän. bund, schwed. botten »Boden«, zu german. *boþm-, *butma- »Boden, Grund, Wurzel«. Die Familie ist mit lat. fundus, griech. pythmēn »Boden eines Gefäßes, des Meeres« sowie altind. budnáh »Grund, Boden« auf gleichbedeutendes indoeurop. *budhmen-, *bhudhno- zurückzuführen.
Ersch/Gruber, Allgemeine Encyclopaedie (1823): »Bodden, auch wohl: der rügianische Bodden, ist das an 8 Quadratmeilen große Binnenwasser, das den südöstlichen Theil Rügen’s von Pommern trennet … Überhaupt müssen alle größeren Schiffe, die von Greifswald aus befrachtet werden, in der Gegend bei den Landspitzen Thiesow oder Pert durch Leichter ihre volle Ladung erhalten und einnehmen. [Eine Chronik] beweist uns …, daß schon im zwölften Jahrhunderte der Bodden (tractus maris) wenigstens in seiner jetzigen Ausdehnung existierte, und daß nur an den schmalsten Stellen die gegenseitigen Ufer dem Auge [doch wohl: sehr deutlich] sichtbar wurden.«
Boje, die, »Ankertonne, verankerter Schwimmkörper zur Markierung«, als Rettungsboje für über Bord Gegangene frei schwimmend.
Entlehnt aus mittelniederländ. boye »Boje, Fessel«. Herkunft unsicher: wie engl. buoy, französ. bouéé aus altfranzös. buie »Fessel« zu lat. boia »jochartige Halsfessel für Sklaven und Verbrecher« mit dem Ankerseil der Boje als Namengeber, von griech. boeiai »Ochsenlederstreifen«, aus mittelfranzös. bouée »Boje«, altfranzös. *boie, altsächs. *bōkan »Zeichen«, german. *baukna-, altsächs. bōkan, althochdt. bouhhan »Zeichen« wie →Bake, aber die Überlegung bleibt ohne altfranzös. Beleg fragwürdig. Aus niederländ. boei sind span. boya, port. bóia, italien. boia, boa entlehnt.
Boje, bei der Verlegung des atlantischen Kabels 1857/58 benutzt.
Wasserrecht von Wisby (1575): »licht ein Ancker sunder Boyen, unde deith schaden, de yenne dem de Ancker thokumpt, de ys schuldich den schaden tho betalende«, »liegt ein Anker ohne Boje und tut Schaden, ist derjenige, dem der Anker zukommt, schuldig den Schaden zu bezahlen.«
Johann Sommers See- und Land-Reyse (1665): »scheinet ein Boey (ist das Holtz am Ancker, so auff dem Wasser schwimmt) zu seyn, mitten in der wilden spanischen See.«
Joachim Heinrich Campe, Sammlung interessanter Reisebeschreibungen für die Jugend (1788): »so musste Cook alle Nacht in einem Boote mit einigen Leuten den Fluss hinauf rudern, und überall Boyen zu Wegweisern für die Flotte legen.«
→dippen (1898), →Grund (1907)
Boot, das, »kleineres Wasserfahrzeug«, Sammelbezeichnung in Abgrenzung zum Schiff, in der Kriegsmarine auch für größere Einheiten (z. B. U-, Torpedoboot).
Im 15. Jahrh. aus mittelniederdt. bōt, -länd. boot entlehnt, zu mittelengl. bōt, altengl. bāt, engl. boat und altnord. bátr, norw. baat, schwed. båt, dän. baad; entlehnt ist finn. paatti. Unsicher ist, ob die Stammform altengl. oder altnord. ist, und ob german. *baito- oder *beto- »ausgehöhlter Baumstamm« zugrunde liegt, zu indoeurop. *bheid- »spalten« oder *bhedh- »stechen«. Unklar ist ferner die genaue Verwandtschaft mit altnord. beit »Schiff, gespaltener Einbaum«, aber dies wohl zu altnord. bíta »beißen, spalten«. Aus mittelniederländ. beitel »kleines Boot, Bötlein« oder aus anglonormann. bat, latinisiert battus, mit der lat. Verkleinerung -ellus entstanden mittelfranzös. batel, französ. bateau und italien. batello »Boot«.
Jürgen Andersen, Orientalische Reise-Beschreibungen (1669): »wobey wir diß grosse Unglück hatten, daß unser Both, welches mit etlichen Leuten, umb Wasser zu holen, außgefahren, vom Schiffe, in dem es der Steuermann in si hefftigen huy wenden wolten umbsegelte und 3 Personen ersoffen.«
F. M., Neu entdecktes Norden (1727): »was aber den Wein anbelangte, so war von solchen sehr viel vorhanden, daß also jeder Bot so viel nehmen durffte, als sie zu führen sich getrauten.«
Otto von Kotzebue, Entdeckungs-Reise in die Süd-See und nach der Berings-Straße (1821): »Heute erhielt ich das Lebens-Boot (life boat), welches von der englischen Regierung für den Rurick bestellt war.«
→Davit (1373), →Jolle (1678), →Elmsfeuer (1726), →dwars (1897)