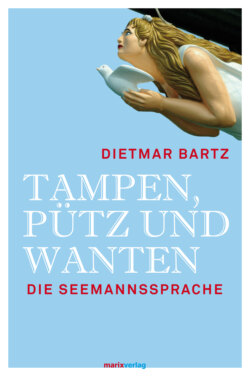Читать книгу Tampen, Pütz und Wanten - Dietmar Bartz - Страница 8
ОглавлениеVorwort zur 1. Auflage
»und wie das sonst Nahmen haben mag«
(aus einer Quelle von 1617 zum Stichwort →Havarie)
Obwohl Sprachforscher seit 150 Jahren die Geschichte der Wörter untersuchen und darüber ein enormes Wissen zusammengetragen haben, streiten sie bis heute über die Herkunft vieler Begriffe. Die maritimen Fachausdrücke bilden keine Ausnahme. Wer die etymologischen Standardwerke vergleicht, wird auf erstaunliche viele unterschiedliche Erklärungen stoßen, woher »Brackwasser« und »Reuse« stammen, »Pier« und »Heck«, »Dalbe« und »Pütz«.
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten schien dies weiter niemanden zu stören, denn die Sprache der Seeleute galt als aussterbend. Längst war die Zeit der Großsegler mit ihren zahllosen Spezialwörtern vorbei. Technisches Englisch hielt Einzug in die Kommunikation auf See. Und an Bord wie in den Häfen wurden immer weniger Menschen gebraucht, die für ihre Arbeit auf ein Fachvokabular angewiesen waren. Kein Wunder, dass das letzte große einschlägige Wörterbuch mit etymologischen Erklärungen, Friedrich Kluges Seemannssprache, im Jahre 1911 erschien.
Aber diese Fachsprache ist nicht ausgestorben. Gerettet hat sie die seit vierzig Jahren anhaltende Begeisterung für den Wassersport. Vor allem die Freizeitsegler haben viel für den Erhalt seltener Wörter getan. Zudem wächst der Welthandel mit der Globalisierung; damit nimmt auch die Bedeutung der Hafenwirtschaft wieder zu. Schließlich steigt auch das Interesse an den Ozeanen, was vor allem den Umweltschützern und Marinebiologen zu verdanken ist.
Seemannssprache ist also keine Berufssprache mehr, sondern stellt heute ein Konglomerat dar, aus dem sich Seeleute und Marinesoldaten, Wassersportler und Bootsverkäufer, Hightech-Designer und Regatta-Besucher nach Gutdünken bedienen. Die Wörterbuch-Forscherin Undine Kramer hat darauf hingewiesen, dass es den Seemann als prototypischen Träger der Seemannssprache möglicherweise nicht einmal im Mittelalter, in der Anfangsphase ihres Bestehens, gegeben hat. Heutzutage ist sie eine lebendige Gruppensprache – für die im Übrigen eine weniger berufsorientierte und auch geschlechtsneutrale Bezeichnung angemessen wäre. Aber wie sollte sie lauten?
So erscheint – unter dem eingeführten Titel – nun zum ersten Mal seit fast hundert Jahren wieder ein ausführliches maritimes etymologisches Wörterbuch. Friedrich Kluge konzentrierte sich in seiner monumentalen Seemannssprache auf ein möglichst vollständiges Vokabular aus Seefahrt und Schiffbau seiner Zeit. Für das vorliegende Buch sind daraus die Stichwörter ausgewählt, die in der deutschen Umgangssprache und im Segelsport auch heute noch gebräuchlich sind. Hinzu kommen moderne Bezeichnungen von der »Genua« bis zum »Surfen« und vom »Radar« bis zum »Trimaran«. Zusätzlich sind Begriffe aus Topographie und Klimakunde aufgenommen – und rund 70 Namen bekannter Meeresbewohner vom »Aal« bis zum »Wal«. Viele neue Erkenntnisse der Wortforschung mussten eingearbeitet und irrige Ableitungen korrigiert werden.
Für ihre Hilfe bin ich zwei Experten zu besonderem Dank verpflichtet. Der Meeresbiologe Dr. Frank J. Jochem, Assistant Professor an der Florida International University in Miami (USA), hat die Stichwörter zu Biologie und Klimakunde geprüft. Dr. Anne Breitbarth, Linguistin an der Universität Cambridge, hat die sprachwissenschaftlichen Angaben durchgesehen.
Trotz aller Bemühungen lassen sich in einem Nachschlagewerk Fehler nicht vermeiden. Ebenso mag es Klagen darüber geben, dass Stichwörter fehlen oder unvollständig behandelt sind. Hinweise auf Korrekturbedürftiges und Anregungen nehme ich gern über die E-Mail-Adresse expertensprechen@gmx.net entgegen.
Vorwort zur 2. Auflage
Die erfreulich positive Resonanz unter den maritim Interessierten hat dazu geführt, dass in weniger als einem Jahr eine neue Auflage der Seemannssprache möglich wurde. Den Zuschriften von Leserinnen und Lesern ist zu verdanken, dass Fehler korrigiert und Erklärungen verbessert werden konnten. Für Hinweise ist der Autor auch weiterhin dankbar.
Vorwort zur 3. Auflage
Die neue Auflage der Seemannssprache hat an Umfang deutlich zugenommen. Der Anhang enthält nun einen ausführlichen Beitrag über die bekannte maritime Anrufung ahoi, mit ihren Wurzeln in der Seefahrts-, Technik-, Literatur- und politischen Geschichte. Verbunden ist dies mit der Schilderung, wie eine kleine Unaufmerksamkeit die jahrelange Beschäftigung mit diesem Wörtchen ausgelöst hat. Und dass – entgegen allgemeiner Ansicht – das Internet Fehler auch vergessen kann.
Dietmar Bartz