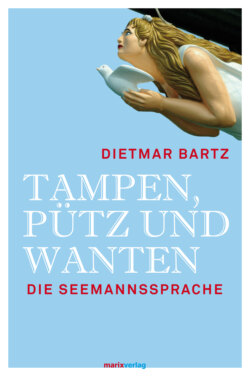Читать книгу Tampen, Pütz und Wanten - Dietmar Bartz - Страница 17
ОглавлениеBootsmann, der, »auf Handelsschiffen der für den Decksbereich verantwortliche Unteroffizier«, »Meister im Lehrberuf des Matrosen«, »in der Kriegsmarine ein Unteroffizier in einem Feldwebel-Rang« (auch Ober-, Hauptbootsmann), »bezahlte Kraft für die Pflege einer Yacht«, »die von Seeleuten so genannte Möwe Phaeton aethereus«.
Niederdt. bōsman, bōßman, niederländ. bootsman »Matrose«, Plural -luden »Bootsleute«, seit dem 14. Jahrh. belegt.
Hansisches Urkundenbuch (Quelle von 1456): »Johan Petersson sturman, Dirigk Floriansson hovetboszman und 7 Schiffskinder.«
Johann Hübner, Reales Staats-, Zeitungs- und Conversations-Lexicon (1720): »Bossemann, Schiffsbediensteter, welcher die Ankerseile verwahrt und Anordnung macht, wenn die Anker geworfen oder aufgehoben werden sollen.«
Johann Friedrich Schütze, Holsteinisches Idiotikon (1802): »Bootsmann ist der Matrose auf Schiffen, der die Oberaufsicht über die Takelage, Segel und Mastwerke hat.«
→Maat (1485/86), →Bai (1627), →Tau (1730)
Bord, das, »Decks- und Seitenplanken eines Schiffs, Bootsrand«, übertragen »das Schiff schlechthin«.
In dieser und ähnlichen Formen in zahlreichen europ. Sprachen. Herkunft umstritten; unklar ist, ob die Bedeutungen »Schiffsrand« und »Brett« auf ein gemeinsames german. *borda- »Brett« zurückgehen oder Bord »Schiffsrand« im Sinne von »Kante, Einfassung« auf german. *bar-, *bur-, *br- »Hervorstehendes, Spitzes«, althochdt. brort »Rand, Kante, Schiffsbug«, altengl. brord »Stachel, Spitze, Keim« zurückgeht. Beides kann in indoeurop. *bher- »mit spitzem Werkzeug bearbeiten, schneiden« wurzeln. Die Redewendung über Bord ist seit dem 14., an Bord seit dem 15. Jahrh. belegt. Verwandt mit Bordstein, Bordell, bohren, Bordure, engl. border »Grenze«. →Backbord, →Steuerbord
Ostfriesische Urkunde (1457): ein »schepe van vyff borden grot«, ein »fünf Plankenreihen über Wasser hohes Schiff.«
Johann David Wunderer, Reyße in Moskau (1590, gedr. 1812): »Soll niemandt Rumor oder aufruhr binnen dem Schiffs bortt anrichten, bei straff gewonlichem Seerecht, das ist unter den Keyl [Kiel] durch.«
Paul Gerhard Heims, Von der Wasserkante (1897): »Und wie sie nachher, in einer bösen Sturmnacht, auf die Klippen lief und aufbrach, da sagte er ruhig: Ja, Mariechen, nun ist’s zu Ende mit uns! und ging mit dem Hauptmast von Bord.«
→bergen (1720), →Brecher (1890), Hackebord →achtern (1794/96)
Bott, der, »freies Tau«.
Niederdt. bott »Raum, Platz«, boten »wegschaffen, vertreiben«, niederländ. bot »Ende eines Taus«, »Ende (als Tau)«, auch »Abgeschlagenes, stumpfer Mensch«, mittelniederländ. boten »schlagen«, gleichbedeut. altengl. beatan, engl. to beat, ist entlehnt aus französ. bout, älter bot »Ende, Spitze«, bouter »legen, stecken«. Mit althochdt. bōzen »stoßen«, norddt. bōsseln »kegeln« zurückzuführen auf german. *bautan »stoßen«. Die Bedeutungsgeschichte ist noch nicht vollständig geklärt. Wohl verwandt mit →Butt.
Heinrich Brarens, System der praktischen Steuermannskunde (1807): »in Hinsicht des Aushaltens der Anker und Tauen lasse der Schiffsführer, wenn Wind und See sich erhebt, bei Zeiten Bott stechen: denn je entfernter der Anker vom Schiffe steht, desto sicherer liegt das Schiff.«
Eduard Bobrik, Allgemeines nautisches Wörterbuch (1850): Bott »Länge oder Vorrat eines Strickes, damit man nachgeben oder fieren kann.«
Brackwasser, das, »Gemisch aus Süß- und Salzwasser« in Flussmündungen, auch in Küstenzonen mit geringem Wasseraustausch.
Entlehnung aus dem Niederländischen in verschiedenen Formen: adjektivisch »brack Wasser« (→Wasser), hochdt. seit dem 17. Jahrh. belegt, von brak water sowie als Kompositum Brackwasser über niederdt. Brac(c) water aus brakwater, zu mittelniederländ. brac, -dt. brack »salzig, brackig«. Herkunft umstritten: als »scharf, schneidend« zu indoeurop. *bher- »mit scharfem Werkzeug behandeln«, dann verwandt mit →Bord, mit griech. brágos »Flussaue«, brochē´ »Regen, Bewässerung« zu indoeurop. *mrog- »faulig, abgestanden«, dann verwandt mit morsch, mit mittelniederländ. brak »wertlos« zur Familie von →Wrack.
Adam Olearius, Beschreibung Der Newen Orientalischen Reise / So durch Gelegenheit einer Holsteinischen Delegation an den König in Persien ist geschehen (1647): »da freilich das Wasser wegen der sehr vielen einfallenden Rivieren und Strömen süsse oder Brack ist, aber nach der Höhe zu ist es so saltzig, als es im Oceano seyn mag.«
Jürgen Andersen, Orientalische Reise-Beschreibungen (1669): »Wir warffen Anker, und liessen etliche unser [Schiffs-]Völcker in dem Flusse Semek, welcher zur rechten Hand des Bay und brack Wasser führet, fischen.«
Joachim Nettelbeck, Eine Lebensbeschreibung (1821): »sey es, daß hier ein absichtlicher Betrug vorgegangen, oder daß sie, aus Bequemlichkeit, aus dem ersten dem nächsten Brunnen mit Brackwasser geschöpft.«
Bram, die, »Verlängerung des Mastes über der Marsstenge, Bramstenge«, zugehörig das Bramsegel »Segel über dem Marssegel«, auch selbst als Bram bezeichnet, älter Brandsegel.
Entlehnung aus niederländ. bram, verkürzt von bramzeil »Bramsegel«. Herkunft unsicher: zu niederländ. brammen »prahlen, prunken« als »Prunksegel«, zu altnord. brandr »Stock, Pfosten« als brandseil »Brandsegel«, allerdings mit erster Nennung 1625 etwas später als braemseyl (1597) belegt. Dazu schwed., dän. brand »Balken«, zu indoeurop. *bher- »schneiden«, dann verwandt mit →Brackwasser und →Bord. Das Segel selbst ist Ende des 16. Jahrh. aufgekommen.
Johann Georg Aldenburgk, West-Indianische Reiße (1627): »Anno Christi 1625 mense [Monats] Januario lag ein wolbesegelt Schiff, mit Namen die zwölff Apostel, welches von der Admiralitet dazu verordnet, vir der Bahje auff Sentinella sampt einer Schloupen, daß wo fern was vermercket würde, dasselbe ein Stück lösen, vnd eine Flacke ober den grossen Brandsegel auffziehen solte, es were gleich von Freund oder Feind.«
George Forster, Reise um die Welt (1778): »Nachmittags fuhren wir bei einer anderen viereckigen, ungeheuren Eismasse vorbei, die ungefährt 2000 Fuß lang, 400 breit, wenigstens noch einmal so hoch als unser höchster mittlerer Braammast, das ist ungefähr 200 Fuß hoch war.«
Lebensgeschichte des Capitain Carl Wolfgang Petersen (1880): »Wegen der schiefen Lage des Schiffes … mußte ich mehr nach der Luvnovk der Bramraae klettern als hinausgehen.«
Brander, der, »mit entzündlichen Stoffen beladenes brennendes Schiff, um feindliche Schiffe durch Funkenflug oder Rammen in Brand zu stecken«.
Übernahme des 18. Jahrh. aus gleichbedeut. niederländ. brander, brandschip, einer bereits im 16. Jahrh. verbreiteten Seekriegstechnik, mit dt. Brand auf german. *branda- zurückgehend, dies zu german. *brenn-a- »brennen«. Als Zeitzünder konnte eine →Beuling eingesetzt werden.
Johann Georg Aldenburgk, West-Indianische Reiße (1627): »die Soldaten musten Tag vnd Nacht schantzen vnd wercken, vnsere Schiff wurden all vnter wall, so weit man kundte, deßgleichen auch die Brandschiffe … buxiret.«
C. E. S., Das verwarloste Formosa (1677): »drey oder vier mal hängten sich auch einige Chineesische Joncken [Dschunken], als Brander ausgerüstet, am Borte an.«
August Ludwig von Schloezer, Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts (1780): »mit einer Flotte von 113 Kriegs-Schiffen, 11 Brand-Schiffen, und 7 Jachten.«
→kappen (1627)
Brandung, die, »Zone überstürzender Wellen an der Küste«.
Mit dem älteren dt. Brennung wie schwed. bränning, norw. brenning zurückzuführen auf niederländ. branding zu branden »brennen, aufschäumen, anbranden«. Das Wort entstand aus mittelniederländ. brant und der Vergangenheitsform brandde »brannte« zu bernen, barnen »brennen«. In der Bedeutung analog lat. aestus »Hitze, Glut, Brandung« und aestuare »kochen, wallen, schäumen«.
Peter van der Horst, Beschriving Van der Kunst der Seefahrt (1673): »Wie auch ein Mahls auff der Küst von Africa, nebenst Mamora, da wir bald in die Branding wahren, gab Gott daß der Wind sich legte.«
Daniel Defoe, Robinson Crusoe, übersetzt von Ludwig Friedrich Vischer (1720): »Als ich meine Augen auff das zerscheiterte Schiff richtete gieng die Brandung und der Schaum des Meers so dick und hoch darüber her, daß ichs … kaum sehen konte.«
Jens Jacob Eschels, Lebensbeschreibung eines alten Seemanns (1835): »Es war ein schrecklicher Anblick, denn das Schiff segelte nur eben längs der Brandings.«
Brasse, die, »Tau zum Schwenken der Rahen«.
Aus niederländ. bras, wie engl. brace, brase »ein paar Arme, Halterung, Brasse« zu gleichbedeutend französ. bras und bras de vergue »Arm der Rah«. Es ist übernommen aus brasser, altfranzös. braçoyer, bracier »brassen«, wörtl. »die Arme handhaben«, zu lat. bracchium »Arm«, griech. brakhion »Arm, Pfote«, brakhus »kurz«. Verwandt: Brachialgewalt. Das alte französ. Längenmaß Brasse »Entfernung zwischen den Händen bei ausgestreckten Armen« konnte dem →Faden entsprechen. Meist wich es aber davon ab; die Brasse (zu fünf Fuß) hatte offiziell 1,624 Meter, der engl. Faden (zu sechs Fuß) 1,8288 Meter. Verwandt mit →Barkun.
Ernst Christoph Barchewitz, Ost-Indianische Reise-Beschreibung (1730): »der Schiffer gab gleich ordre, das Ruder an Stürbort zu legen, uns aber hieß er geschwind zu prassen an Stürbort, das ist, die Segel herum zu wenden.«
Friedrich Kries (Übersetzer), William Scoresby’s des Jüngern Tagebuch einer Reise auf den Wallfischfang (1825): »Das Ganze endigte dann mit einem ordnungsgemäßigem Gesange, in den die ganze Mannschaft einstimmte, worauf die nach einem dreymaligen Hurrah auseinander giengen, um auf die Aufforderung des Oberbootsmannes die großen Brassen zu splissen.«
Brecher, der, »hohe, sich überstürzende See, Sturzsee«.
Im 19. Jahrh. Brechsee ersetzend, entlehnt aus engl. breaker, zu to break »brechen« aus indoeurop. *bhreg- »brechen«.
Brecher an einer Klippe, Stich vor 1900.
Increase Mather, An essay for the recording of illustrious providences (1684): »If the Providence of God had not by the breakers given them timely warning they had been dashed to pieces«, »wenn die Vorsehung Gottes sie nicht durch die Brecher zeitig gewarnt hätte, wären sie in Stücke zerhauen worden.«
Jens Jacob Eschels, Lebensbeschreibung eines alten Seemanns (1835): »wir lensten vor das dichtgerefte Grossmarssegel und Fock, und erhielten eine schwere Brechsee von hinten über, die wohl zwölf Fuss hoch über das Heck hereinstürzte und aufs Cajüt-Deck niederschlug.«
Paul Gerhard Heims, Im Rauschen der Wogen, im Branden der Flut (1890): »der Kommandant der Vandalia wurde, ehe das Schiff unterging, mit vier Offizieren von der Kommandobrücke durch einen schweren Brecher über Bord gespült.«
→Mole (1716, 1909)
Brigantine, die, »zweimastiges Segelschiff«, Kurzform Brigg.
Brigg ist zu Beginn des 18. Jahrh. im Engl. als Abkürzung von brigantine entstanden und Ende des 18. Jahrh. ins Deutsche übernommen worden, auch niederländ. brik, französ. brick, in skandinavischen Sprachen brig(g), italien. brick. Engl. brigantine ist wie französ. brigantine, brigandin entlehnt aus italien. brigantino, mittellat. brigantinus »Kampf-, Raubschiff«, zunächst ein niedrigbordiges, mit Riemen und Segel ausgestattetes kleineres, wendiges Schiff, zu italien. brigante »Räuber, Brigant«, dies zu briga »Unruhe, Streit«. Dessen Herkunft ist unklar, frühester Beleg Ende des 13. Jahrh. in Venedig, vielleicht zu kelt. brīga »Kraft«. Verwandt mit Brigade.
Brigg, als Wort etwa zur Zeit dieses Stichs (um 1790) ins Deutsche entlehnt.
Otto Heinrich, Deutsche Pilgerreisen (1521): »doch jaget die galeen unddt ein Bregantin ab den Türckischen armatis«.
Die Reisen des Samuel Kiechel (um 1600): »Hüeromben sich sommerszeütt vül cursari [Korsaren] hallten, so mütt fusti [Einmaster], galiotten, frigatia, unnd pergatin aus Barbaria herüber kommen«.
Kaspar von Stieler, Zeitungs Lust und Nutz (1695): »Brigantin, ist ein Spähschiff und Raubschiff / so geschwind durch die Wellen streichen kan«.
Leo Goldammer, Litthauen: Erzählungen aus dem Natur- und Volksleben (1858): »Eine Brigg mit Rahsegel und Briggsegel, und außerdem zehn Kanonen darauf«.
Brise, die, »gleichmäßiger Wind«.
In romanischen und germanischen Sprachen verbreitet, engl. breeze, dän. brise, schwed., norw. bris, niederländ. bries, französ. brise, span., port. brisa, oberitalien. brisa »Nordostwind«, katalan. brisa »Schneewind«, frühe Nennung im 15. Jahrh.; vielleicht auch mittelhochdt. bīse, althochdt. bīsa, altsächs. biosa, schweiz. Bise, Beiswind »schneidend kalter Nord- oder Ostwind«; die Verbindung zu beißen ist volksetymologisch. Die europäischen Entlehnungsverhältnisse sind unklar, vielleicht aus dem iberischen Raum über England nach Deutschland und Skandinavien, oder aus Friesland mit Übernahme ins Französische, dann ins Iberische und Englische. Vom Nordostpassat ausgehend, scheinen englische Karibikfahrer die Bedeutung »stetig wehend« verbreitet zu haben.
Josua Maaler. Die Teütsch Spraach (1561): »Der Byßwind. Bewegt das meer.«
Joseph Stöcklein, Der Neue Welt-Bott (1726): »die philippinischen Schiff kauffen allda insgemein im Decembri oder Jenner ein, und segelen im Mertzen wieder fort, sonst würde es ihnen zwischen America und denen Marianischen Eylanden an denen Brisen oder nach-brausenden Winden fehlen.«
Albert Berg, Die preußische Expedition nach Ost-Asien (1864): »das majestätische Schiff legte sich unter einer Last von Segeln in die Brise und glitt ohne Schwankung über die purpurblaue Fläche«.
→Doldrums (1873), Etmal (1873)
Brücke, die, »Deckshaus als Leitstand des Schiffes« (seit 19. Jahrh.).
Zunächst war die Brücke ein »Kommandosteg auf dem Oberdeck«, in nautischer Bedeutung waren zuerst die Landungs-, Anleger- und Enterbrücken von Bedeutung. Die meisten Großsegler ließen Decksaufbauten, auf denen der Kapitän sich hätte aufhalten können, konstruktionsbedingt nicht zu. Mittelhochdt. brücke, althochdt. brugga, altsächs. bruggia, altengl. brycg, engl. bridge »Brücke«, niederländ. brug, altnord. bru, schwed., dän. bro. Als erweiterte Form hat schon altnord. bryggja auch die Bedeutung »Landesteg«. Herkunft umstritten; mit german. *brugjo- »Brücke«, altkirchenslaw. brivino »Balken« und gall. brīva »Brücke« zu einem vorgerman. *bhru-ko- »Prügel, Knüppel«, Brücke als Knüppeldamm verstanden, mit german. *brōwō- »Brücke« ohne slaw. Verwandtschaft, und zu indoeurop. *bhreu-, *bhru- »Balken, Prügel«.
Claude Jordan, Der Curieusen und historischen Reisen durch Europa … übersetzt von Talandern (= August Bohse, 1699): »Als das Feuer alles fassete, ware ich auf der Brücke meines Schiffes gantz vorne an, allwo ich Ordren der Nothdurfft nach ertheilete.«
Albert Berg, Die preußische Expedition nach Ost-Asien (1864): »Hier ist zu beiden Seiten eine trittartige Erhöhung an der Railing eingebracht, von wo der Commandirende das Schiff übersehen und die Steuerleute anweisen kann; auf anderen Schiffen führt eine schmale Brücke querüber von Railing zu Railing, die Commandobrücke, von wo bei Dampfern ein Sprachrohr in die Maschine hinabführt.«
Paul Gerhard Heims, Von der Wasserkante (1897): »Hier, am Oberdeck, hat das Ruder, an dem bei schlechtem Wetter sechs oder acht Mann stehen, Platz gefunden, meist in unmittelbarer Nähe der Kommandobrücke, des unbetretbaren Heiligtums.«
Bucht, die, nautisch »Küsteneinschnitt«, »Biegung, Schleife, Windung in einem Tau«, »Wölbung des Decks«.
Hochdt. als »Meerbusen« belegt seit dem 17. Jahrh., aus mittelniederdt. bucht »Biegung, Krümmung, Verschlag, Pferch«, wie altengl. byht »Winkel, Ecke«, engl. bight, älter bought »Bucht«, niederländ. bocht, dän. bugt. Zugrunde liegt mit germ. *buhti ein sog. ti-Abstraktum zu biegen. Dies geht mit althochdt. biogan, got. buigan, altengl., altsächs. būgan »biegen« zurück auf german. *bjuga, *buga und mit altind. bhujáti »biegt, krümmt«, lat. fugere, griech. pheugein »fliehen, sich abwenden« auf indoeurop. *bheug(h)- »biegen«. →Bai
In geografischer Bedeutung bei Jürgen Andersen, Orientalische Reise-Beschreibungen (1669): »sahen folgenden Tag in einem Inwig oder Bucht vor uns liegen die treffliche Kauffhandel Stadt Columbo.« Olfert Dapper, Gedenkwürdige Verrichtung der Niederländischen Ost-indischen Gesellschaft in dem Kaiserreich Taising oder Sina [China], durch ihre Zweyte Gesandtschaft (1675): »er möchte sich alda nach guhten Häfen und Seebuchten umsehen, darinnen im nothfalle die Schiffe sicher könten liegen.«
In Bedeutung bei Der geöffnete See-Hafen (1702): »alsdann wird das grosse Wand auf jede Seite aufgesetzet, da dann jegliches Haupt-Touw nach seiner Länge gedoppelt abgepasset, und oben mit einer Boucht über den Top des Masts geleget … die Boucht dieses Touwes wird nun um das oberste Ende der grossen Stenge durch ein ander Touw fest gebunden.«
Über den Schiffbau, in Bedeutung , bei Franz Reuleaux, Der Weltverkehr und seine Mittel (1892): »Die Oberfläche der Deckbalken ist nicht eben, sondern hat eine bestimmte Kurve, Bucht oder Sprung, damit das Deck rundlich liegt und das Wasser leichter von ihm abläuft.«
Buddel, die, auch der, niederdt. »Flasche«.
Im 17. Jahrh. begann der Handel mit Weinflaschen aus Frankreich, die die bis dahin üblichen Fässer und Lederbeutel ersetzten. Niederdt. buddel wie engl. bottle, italien. bottiglia, span. botella waren entlehnt aus französ. bouteille, altfranz. botele, dies aus mittellat. *buticula, butella, verkleinernd zu lat. buttis »Fass«. Die Entlehnungsrichtung zu gleichbedeutendem griech. but(t)is ist ungeklärt, ebenso die Herkunft beider Begriffe. Verwandt sind dt. Bottich, Böttcher, Bütt. Nicht verwandt ist Beutel, althochdt. butil; dies gehört wie Beule zu indoeurop. *bu-, *beu- »aufblasen, schwellen«. Als Bezeichnung für den gläsernen Behälter überwiegt im Deutschen Flasche, althochdt. flasca; es gehört entweder im Sinne von »Ton- oder Holzbehälter mit Schutzgeflecht«, german. *flahskō-, zu german. *fleht-a »flechten, oder , weil Flaschen ursprüngl. aus Holz gedrechselt wurden, und mit guter Erklärung für Flaschenzug wegen der →Scheibe, zu hochdt. flach, althochdt. flah, ähnlich altsächs. flaca »Fußsohle«. Buddelschiffe, in Flaschen aufgestellte Segelschiffe, die von Seeleuten zum Zeitvertreib oder als Nebenerwerb hergestellt wurden, gehen auf mittelalterliche Votiv-Flaschen mit religiösen Motiven zurück, die in Süddeutschland, Österreich und Böhmen verbreitet waren. Die ältesten Buddelschiffe aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts waren wohl Arbeiten gewerblicher Schiffsmodellbauer, etwa das älteste datierte (Holstentormuseum Lübeck, 1784). Matrosen begannen Buddelschiffe ab etwa 1850 zu bauen, weil neben grünlichem oder bräunlichem Flaschenglas mehr und mehr farbloses Material verarbeitet wurde.
Johann Heinrich Zedler, Universal-Lexikon (1733): »Bouteille, so wird eine iede gläserne Flasche genennet, die unten einen weiten Bauch hat, der sich oben her nach einem engen Halse zu einziehet, und siehet man deen zu mancherley Gebrauch unterschiedene Arten.«
Symbolisch bei Siegfried Lenz, Arnes Nachlaß (1999): »Ohne den Blick zu heben, ohne ein Zeichen von Überraschung oder der Freude nahm er zur Kenntnis, daß das Buddelschiff ihm gehören sollte … Er übersah es, vergaß es.«
Bug, der, »vorderster Teil eines Schiffes«.
Als ursprüngl. »Schulterstück von Pferd und Rind«, auch »menschliche Schulter, Arm«, im 17. Jahrh. auf die entsprechende Partie des Schiffs übertragen. Mittelhochdt. buoc, althochdt. buog, als »Schulter« und »Schiffsbug« auch in niederdt. būg, -länd. boeg, altnord. bógr, isländ. bōgur, dän. bov, schwed. bog. Engl. wurde zuerst bough »Schulter, Oberarm« gebildet, später bow »Bug«. Mit german. *bōgu-, griech. pēchys »Ellbogen, Unterarm« und altind. bāhúh »Arm« vielleicht auf indoeurop. *bhāghus »Ellbogen, Unterarm« zurückzuführen. Unsicher ist, ob mit einer Urform »das Ausgestreckte« oder im Sinne von »das Beugbare« auch »das Gebogene« gemeint sein kann; dann mit →Bucht verwandt. Die romanischen Bezeichnungen für Bug, französ. proue, span., port. proa, italien. prora, prua, aber auch engl. prow, gehen auf lat. und griech. prora »Schiffsvorderteil« zurück; dies zu lat. pri- »vor, für« wie prior »der vordere (von zweien)«, mit griech. pro »für« und altind. purva »der Erste«.
Johann Georg Aldenburgk, West-Indianische Reiße (1627): »Weil sich der Admiral in den nachgehenden Monat befurchte wegen deß monsons, in welchen der Wind fort vnd fort über einen Bug wehet, gab er den andern Schiffern mit groben geschütz das Zeichen die Ancker auffzuheben.«
Jens Jacob Eschels, Lebensbeschreibung eines alten Seemanns (1835): »dieses Schiff hatte am Pfingsttage den Boog eingesegelt im Eise.«
Carl Reinhardt, Der 5. Mai, ein Lebensbild von der Unterelbe (1888): »Die Kälte nahm bald so überhand, daß junges Eis mit der Ebbe und Fluth auf und ab trieb … weshalb die aufkommenden Fahrzeuge ihren Bug mit starken Brettern benagelten.«
→Back (1887), Buganker →Anker (1794)
Schiffsbug mit dem Tauwerk von Bugspriet und Klüverbaum, um 1790.
bugsieren, »ein Schiff schleppen, lotsen, lenken, um es an einen bestimmten Ort zu bringen«.
Im 17. Jahrh. entlehnt aus niederländ. boegseeren, boegsjaren, boucheren, dies nicht von boeg »Bug«, sondern von port. puxar »ziehen, zerren«, das aus lat. pulsare »stoßen« und pellere »schlagen« stammt. Die Vorstellung vom Bug als Teil des Schiffes, an dem gezogen oder das geschoben wird, hat die sprachliche Entwicklung beeinflusst. Bezeichnungen in anderen Sprachen, siehe →Schlepper.
Erster dt. Beleg bei Johann Georg Aldenburgk, West-Indianische Reiße (1627): »Als das Meer wider begundte zu zu lauffen, buxireten wir vnsern Rennboot so lang, biß er auß dieser enge hinauß kame.«
Friderich Martens, Spitzbergische oder Groenlandische Reise-Beschreibung (1675): »wir riemeten mit den Schlupen vor dem grossen Schiffe (welches Büksieren genennet wird) ferner in das Eiß.«
Otto von Kotzebue, Neue Reise um die Welt (1830): »Die Anker mussten darauf gleich gelichtet werden, und die japanischen Böte buchsirten das Schiff in die See, nachdem es kaum zwölf Stunden in der Bucht gewesen war.«
Bugspriet, auch Spriet, das, »Stange über den Vorsteven hinaus, um das Sprietsegel auszuspannen«.
Hochdt. seit dem 18. Jahrh., von mittelniederdt. baghspreht, bochspret, niederländ. boegspriet, engl. bowsprit, schwed. bogsprött, dän. bugspryd; französ. beaupré, mittelfranzös. bosprete ist eine Entlehnung aus dem Englischen. Zum ersten Wortteil →Bug. Spriet »Stange«, mittelniederdt. sprēt, -länd. spriet »Segelstange«, altengl. sprēot, engl. sprit, geht wohl im Sinne von »über das Schiff hinausragendes, -sprießendes Rundholz« zurück auf sprießen, niederländ. spruiten, engl. to sprout. Die german. Form *spreut-, *sprūt- »spritzen« geht mit griech. speirein »säen« auf indoeurop. *spher- »streuen, säen« zurück.
Johann Georg Aldenburgk, West-Indianische Reiße (1627): »Ingleichen daß alle die Schiffer ihre Schiff zum fechten vnd schlagen rüsten … auff die Buchspriet vnd Masten lange Wimpeln auffhengen.«
Otto Rüdiger, Alexander Selkirk in Hamburg, (1888, Flugschrift von 1713): »der Hertzog that dennoch einen Canon – nebst verschiedenen Musketen-Schüßen, und ließ Licht oben in dem Mast und vorne auff dem Buchspreet hengen, damit das Boot nicht verirren möchte.«
Adelbert von Chamisso, Reise um die Welt mit der Romanzoffischen Entdeckungs-Expedition (1836): »Am 15. setzte sich ein schön rot befiederter Landvogel auf unsern Bugspriet nieder.«
→Steven (1673), →Galion (1864).
Buhne, die, »dammartige Strand- oder Uferbefestigung aus Pfählen, Steinen oder Faschinen, die frei ins Wasser laufen und vor Abspülungen schützen«.
Mittelniederdt. būne »Buhne, Lattenwerk«, niederländ. bun »Flechtwerk, Fischhälter«, Herkunft unklar. Vielleicht verwandt mit Bühne im Sinne von Brettergerüst, niederländ. beun »lose Planken über dem Erdboden, Fischkasten«, altengl. bytme »Kiel« und indoeurop. *bhudhniō »Boden« →Bodden.
Als »Küsten- und Hafenschutz« bei Johann Hinrich Röding, Allgemeines Wörterbuch der Marine (1794/96): »Buhnenmeister, Beamter, der an Orten, wo kein Hafenmeister ist, die Aufsicht über die Buhnen und Bollwerke hat.«
Als »Fischhälter«, heute veraltet, bei Heinrich Smidt, Seemanns-Sagen und Schiffer-Märchen (1849): »bald war das Verdeck mit Fischen aller Art bedeckt; jede Sorte wurde in eine besondere Buhne gethan.«
Seebuhnen vor dem westlichen Baltrum um 1900, mit Baujahren und Tiefenlinien.
Bukanier, der, »Seeräuber der Karibik«.
Entlehnt aus französ. boucanier, zunächst »einer, der Ochsen jagt«, nach frz. boucan »Holzrost, Grill, Räucherhütte«, der französischen Schreibung für das entsprechende Wort in einer nordbrasilianischen Sprache, vielleicht Tupí-Guaraní. Im 16. Jahrh. von Europäern als Bezeichnung für Europäer in der Karibik verbreitet, zuerst für Fleischjäger, die sich dieser Trocken-, Röst- und Brattechnik bedienten, dann auch für französische Büffeljäger in Kanada. Im 17. Jahrh. erfolgt die Übertragung auf Piraten in Küstennähe, weil sie entweder ebenfalls solche Grills benutzten oder ebenso räuberisch auf Beute aus waren wie die Fleischjäger oder weil sich aus boucan »Räucherhütte« die Bedeutung »Spelunke, Ort der Ausschweifung und Gesetzlosigkeit« entwickelte, ein boucanier also als »Gesetzloser, →Filibuster« galt. Im 19. Jahrh. war der Ausdruck allgemein, auch im Mittelmeer, für »Pirat« verbreitet.
Über »boucan« erstmals bei Jean de Léry, Histoire d’un voyage, fait en la terre du Brésil, autrement dite Amerique (1578): »gril sur lequel les Indiens d’Amerique fumaient la viande«, »Grill, auf dem die Indianer Amerikas das Fleisch räucherten«.
Als »Jäger« erstmals bei Jean de Laon, Relation du voyage des François fait au Cap de Nord en Amérique (1654): »boucanier, aventurier qui chassait les boefs sauvage aux Antilles«, »Abenteurer, der die wilden Ochsen auf den Antillen jagte«.
Als »Seeräuber« bei B. E., A new dictionary of the terms ancient and modern of the canting crew (1690): »Buckaneers, West-Indian Pirates«.
Bulge, die, »Welle, Woge«.
Mit gleichbedeut. altnord. bylgja, schwed. bölja, dän. bölge, engl. billow von german. *belgan »schwellen« abstammend, das auf indoeurop. *bhel- »aufblasen, aufschwellen« zurückgeht und mit →Wal sowie →Bilge verwandt ist.
Hans Staden, Warhafftige Historia vnnd beschreibung einer Landtschafft der Wilden, Nacketen, Grimmigen, Menschenfresser Leuthen, in der Newenwelt America gelegen (1556): »da sagten wir inen alle gelegenheit, wie uns der windt und die bulgen zu einem schiffbruch hetten bringen wöllen.«
Anton Hamilton, Drei hüpsche Märlein, übers. v. Wilhelm Christhelf Siegmund Mylius (1777): »sie sahen urplözlich die Bulgen sich bäumen, und da sie zu ertrinken befahrende [bewahrend] das Ufer zu gewinnen suchten, gewahrten sie hinter sich ein Monstrum, dessen gar ungemeine Grösse den Raum füllen thät zwischen den beiden Ufern.«
(in) bulk, »lose, unverpackt, schüttbar«, von Schiffsfracht.
Übernommen aus engl. bulk »Schiffsfracht« (16. Jahrh.), »Gestell für Trockenfisch« (Anfang 17. Jahrh.), »unbestimmte Menge« (17. Jahrh.) und in bulk »lose in Haufen liegend«. Als Bezeichnung für »Massengut« seit dem 18. Jahrh., dt. seit dem 19. Jahrh. belegt. Herkunft unsicher, wohl über mittelengl. bolk »Haufen«, vermischt mit bouk »Bauch«, zu altnord. *bulki »Schiffslast, Gepäck auf dem Verdeck«, isländ. bulki, norw. bulk, bolk »Schiffslast«, schwed. bulk »Knoten«, dän. bulk »Schiffslast, Knoten«. Mit dem Aufkommen der →Tanker im 19. Jahrh. wurde die Handelsbezeichnung petroleum in bulk üblich; die Mengenangabe barrel »Fass« blieb dennoch. Bulk carrier »Massengutfrachter« für Getreide, Kohle, Erz usw. ist seit dem 20. Jahrh. eine international verbreitete Schiffsbezeichnung; engl. to carry »tragen«.
William Falconer, An universal dictionary of the marine (1789): »She is to be laden in-bulk, as with corn, salt etc.«, »sie ist in bulk zu beladen, etwa mit Getreide, Salz usw.«
Als »Haufen Material« bei Heinrich Heine, Memoiren (1854): »Hier ist nun der Bulk!«
Bullauge, das, »rundes Schiffsfenster«.
Im 19. Jahrh. über niederdt. bulloog aus engl. bull’s eye, wörtl. »Ochsenauge« wegen seiner runden Form mit Auswölbung, die mehr Licht ins Rauminnere lässt. Französ. œil de bœuf »Ochsenauge« ist schon seit dem 12. Jahrh. als ovales Reliquiar, seit dem 16. Jahrh. als »rundes Fenster in einer Mauer« belegt. Die engl. Bezeichnung könnte zudem von französ. boule »Kugel, kreisrunde Gestalt« beeinflusst worden sein; dazu auch mittellat. bulla »Blase, Buckel, Siegel, Bulle« zu lat. bulla »(Wasser-)Blase, Buckel, Knopf«.
Früheste nautische Nennung erst bei Henry Barnet Gascoigne, G.’s Path to Naval Fame (1825): »Here a Bulls-eye gives a feeble light«, »Hier gibt ein Bullauge ein schwaches Licht.«
Victor Laverrenz, Auf der Back ist alles wohl! (1896): »August stützte seinen Kopf in die Hand und sah hinaus durch das Bullauge.«
Albert Berg, Die preußische Expedition nach Ost-Asien (1864): »Die Kammern der Officiere und Beamten aber liegen ein Stockwerk tiefer, im Zwischendeck, und haben als Fenster nur ein sogen. Ochsenauge, ein rundes Loch von etwa fünf Zoll Durchmesser, das bei dem geringsten Seegange hermetisch verschlossen werden muß.«
Bunker, der, auf Schiffen »Sammelbehälter für flüssige oder schüttbare Güter«, oft für Schiffsbrennstoff.
Ende des 19. Jahrh. aus engl. bunker »Laderaum für Kohlen auf Dampfschiffen, Kohlenbunker« entlehnt, dies seit Anfang des 19. Jahrh. belegt. Herkunft unklar, wohl zu engl. bunk »Schlafkiste« (18. Jahrh.) und altnord. bunki »Schiffslast«, urspr. »Bretterverschlag, auf dem die Fracht ruht«, norw., schwed. bunke »Schiffslast«, dän. »Haufen«, mittelniederdt. bonk »Ladung, Laderaum«, niederländ. »Klumpen, unbestimmbare Masse«. Die Holzunterlage für die Fracht erlaubt einen Hinweis auf Bühne, →Buhne. Die Verbindung zu Bunker »Schutzraum« kam vielleicht durch die Bedeutung bunker »künstlich gegrabenes Sandloch beim Golf« (seit dem frühen 19. Jahrh.) zustande.
Früher engl. Beleg im Report on steam vessel accidents, House of Commons (1839): »Neither the bunkers nor the coal-hold were cleared out so often as they should be«, »weder die Bunker noch die Kohlenhalte wurde so oft gesäubert, wie sie es sollten.«
Früher dt. Beleg in der Marine-Rundschau (1895): »Kohlengasexplosionen in den Bunkern bezw. Laderäumen der Schiffe«.
Gustav Goedel, Klar Deck überall! Deutsch-Seemännisches (1916): »bunkern hat sich schon so eingebürgert, daß man in Kiel schon bunkern sagt für ›stauen‹ im Sinne von tüchtig bipacken, essen.«
Büse, die, »weitbäuchiges Schiff für den Heringsfang«, ursprünglich ein Lastschiff.
Lehnwort aus niederländ. buis, auch engl. buss, Übernahme aus altfranzös. busse, mittellat. busa, bussa. Die weitere Herkunft ist unklar.
Hansisches Urkundenbuch (Quelle von 1303): »una buss de Wismaria«.
Johann Wilhelm Vogel, Ost-Indianische Reise-Beschreibung (1716): »auch kamen 2 Herings-Büyßen in die Flotte und brachten uns von ihrem Fang die delicatesten neue oder frische Heringe.«
Jens Jacob Eschels, Lebensbeschreibung eines alten Seemanns (1835): »hatte ich ihn in Altona beim Zimmern bei mir an Bord, später hat er mit den Heringsbüysen gefahren.«
Busen, der, geogr. »weite Bucht einer See, Meerbusen«.
Im 17. Jahrh. direkt übersetzt aus lat. sinus maritimus, nach sinus »Krümmung, Rundung, Schwellung«. Wie griech. kolpos (→ Golf) und lat. sinus bezeichnete dt. Busen »das die (weibliche oder männliche) brust zwischen armen und hüften hüllende, sich darum biegende Gewand« (Grimm, Deutsches Wörterbuch, 1860). Busen, althochdt. buosum geht wohl über westgerman. *bōsma auf indoeurop. *b(e)u-, *bheu »aufblasen, schwellen« zurück, nicht über german. *bōg-sma- zu althochdt. buog »Bug, Schulter«. Von Busen »Gewand um den Oberkörper, Hemd« blieb erhalten Buserun »baumwollenes Schiffshemd«, nach fries.-niederländ. būsrūntje wörtl. »Busenrundchen«, zum Überwerfen über den Kopf, bis zu den Hüften reichend, um die Oberbekleidung bei der Arbeit vor Schmutz zu schützen; niederländ. boezeroen, schwed. bussarong, finn. pusero »Bluse«. Verwandt mit →Buster.
Friedrich Schiller, Wilhelm Tell (1804): »Der Sturm ist Meister, Wind und Welle spielen / Ball mit dem Menschen – da ist nah und fern / Kein Busen, der ihm freundlich Schutz gewährte.«
Adolf Schirmer, Lütt Hannes, Ein Seeroman (1868): »Peter Petersen zog seine Buseruntje an, die große Jacke mit den sackartigen Seitentaschen, in denen mehr als ein Pfund Tabak Platz hatte.«
→Knoten (1807)
Buster, der, »Sturm«.
Substantivierung von norddt. pusten »blasen«, das wie dt. (auf-)bauschen, frühneuhochdt. pausen und →Busen auf indoeurop. *b(e)u-, *bheu »aufblasen, schwellen« zurückgeht. Personalisierung: Peter Puster.
Johann Segebarth, De irste Seemannsreis’ (1886): »Peiter Püster mit grot Mul, De sick noch namm tau Hülp den Reg'n«, »Peter Puster mit großem Maul nahm sich noch den Regen zur Hilfe.«
Butt, der, »Angehöriger der Familie der linksäugigen Plattfische, Bothidae«.
Mittelniederdt. but(te), -länd. bot(te), niederländ. bot; daraus entlehnt engl. butt, schwed. butta, dän. botte. Vielleicht ist das Wort abgeleitet aus mittelniederdt., -länd. but, bot »stumpf, stupide«; dies passt zu anderen germanischen Fischbezeichnungen mit solchen Endungen, die »abgestumpft, abgehauen, unansehnlich« bedeuten. Mit ihren zweiten Worthälften sind auch althochdt. agabūz »→Barsch« und vielleicht stark verfremdet steinpeis »Steinbeißer« verwandt. Alles geht mit altnord. butr »abgehauener Klotz«, altengl. bietl »Hammer«, schweiz. butzli »Barsch, unansehnliches Ding«, lat. fustis »Knüppel, Baumstrunk«, refutare »zurückdrängen« letztlich auf indoeurop. *bhau-, *bhu- »schlagen, stoßen« zurück. Der Steinbutt heißt nach den Knochenwarzen seiner Oberseite, der Heilbutt nach dem Brauch, ihn an heiligen Feiertagen zu verzehren, niederländ. heilbot, -dt. heilige butt, norw. heilagfiski, schwed. helgeflundra »heilige Flunder«, dän. helleflynder, engl. halibut. Zur Ordnung der Plattfische gehören auch →Scholle (Goldbutt) und →Flunder.
Steinbutt (Psetta maxima).
Otto Blümcke, Berichte und Akten der hansischen Gesandtschaft nach Moskau im Jahre 1603 (gedr. 1894): »Denn 15. dito für 16 bandt rigische butten auf den wegh, zu 12 Sch. zahltt«, etwa »am 15. desselben Monats für 16 Fass Butten aus Riga, auf den Weg gebracht, je 12 Schillinge gezahlt.«
Paul Fleming, Gedichte (1636): »Für englisches Konfect gib Rigschen Lachs und Butten.«
→Flunder (1716)
Butterland, das, »Land am Horizont, das von niedrigen Wolken oder Nebel vorgetäuscht wird«.
Entlehnt aus gleichbedeut. niederländ. boterland wegen der Zerschmelzung, sobald die Sonne scheint. Im niederländischen Sprachraum lag die Metapher wegen der verbreiteten Milch- und Käsewirtschaft nahe.
Joseph Stöcklein, Der Neue Welt-Bott (1748): »nach aufgehebtem Abend-Tisch liesse sich gähling von der Popa [jählings vom Heck] her eine Reihe gebürgechter Inseln sehen; welches uns sammentlich in Verwunderung zohe; dann niemand auf der See-Charten sehen, noch finden kunte, was in selbiger Gegend für Land seyn müste; viel hätten geschworen, es wäre das, so man sahe, ein warhaftes Land; allein es hatte sich endlich geäusseret, daß es tierra de Manteca (wie die See-Fahrer reden) das ist ein Butter-Land gewesen, so bey heller und heisser Sonne, samt den Wolcken, in denen es bestehet, zu zerschmeltzen pfleget.«