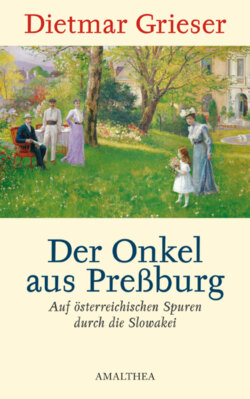Читать книгу Der Onkel aus Preßburg - Dietmar Grieser - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Schachtürke des Herrn von Kempelen
ОглавлениеWer beim Flanieren durch die Preßburger Altstadt, vom Hauptplatz kommend, in die schmale Rybárska brána einbiegt, um zum Theaterplatz zu gelangen, und vor lauter Sehenswürdigkeiten nicht auf seine Schritte achtet, stolpert über zwei Typen, die fest auf dem Straßenpflaster verankert sind. Was den unterschiedlichen Mannsbildern gemeinsam ist: Sie sind beide von Künstlerhand geschaffen, beide aus Erz gegossen und beide örtliche Originale, denen vor allem die Aufmerksamkeit der photographierwütigen Touristen sicher ist.
Der eine, gleich beim Eingang zu der altberühmten Konditorei Mayer postiert, stellt eine Art Nobelsandler dar, der vor den Passanten galant den Zylinder lüftet. Daß ihn die Einheimischen den »schönen Náci« nennen, darf zu keinen Fehlschlüssen verleiten: Sein Name leitet sich von »Ignaz« ab, und hinter diesem Ignaz verbirgt sich ein vormals angesehener Wohlstandsbürger, der in späteren Jahren sein gesamtes Vermögen durchbringt und als Edelschnorrer endet, dessen Spezialität darin besteht, sich von seinen Mitmenschen zu einer Kaffeejause oder auch einem warmen Essen in einem der umliegenden Lokale einladen zu lassen. Da er seinem Tagwerk mit ausgesuchter Höflichkeit nachgeht, genießt er die volle Achtung der Preßburger – sehr im Gegensatz zu dem ruppigen Bettlervolk von heute, das an allen strategischen Punkten der slowakischen Hauptstadt den Bessergestellten auflauert.
Die zweite (und lustigere) der beiden Figuren hört auf den tschechischen Namen Čumil (Gaffer) und lugt aus einem der Kanallöcher der Nebenstraße hervor. Angetan mit einer Phantasiemontur aus Uniform und Helm, stellt er nur Oberkörper und Hände zur Schau; sein süffisantes Grinsen kennzeichnet ihn als abgeklärt-stillen Beobachter der Straßenszene, der zudem den Vorzug genießt, den seinen Weg kreuzenden Passantinnen unter die Röcke blicken zu dürfen. Nichts scheint diesen Trottoir-Philosophen aus der Ruhe bringen zu können – nicht einmal jene rüden Lieferwagenchauffeure, die ihm, wie man hört, schon zwei Mal den Kopf abgefahren haben.
Wem dieses Duo aus Náci und Čumil noch immer nicht genügt, begebe sich auf den Hauptplatz zurück und kehre in dem schönen Art-Déco-Lokal Café Roland ein, wo ihn gleich hinter dem Eingang ein weiterer Preßburger Sonderling willkommen heißt. Es ist eine wohlgelungene Nachbildung jenes sogenannten Schachtürken, den vor rund zweihundertvierzig Jahren das Preßburger Universalgenie Wolfgang von Kempelen ersonnen, konstruiert und allen Großen seiner Zeit vorgeführt hat.
Die Szene erinnert in mancher Weise an das Wiener Café Central, wo seit vielen Jahren ein mannsgroßes Pappmaché-Imitat des Dichterbohemiens Peter Altenberg die Gäste begrüßt. Doch während das Wiener Gegenstück sich damit begnügt, grämlich vor sich hin zu starren, verbreitet die mit pelzverbrämtem Kittel, vielfarbigem Turban und überlanger Tabakpfeife ausgestattete Wächterfigur am Portal des Preßburger Innenstadtlokals eine Atmosphäre scheinbar-hektischer Betriebsamkeit: Hinter einer tiefschwarzen, mit allerlei Türchen und Schubladen versehenen Kommode thronend, auf der ein Schachbrett ruht, könnte der geheimnisvolle Typ mit den weitaufgerissenen schwarzen Augen und dem dichten Schnauzbart jeden Moment loslegen und seine Schachfiguren in Bewegung setzen – so wie es damals, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, der gute Herr von Kempelen mit seiner weltweit aufsehenerregenden Maschine getan hat, bis diese anno 1854 bei einem Großbrand in Flammen aufging.
Vom Original hat sich also nichts erhalten, doch auch dessen Double im Preßburger Café Roland bietet ausreichend Anschauungsmaterial, um sich in die Geschichte eines der berühmtesten Magiers seiner Zeit zu vertiefen, der die besondere Gunst Kaiserin Maria Theresias genossen hat, über den ganze Bücher geschrieben worden sind und der sogar im heutigen Wien (und zwar seit 1935) mit einer eigenen Gasse verewigt ist, die seinen Namen trägt.
Eine der vielen Prunkbauten, die auf unserem Rundgang durch die Preßburger Altstadt den Blick auf sich ziehen, ist das Palais de Pauli; es befindet sich in nächster Nähe des noch eindrucksvolleren Palais Pálffy in der Ventúrska-Straße, wo der örtlichen Überlieferung nach der sechsjährige Mozart konzertiert hat (und heute die Österreichische Botschaft untergebracht ist). Im Vorgängerbau dieses Palais de Pauli, einem der königlichen Herrenhäuser der Stadt, kommt am 23. Jänner 1734 Wolfgang von Kempelen zur Welt. Der Vater ist in leitender Funktion in der Ungarischen Hofkammer tätig; in der Ortschaft Gomba, dem heutigen Hubice, fünfundzwanzig Kilometer südöstlich von Preßburg, hat die Familie ihren Landsitz.
Wolfgang besucht die Schule im ungarischen Raab (dem heutigen Györ), in Wien studiert er Philosophie und Jurisprudenz. Durch seine Übersetzung des kaiserlichen Gesetzbuches weiß er schon frühzeitig die Aufmerksamkeit des Hofes auf sich zu lenken; Maria Theresia läßt sich den vielversprechenden Jungmann vorstellen und ernennt ihn zum »Concipisten« der Ungarischen Hofkammer. Binnen weniger Jahre steigt er zum Hofsekretär und Kammerrat auf; die Neuordnung des Salzwesens wird ihm ebenso übertragen wie das Arbeitsbeschaffungsprogramm für die in der Batschka und im Banat angesiedelten Neubürger. In Preßburg gründet er eine Manufaktur für Stoffdrucke und entwirft Pläne für eine Pontonbrücke, für Schönbrunn schafft er die wassertechnischen Voraussetzungen zur Errichtung des Neptun-Brunnens, für die blinde Musikerin Maria Theresia Paradis, Patenkind der Kaiserin und Freundin Mozarts, konstruiert er eine mit Blasebalg betriebene Sprachmaschine, für die Hainburger Zigarettenmanufaktur einen Tabakschneideapparat. Auch ein Spezialbett für Ihre Majestät die Kaiserin zählt zu seinen Erfindungen (da wüßte man gern Näheres, doch Kempelens Biographen üben sich leider in Diskretion).
1769 rufen den Fünfunddreißigjährigen dringende Geschäfte nach Wien, und bei dieser Gelegenheit lädt ihn die Kaiserin ein, den »mathematischen Vorstellungen« des französischen »Magnetiseurs« Pelletier beizuwohnen. Kempelen ist Feuer und Flamme: Schon die einschlägigen Experimente des gleichaltrigen, in Wien praktizierenden Arztes Franz Anton Mesmer haben ihn tief beeindruckt. Kempelen verspricht der zweiundfünfzigjährigen Maria Theresia, binnen weniger Monate eine Maschine zu konstruieren, »die alles, was Höchstdieselbe eben anzusehen gewürdiget haben, weit übertreffen werde«.
Am 28. Juli 1769 kann die »Preßburger Zeitung« unter »Inländische Vorfälle« über ein »noch nie sichtbar gewesenes Kunststück des k. k. Hofkammerrats Wolfgang von Kempelen« berichten. Es ist die Geburt seiner »Schachmaschine«: eines »türkischen Mannes von natürlicher Größe, so vor einem Tische in Bereitschaft sitzet, mit jedermann Schach zu spielen«.
Die allgemeine Verblüffung ist groß: Wie ist es möglich, daß dieses künstliche Wesen, einem Roboter gleich, mit seinem mechanischen Arm stets nach den jeweils richtigen Figuren greift, den jeweils richtigen Zug vollführt und am Ende gegen jeden lebendigen Partner, der sich auf ein Match mit dem »Schachtürken« einläßt, den sicheren Sieg davonträgt?
Damit keiner der Beteiligten, die dem Kunststück beiwohnen, auf den Gedanken kommt, im Inneren des Apparates könnte eine den Verlauf der Schachpartie lenkende lebende Person verborgen sein, sind die Füße des Spieltischs mit Rollen versehen; zusätzliche Spannung geht von dem dumpfen Rasseln aus, das bei jedem Schachzug aus dem Inneren des Automaten dringt.
Der Kaiserin ist das gelungene Experiment, für das auch die klügsten Köpfe bei Hof keine Erklärung haben, eine Anerkennungsprämie von tausend Dukaten wert, und ihr Sohn und Nachfolger, Joseph II., erteilt dem genialen Erfinder sogar die Bewilligung, für die Dauer von zwei Jahren – bei fortlaufendem Bezug seines Gehaltes als Hofkammerrat – mit seiner Attraktion auf Reisen zu gehen und sie den Großen dieser Welt vorzuführen. Regensburg und Augsburg sind die ersten Stationen seiner Tournee, es folgen Auftritte in Paris und London, und da Kempelen auch dem späteren Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, dem zu dieser Zeit als US-Gesandter in Europa weilenden Benjamin Franklin, eine Einladung zu einer seiner Vorführungen zukommen läßt, könnte dies der Anstoß zu dem Amerika-Gastspiel des Schachtürken sein, der Wolfgang von Kempelens Lebenswerk krönt.
Da ist er selber allerdings nicht mehr mit von der Partie: Das Wunderwerk aus der Preßburger Bastelwerkstatt des Herrn Hofkammerrats ist inzwischen in den Besitz des Wiener Erfinderkollegen Johann Nepomuk Mälzel übergegangen, der seinerseits mit der Konstruktion des ersten Metronoms Furore macht. Zu dieser Zeit weilt Kempelen bereits unter der Erde; Sohn Carl führt das Werk in der elterlichen Wohnung am Wiener Kohlmarkt fort; die Erträge aus den Eintrittsgeldern fließen einem Hilfsfonds für bedürftige Familien zu. Erst 1838, vierunddreißig Jahre nach Kempelens Tod, gelingt es, das Geheimnis des Schachtürken zu lüften: Die »Revue mensuelle des Échecs« teilt einem schon die längste Zeit skeptischen Fachpublikum mit, Kempelen habe im Inneren seines Gerätes einen genialen Schachspieler von extrem winzigem Körperwuchs versteckt. Warum es so lange bis zu dieser Enthüllung dauert? Nun, es wird wohl daran liegen, daß es niemand wagt, einer so hochgestellten Persönlichkeit wie dem adeligen Herrn Hofrat zu Lebzeiten auf die Finger zu schauen …
Und wie verhält es sich mit dem weiteren Schicksal des Schachautomaten? Höchst banal: In der Nacht vom 5. auf den 6. Juli 1854 fällt er in Philadelphia, wo sich Kempelens Wunderding zuletzt befunden hat, einem Großbrand zum Opfer.
Die Faszination, die über Jahrzehnte von ihm ausgegangen ist, hält gleichwohl weiter an. Auch nach dem Tod des gebürtigen Preßburgers (der in Wien und zwar auf dem – heute aufgelassenen – Währinger Friedhof beigesetzt wird) greifen etliche Geistesgrößen den reizvollen Stoff auf: E.T.A. Hoffmann äußert sich dazu in einer in der »Zeitung für die elegante Welt« veröffentlichten Studie »Die Automate«, Edgar Allan Poe macht in seiner Erzählung »Die Entdeckung des Herrn von Kempelen« aus dem Protagonisten sogar einen gebürtigen Amerikaner, und auch das neue Medium Film verschafft Kempelens Geniestreich mehrmals breiten Raum – so mit dem 1923 gedrehten US-Stummfilmkrimi »White Tiger« oder mit der tschechoslowakischen Produktion »Kreuz drei«, für die 1946 der Schönberg-Schüler Hanns Eisler die Musik schreibt.
Kann es da ausbleiben, daß eines Tages ein begabter Bastler auf die naheliegende Idee kommt, den guten alten Schachtürken nachzubauen? 1989, also hundertzwanzig Jahre nach Kempelens Erfindung, ist es soweit: Der amerikanische Automatensammler und Erzeuger von Zaubererrequisiten John Gaughan unterzieht sich der ebenso reizvollen wie heiklen Aufgabe, ein originalgetreues Imitat des berühmten Objekts herzustellen und dem staunenden Publikum von Los Angeles zu präsentieren. Und so, wie einst Wolfgang von Kempelen seinen Preßburger Prototyp von Stadt zu Stadt, von Land zu Land ziehen läßt, schickt auch Mister Gaughan sein spätes Double auf die Reise – er allerdings in der umgekehrten Richtung: von Amerika nach Europa. Sogar die ehrwürdige Budapester Kunsthalle öffnet ihm 2007 ihre Pforten.
Der Ursprungsort Preßburg hat schon früher für »Nachschub« gesorgt: Noch in den achtziger Jahren macht sich ein einheimischer Folklorekünstler an die Arbeit und stellt eine Nachbildung des Schachtürken her – es ist jenes Konstrukt, das heute im Eingangsbereich des Café Roland die Gäste begrüßt. Und auf der Promenade, direkt gegenüber der martialisch befestigten Amerikanischen Botschaft, haben findige Köpfe der Preßburger Stadtverwaltung ein überdimensionales Schachbrett ins Gehsteigpflaster einfügen lassen, auf dem spielfreudige Passanten vor aller Leute Augen ihrem Hobby frönen können. Und einer der täglich zwischen Preßburg und Wien verkehrenden Reisezüge ist auf den offiziellen Namen »Kempelen« getauft worden.