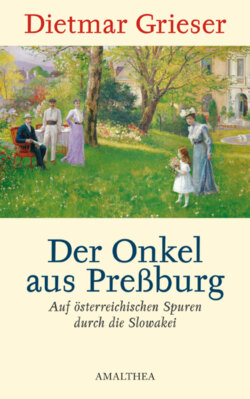Читать книгу Der Onkel aus Preßburg - Dietmar Grieser - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
p wie Portisch
ОглавлениеWenn eine Zeitung an exponierter Stelle der Seite 1 das Wort an ihre Leser richtet, bedeutet das in der Regel nichts Gutes. Das Mindeste, was man den Verschreckten in gewundenen Formulierungen begreiflich zu machen versucht, ist die unumgänglich gewordene Anhebung des Verkaufs- bzw. Abonnementpreises. Das Schema, nach dem die Sache abläuft, ist stets das gleiche: In bewegten Worten wird die allgemeine Teuerung beklagt, es folgt ein meist schwammiges Versprechen, in Hinkunft die Blattqualität noch weiter zu steigern, und es endet mit der Formel, die wir aus den Lautsprecherdurchsagen bei Zugsverspätungen kennen: »Wir bitten um Verständnis.«
Auch der Verfasser der Rubrik »An unsere Leser«, die am 25. August 1929 die Titelseite der »Preßburger Zeitung« beherrscht, bittet um Verständnis. Aber nicht um Verständnis für Preiserhöhung, Umfangsverringerung oder Chefredaktionswechsel. Sondern um Verständnis für die Einstellung des Blattes.
»Editorial« nennt man heute diesen Modus der Weitergabe von Betriebsinterna; mehr als eine volle Spalte nimmt sie im gegenständlichen Fall ein: Wir erfahren von den »schweren Zeiten«, die die »Preßburger Zeitung« in den letzten Jahren durchlitten, von den finanziellen Engpässen, die das Unternehmen in seiner Existenz bedroht und auch von den vielerlei Rettungsversuchen, die die Geschäftsführung unternommen habe. Auch dem aufopferungsvollen Idealismus der Mitarbeiter, die keine Anstrengung unterlassen hätten, das bedrohte »Kulturwerk« vor dem Untergang zu bewahren, werden Worte des Dankes und der Anerkennung gewidmet. An konkreten Gründen, die die Katastrophe herbeigeführt haben, werden ein Buchdruckerstreik, ein »unglückliches Vertragsverhältnis« mit dem für die Herstellung des Blattes verantwortlichen Geschäftspartner, der plötzliche Tod des wichtigsten Förderers sowie das Ausbleiben fest zugesagter Überbrückungshilfen angeführt. Die Folge: »Das Unternehmen war nicht mehr zu halten, das Gericht mußte um die Einleitung des Zwangsausgleichsverfahrens ersucht werden.«
Trotzdem – so der Schlußabsatz des hundertzwanzig Druckzeilen langen Artikels – solle es nicht ein endgültiger Abschied von der »Preßburger Zeitung« sein: Mit aller Kraft arbeite man daran, dem Verlag zu einer neuen finanziellen Basis zu verhelfen, und für diese Übergangsphase bitte man die verehrten Leser um Geduld: »Es handelt sich nur um eine ganz kurze Zeit, dann wird das alte Blatt wieder in einer neuen Form und in solcher Aufmachung erscheinen, daß alle Wünsche der Leser volle Befriedigung finden werden.« Unterzeichnet ist der »in dieser schweren Stunde« verfaßte Beitrag mit einem Namen, der auch dem heutigen Zeitungsleser – also achtzig Jahre nach jenen Ereignissen – durchaus bekannt vorkommt: mit dem Namen Portisch.
Es ist Chefredakteur Emil Portisch, der zweieinhalb Jahre davor Vater eines Sohnes geworden ist, den jeder heutige Österreicher aus den Medien – insbesondere aus dem Fernsehen – kennt: Hugo Portisch, der ehemalige Chefredakteur der Wiener Tageszeitung »Kurier«, Starkommentator des ORF, Gestalter überragender zeitgeschichtlicher TV-Dokumentationen und Autor von Sachbuchbestsellern wie »Hört die Signale«, »So sah ich China«, »Österreich I« und »Österreich II«.
Die Portischs sind Preßburger, auch der am 19. Februar 1927 geborene Sohn Hugo ist in der slowakischen Hauptstadt aufgewachsen und zur Schule gegangen. Vater Emil tritt am 4. August 1924 seinen Posten als Chefredakteur der »Preßburger Zeitung« an (nach deren Schließung – fünf Jahre später – er sein Lebenswerk mit der Gründung des »Neuen Preßburger Tagblatts« und der bis 1939 erscheinenden »Neuen Preßburger Zeitung« fortzusetzen versucht).
Sein Neuanfang nach Kriegsende führt den dann Achtundfünfzigjährigen nach Österreich, wo Emil Portisch 1945 in St. Pölten die Zeitungen des dortigen Preßvereins aufbaut; er stirbt 1985 im hohen Alter von achtundneunzig Jahren.
Als 1999 die slowakische Historikerin Danuša Serafínová die Monographie »Preßburger Zeitung – Nutz und Lust« herausbringt, widmet sie ihr 158-Seiten-Werk der »Erinnerung an Emil Portisch und alle vom Schicksal verwehten Preßburger«, und Sohn Hugo Portisch wird in seinem Vorwort der Autorin für ihre Leistung Dank bekunden, schlage sie doch mit dieser Studie eine Brücke über jene lange Zeit, »in der das alte, das geschichtliche Preßburg vom jetzigen total abgekoppelt schien. So als ob die Identität der damaligen Stadt mit der heutigen nichts zu tun hätte.« Und Hugo Portisch fährt fort: »Preßburg war immer eine Stadt aller ihrer Bürger, welcher Sprachgemeinschaft oder Religionsgemeinschaft sie auch angehörten. Gewiß gab es da Leidenschaften genug, nicht selten Konfrontation, und auch Preßburg hatte traurige Kapitel in seiner Geschichte aufzuweisen. Aber in kaum einer anderen Stadt nahm man einander mit so lebhaftem Interesse wahr wie in diesem alten Preßburg.« Emil Portischs Ziel sei es gewesen, der deutschsprechenden Bevölkerung der Stadt, zu der auch deren große jüdische Gemeinde gezählt habe, eine liberale, tolerante und demokratische Zeitung zu erhalten. »Dies gelang ihm bis zum 14. März 1939 – dem Tag, an dem die Tschechoslowakei zugrunde ging.«
Schauen wir uns die gute alte, anno 1764 gegründete »Preßburger Zeitung« ein bißchen näher an – und zwar die der letzten fünf Jahrgänge, also die der Ära Portisch.
Es ist kein Weltblatt, was p- (wie Emil Portisch seine Leitartikel auf Seite 1 zu unterzeichnen pflegt) und sein Team in der Venturgasse 9, also nahe dem Palais Pálffy, Tag für Tag produzieren. Aber es ist ebenso auch keine armselige Provinzpostille. Wenn man die alten Bände durchblättert, fühlt man sich am ehesten an ein Mittelding zwischen der »Wiener Zeitung« und dem Nachkriegsblatt »Neues Österreich« erinnert. Ja, in manchem zeigt sich die »Preßburger Zeitung« sogar ihrem Wiener Vorbild überlegen: Sie ist – laut Eigeninserat – »das einzige Blatt in der Slowakei, das als Morgen- und Abendblatt erscheint und in jeder Hinsicht Erfolge aufweisen kann«.
Die Morgenausgabe erscheint um 6, die Abendausgabe um 16 Uhr – und das sieben Mal pro Woche. An den Werktagen hat sie vier, sonntags sechzehn Seiten. Für die Nachrichten aus der Ostslowakei, insbesondere aus der überwiegend von Deutschsprachigen besiedelten Zips, sorgt eine eigene Außenredaktion in Kesmark. Kompliziert ist das System der Bezugspreise – je nachdem, ob der Leser sein Leibblatt in der Trafik kauft, innerhalb Preßburgs zugestellt erhält oder aber per Postversand bezieht. Hat er eine ungarische oder eine österreichische Adresse, fällt noch ein eigener Portozuschlag an. Morgen- und Abendausgabe sind keineswegs bloße Mutationen, sondern eigenständige Blätter, die sich sogar durch den auf Seite 2 abgedruckten Fortsetzungsroman voneinander unterscheiden.
Den auf den vorderen Seiten versammelten politischen Berichten und sonstigen Tagesneuigkeiten folgen weiter hinten die Rubriken »Aus dem Gerichtssaale«, »Theater und Kunst«, »Volkswirtschaft« und »Sport«, letztere übrigens noch in recht bescheidenem Umfang. Unter dem Sammeltitel »Aus dem Matrikelamte« erfährt der Leser, was sich in puncto Geburten, Trauungen und Sterbefällen ereignet hat; die Börsenkurse fehlen ebenso wenig wie die Radioprogramme aus Preßburg, Budapest, Prag und Wien, die Angebote der »Lichtspieltheater« ebenso wenig wie die »Badezeiteinteilung in den städtischen Donaubädern«. Nicht täglich, aber dennoch regelmäßig wird über »Gesundheitswesen«, über »Technik und Radio« sowie über »Frau und Mode« berichtet; »Literaturbeilage«, »Zeitschriftenschau« sowie »Reise- und Bäderzeitung« komplettieren das Redaktionsprogramm.
Illustrationen sind zu dieser Zeit noch nicht üblich – und wenn, dann nur in Gestalt von Zeichnungen, nicht von Photos. Farbdruck kommt nur bei ganz seltenen Anlässen vor – etwa, wenn die »Preßburger Zeitung« eines ihrer großen Jubiläen feiert oder wenn auf dem Krönungshügel von Preßburg ein Maria-Theresia-Denkmal enthüllt wird. Daß Zeitungen nicht von ihren Abonnenten, sondern vorrangig von ihren Inserenten leben, gilt auch schon in jenen Tagen: Geschäftsreklame und Kleinanzeigen füllen ganze Seiten. Die Sprache, deren sich die »Preßburger Zeitung« bedient, ist durchgehend Deutsch; nur bei den Straßennamen scheint da und dort auch die slowakische bzw. ungarische Version auf.
Was die Inhalte betrifft, gilt Vielfalt als das oberste Gebot. Der großen politischen Analyse (wie etwa dem am 1. Jänner 1926 veröffentlichten Rückblick »Wie Preßburg zur Tschechoslowakei kam«) stehen Lokalnachrichten gegenüber, die nur auf den ersten Blick armselig anmuten, in Wahrheit jedoch viel über die schwierigen Lebensumstände der späten zwanziger Jahre verraten – etwa, wenn wir unter dem Rubrum »Tagesneuigkeiten« lesen: »Ein armer Mann, der seine Familie ernähren muß und endlich Arbeit bekommen hat, bittet inständig edle gute Menschen um eine alte Hose und einen alten Rock, da er sonst nicht in die Arbeit gehen kann.«
Zu dieser Art von Leserservice zählt – um ein weiteres Beispiel zu nennen – auch der von der »Preßburger Zeitung« veröffentlichte »Aufruf an unsere edelgesinnten Glaubensgenossen«, mit dem der »Jüdische Volksküchenverein« mit Sitz in der Kapuzinergasse um »ehebaldige Zusendung von Naturalien wie Mehl, Kartoffeln, Zucker und Gemüse sowie von Heizmaterial wie Kohle, Koks und Holz« ersucht, damit auch künftighin der großen Zahl von Arbeitslosen mit »nahrhaften Speisen in gutgeheiztem Lokale« beigestanden werden kann. Schlußsatz des Appells: »Der Allmächtige wird die humane Bestätigung edler Barmherzigkeit gewiß reichlich segnen und belohnen.«
Man wird es wohl tragisch nennen müssen, daß zwei Jahre darauf – im Zuge der nunmehr voll ausbrechenden Weltwirtschaftskrise – auch die »Preßburger Zeitung« selber in Bedrängnis gerät und »Schriftleiter« Emil Portisch am 25. August 1929 die Einstellung des Blattes bekanntgeben muß. »Leset und verbreitet die Preßburger Zeitung!« hatte der verzweifelt um deren Fortbestand Ringende schon in den Monaten davor in laufend eingeschalteten Eigeninseraten an seine Klientel appelliert.
Was ihn und sein Unternehmen bei aller Geldnot vorerst über Wasser hält, ist die tatkräftige Unterstützung durch den Betreiber des Preßburger Nobelhotels Carlton. Damit ist es schlagartig vorbei, als Mitte August 1929 der einer deutschen Patrizierfamilie entstammende Heinrich Prüger plötzlich sechzigjährig stirbt: Die »Preßburger Zeitung« ist von da an Geschichte. Zwar wird ihr Titel fünfundsiebzig Jahre später reaktiviert werden, doch diese 2004 wiedergegründete »Preßburger Zeitung« ist ein alle zwei Monate erscheinendes Hochglanzmagazin »für Investoren, Wirtschaftspartner und Touristen«, das gewiß seine Meriten hat, jedoch mit dem Original in nichts zu vergleichen ist. Wer im heutigen Bratislava mit seinem verschwindend kleinen deutschen Bevölkerungsanteil nach einer Tageszeitung in seiner Muttersprache greifen will, bleibt auf die Blätter aus den Nachbarstaaten Österreich und Deutschland angewiesen – nicht anders als die (ungleich zahlreicheren) Slowaken, die es – umgekehrt – nach Österreich oder Deutschland verschlagen hat.