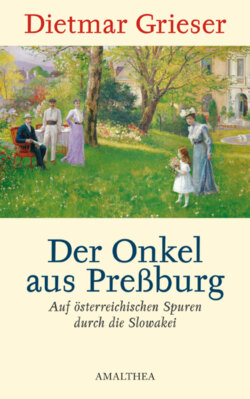Читать книгу Der Onkel aus Preßburg - Dietmar Grieser - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Medaillon
ОглавлениеEs hat einen Hauch von Buckingham, wenn sich vor dem Grassalkovich-Palast in Preßburg die Neugierigen drängen, um durch die goldschimmernden Gitter der schmiedeeisernen Umzäunung das Ritual der Wachablöse zu beobachten. Gar so viele sind es an diesem Tag freilich nicht: ein paar Schulkinder, ein paar Touristen, der Rest Rentner. Im Stechschritt und mit gezücktem Säbel paradieren die fünf Jungmänner in ihrer pittoresken Uniform aus leuchtend blauem Rock, mausgrauem Beinkleid und schwarzem Tschako vor dem Amtssitz des slowakischen Staatspräsidenten, zu dessen eigentlichem Schutz eine Handvoll Beamte in Zivil aufgeboten sind, die geschäftig hin und her eilen, um dafür zu sorgen, daß kein Unbefugter in das Allerheiligste der Republik vordringt. Auch ich, der ich da allzu auffällig mit Kamera und Notizblock hantiere, werde ins Visier genommen – freilich längst nicht mehr mit jenem habituellen Mißtrauen, das hier zu Zeiten des kommunistischen Regimes geherrscht haben mag.
Nach Kriegsende zunächst Sitz des Slowakischen Nationalrates und ab 1950 unter dem systemkonformen Etikett »Klement-Gottwald-Palast der Pioniere« Schulungszentrum der Parteijugend, wird in den neunziger Jahren der Prunkbau im Norden Preßburgs unter großem Kostenaufwand restauriert und zählt heute zu den Schmuckstücken der slowakischen Hauptstadt. Wenn man von der unmittelbaren Umgebung der Anlage absieht, die zur Zeit ihrer Errichtung noch aus satten Wiesen und sanft ansteigenden Weinbergen bestanden hat, die inzwischen dicht herandrängenden Autostraßen und Wohnvierteln gewichen sind, kann man sich mit einiger Phantasie ausmalen, wie es hier zugegangen sein mag, als um 1760 Graf Anton Grassalkovich, Vorsitzender der Königlich Ungarischen Hofkammer und Berater Maria Theresias, das Gelände erwarb und sich von den besten Baumeistern des Landes seine Residenz errichten ließ. Im nachfolgenden Jahrhundert als Gästehaus des Hofes genützt (vor allem, wenn sich die Crème de la Crème zu den Krönungsfeierlichkeiten in Preßburg einfand), ging der Palast nach dem Aussterben des Grassalkovich-Geschlechts in den Besitz einer habsburgischen Nebenlinie über, deren letzter Repräsentant, Erzherzog Friedrich, zwischen 1882 und 1918 mit seiner Gemahlin Isabella in den luxuriös ausgestatteten Rokokosalons Hof hielt. »Besonders bei Anlässen, die das Getriebe des Alltags in festlicher Weise erhöhen«, so lesen wir in der von Kronprinz Rudolf herausgegebenen Buchreihe »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild«, »verleiht der erzherzogliche Hofstaat dem städtischen Leben keine geringe Anregung.«
Eine große Rolle spielte dabei der dem Palast nachgelagerte, im französischen Stil angelegte Park. Auch ihm (beziehungsweise dem, was davon übriggeblieben ist) mache ich meine Aufwartung: Die Kieswege und Baumalleen, die Blumenrabatten und Sitzbänke sind heute für jedermann frei zugänglich; nur eine respektgebietende massive Glas-Stahl-Konstruktion trennt sie hermetisch von den Amtsräumen des Staatsoberhauptes ab. Was sich an der Ostseite der Anlage wie eine Gräberfront ausnimmt, erweist sich bei näherem Hinsehen als eine Art Imponiermeile der jungen Republik: Es sind die ins Erdreich eingelassenen Marmortafeln mit den Namen und Besuchsdaten jener Staatsoberhäupter von nah und fern, die ihre Visite im heutigen Bratislava mit einer symbolischen Baumpflanzung bekräftigt haben: die Monarchen Juan Carlos, Albert und Carl Gustaf, die Präsidenten Havel, Klestil und Rau. Dazu, ein paar Schritte seitab, das eine und andere Beispiel neuzeitlicher Skulpturkunst, reizvoll kontrastiert von einer 1992 rekonstruierten Maria Theresia hoch zu Roß.
Zu der Zeit, da das Erzherzogspaar Friedrich und Isabella samt Anhang und Gästeschaft den Grassalkovich-Palast innehat, kommt dem Park gesteigerte Bedeutung zu: Hier frönt man dem geselligen Lustwandeln, hier geben sich die fürstlichen Kinder ihren Spielen hin, und hier treibt man Sport. Tennissport vor allem. Auf meine Frage nach einem präzisen Wo? erhalte ich allerdings keine Auskunft: Zu lange ist es her, daß die hohen Herrschaften an diesem Ort ihr Racket geschwungen haben. Die Erinnerung an die illustren Turniere von anno dazumal ist ausgelöscht – und so auch die Erinnerung an jenen folgenreichen Eklat, der im Sommer 1898 von der Umkleidekabine des Tennisplatzes im Park von Schloß Grassalkovich seinen Ausgang nimmt und die österreichisch-ungarische Monarchie für einen Moment den Atem anhalten läßt.
Welchen Eklat? – Drehen wir die Zeituhr um vier Jahre zurück. Prag 1894. In den prachtvollen Räumen der böhmischen Statthalterei lädt Graf Franz von Thun-Hohenstein zu einer Soirée dansante, an der als Ehrengast Erzherzog Franz Ferdinand teilnimmt. Vor fünf Jahren hat die Tragödie von Mayerling das Habsburgerreich erschüttert; der dreißig Jahre alte Kaiserneffe, zur Zeit als Befehlshaber der 38. Infanteriebrigade in Budweis stationiert, gilt als der voraussichtliche Thronfolger. Nicht nur bei Hof ist das Rätselraten groß, wen der noch immer Ledige eines Tages zur Frau nehmen wird. Kaiser Franz Joseph sähe ihn gern an der Seite seiner Schwiegertochter, der seit fünf Jahren verwitweten Kronprinzessin Stephanie. Doch bei aller Sympathie für die fünf Monate Jüngere: Franz Ferdinand mag davon nichts wissen. Auch alle anderen »Kombinationen«, die von den Hofschranzen in Umlauf gesetzt werden, haben keinerlei Chance auf Verwirklichung.
Da begegnet der allseits Begehrte bei dem erwähnten Ballfest im Hause des Prager Statthalters einer Frau, die er wohl schon bei früheren Gelegenheiten flüchtig kennengelernt hat: Es ist die etwas über vier Jahre jüngere Gräfin Sophie Chotek. Ihr Vater, der Diplomat Graf Bohuslav Chotek von Chotkowa und Wognin, befindet sich bereits im Ruhestand und lebt mit seiner Frau, einer geborenen Kinsky, an seinem letzten Standort als Botschafter: in Dresden. Tochter Sophie ist mit ihren sechsundzwanzig Jahren ebenfalls noch unverheiratet, dient seit einiger Zeit der in Preßburg residierenden Erzherzogin Isabella als Hofdame.
Über ihr Zusammentreffen mit dem designierten Thronfolger existieren selbstverständlich keinerlei Aufzeichnungen. Wir müssen uns also mit der überlieferten Legende begnügen, und diese Legende besagt: Schon bei ihrem ersten Blickkontakt springt bei beiden der berühmte Funke über, beim Tanzen kommt man einander noch um einiges näher, und bei dem anschließenden Tête-à-tête in einem der Nebenräume bahnt sich an, was zunächst noch viele Monate ein streng gehütetes Geheimnis bleiben wird: Franz Ferdinand und Sophie sind einander in innigster Liebe zugetan und streben um jeden Preis den Bund fürs Leben an. Beide sind sich freilich im klaren darüber, daß der Kaiser niemals einer Ehe zwischen seinem Nachfolger und einer unebenbürtigen Partnerin, wie es die böhmische Landgräfin Sophie Chotek ist, seine Zustimmung erteilen wird. Alle Begegnungen der heimlich Verlobten müssen also im Verborgenen stattfinden, ihre Korrespondenz unter Pseudonym und postlagernd abgewickelt werden.
Eine weitere Erschwernis bildet der Umstand, daß Sophie in ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt ist: Die Sechsundzwanzigjährige, ihres verarmten Elternhauses wegen ohne nennenswerte Mitgift ausgestattet, dient seit August 1888 der im Grassalkovich-Palast zu Preßburg residierenden Erzherzogin Isabella als Hofdame. Die dem deutschen Adelshaus Croy-Dülmen entstammende, ihres üppigen Wuchses wegen gern als »Busabella« Apostrophierte ist mit dem einer habsburgischen Nebenlinie angehörenden Erzherzog Friedrich verheiratet; aus der Ehe gehen sieben Kinder hervor – durchwegs Mädchen.
Da bleibt für eine Bedienstete wie Sophie eine Menge zu tun, auch wenn fürs Grobe drei weitere Hausangestellte zur Verfügung stehen: Sie begleitet ihre Herrin bei den Spaziergängen und Ausfahrten, sie regelt deren Post- und Geschenkverkehr, sie liest ihr aus den jeweils neuesten Büchern vor, und auf kürzeren Reisen werden ihr aus Ersparnisgründen mitunter sogar die Agenden der Kammerfrau übertragen. Zwar besteht zwischen Isabella und Sophie ein im allgemeinen gutes Einvernehmen, dennoch gebietet die Etikette, daß die Hofdame bei den gemeinsamen Mahlzeiten einen Platz am Ende der Tafel einnimmt – noch hinter den Kindern. Daß Isabella ihrer Gesellschafterin ab und zu eines ihrer abgelegten Kleider zum Geschenk macht, kann sowohl als großzügige Geste wie als subtiler Akt der Demütigung verstanden werden.
Franz Ferdinand, mit seinen Preßburger Verwandten auf freundschaftlichstem Fuße stehend, nützt die Situation, um sich mit seiner Geliebten an deren Arbeitsplatz zu treffen. Besuche in Preßburg sind für den Thronfolger nichts Besonderes: Schon früher ist er zu wiederholten Malen von Erzherzog Friedrich zur Jagd eingeladen worden. Jetzt aber häufen sich seine mitunter mehrtägigen Aufenthalte im Grassalkovich-Palast. Allerdings hat er sich dabei vorzusehen, daß es im Umgang mit Hofdame Sophie Chotek unauffällig zugeht, absolut unverfänglich.
Hausherrin Isabella, nichts Böses ahnend, fördert die Besuche des hohen Gastes und denkt dabei wohl auch an die Möglichkeit, Franz Ferdinand als Bräutigam ihrer erstgeborenen Tochter, der achtzehnjährigen Maria Christina, einzufangen. Ob sie sich vielleicht sogar schon als Schwiegermutter des künftigen Kaisers fühlt?
Am 10. September 1898 wird Kaiserin Elisabeth ermordet. Die daraufhin für den Rest des Jahres verhängte Hoftrauer samt Absage sämtlicher Jubiläumsfeiern räumt Franz Ferdinand noch mehr Zeit ein als sonst, Abstecher nach Preßburg einzuplanen. Im Palast sind für ihn und den ihn begleitenden Kammerdiener Janaczek stets mehrere Zimmer freigehalten. Damit das eigentliche Ziel seiner Besuche, seine Rendezvous mit der Verlobten, unaufgedeckt bleiben, bringt Franz Ferdinand seine Sportsachen mit, geht mit den Töchtern seiner Gastgeber schwimmen und reiten, trifft sich mit ihnen zum Tennis. Da er außerdem ein passabler Geigenspieler ist, läßt er sich bei der üblichen Hausmusik von der Ältesten am Klavier begleiten.
Für Franz Ferdinand, der sich von seiner schweren Erkrankung – die Ärzte hatten einen gefährlichen Lungenspitzenkatarrh diagnostiziert – erholt hat, läuft alles nach Wunsch, abgesehen von dem lästigen Zwang zur Heimlichtuerei. Aber gegen das eine oder andere gemeinsame Tennisspiel mit der Hofdame kann niemand etwas haben, und so gönnen sich Franz Ferdinand und Sophie auch an jenem Herbsttag des Jahres 1898 (das genaue Datum ist nicht überliefert) eine Partie auf dem dafür adjustierten Gelände im Grassalkovich-Park.
Das Match hat – um des ungestörten Beisammenseins der beiden Liebenden willen vielleicht sogar ganz bewußt in die Länge gezogen – mehr Zeit in Anspruch genommen als sonst, und so passiert in der Eile des Aufbruchs ein Malheur, das ungeahnte Folgen haben wird: Der Erzherzog läßt in der Umkleidekabine versehentlich seine Uhr liegen. Es ist eine schwere goldene Taschenuhr, an der auch sein Siegel und sein Zigarrenabschneider befestigt sind.
Franz Ferdinand hat bereits die Rückreise angetreten, als der Diener, der die Umkleidekabine des Tennisplatzes aufräumt, auf das vergessene Objekt stößt: Pflichtgemäß liefert er es bei seiner Dienstgeberin ab, damit diese es für die Zeit bis zu Franz Ferdinands nächstem Besuch in Verwahrung nimmt. Doch bevor Erzherzogin Isabella noch dazu kommt, die Uhr in das dafür vorgesehene Schmuckkästchen zu legen, fällt ihr Blick auf den goldschimmernden Deckel, hinter dem sich ein Medaillon zu verbergen scheint. Ob es vielleicht gar ein Bild ihrer Tochter Maria Christina ist, das der Erzherzog da mit sich herumträgt? Neugierig öffnet sie den Uhrdeckel – und fällt aus allen Wolken: Statt einer Haarlocke oder eines Konterfeis ihrer Ältesten blicken sie die Augen ihrer Hofdame an: Das Medaillon enthält ein Miniaturporträt von Sophie Chotek!
Schlagartig werden ihr die Zusammenhänge klar: Franz Ferdinand hat ihr und den ihren eine unerhörte Komödie vorgespielt, hat alle Beteiligten über Wochen und Monate hinters Licht geführt. Augenblicklich weiß Isabella, was sie zu unternehmen hat: Sie stellt die »falsche« Person zur Rede, überhäuft Sophie mit den heftigsten Vorwürfen und spricht deren unverzügliche Kündigung aus. Um die »Form« zu wahren, einigt man sich allerdings auf einen zweiwöchigen Scheinurlaub, nach dessen Ablauf die schriftliche Entlassung folgen werde. Und Isabella tut noch ein Weiteres: Sie ersucht den Kaiser um einen Audienztermin, begibt sich nach Wien und unterrichtet Seine Majestät von dem Vorgefallenen. Franz Joseph I., über das infame Spiel seines Neffen nicht minder bestürzt, reagiert gleichwohl kühl auf den Bericht seiner Besucherin und sichert Isabella lediglich zu, er werde mit Franz Ferdinand über die Angelegenheit reden.
Gräfin Sophie Chotek hat inzwischen ihrerseits die »Flucht« nach Wien angetreten und sucht fürs erste Unterschlupf bei ihrer Schwester Zdenka, die gerade im Begriff ist, ihren Dienst als Hofdame bei Kronprinzessin Stephanie zu quittieren und sich auf den Eintritt in ein Nonnenkloster vorzubereiten.
Der Rest der hochnotpeinlichen Geschichte darf als bekannt vorausgesetzt werden: Kaiser Franz Joseph scheint in der Beziehung seines Neffen nichts weiter als eine Affäre zu erblicken, und Affären kann man den Beteiligten ausreden – vom zunächst gütlichen Appell an Vernunft und Staatsräson bis hin zur offenen Drohung. Man geht dabei »arbeitsteilig« vor: Um auch Sophie von der Unmöglichkeit ihrer Liaison zu überzeugen, tritt der in allen Ränken wohlgeübte Obersthofmeister Graf Montenuovo in Aktion.
Doch es hilft alles nichts: Auch die dem »verbotenen« Paar eingeräumte Bedenkzeit verstreicht, ohne daß dies an Franz Ferdinands Entschlossenheit das Geringste ändern könnte: »Von meiner Sopherl laß ich nicht!« Es endet mit einem Sieg des Erzherzogs: Da sich dieser zur Unterzeichnung einer Renunziationserklärung bereitfindet, die sowohl seine künftige Gemahlin wie auch die aus der geplanten Ehe hervorgehenden Kinder von der Thronfolge ausschließt, gibt Kaiser Franz Joseph notgedrungen grünes Licht, und Franz Ferdinand kann aufatmen: »Ich schwimme in einem Meer von Glück!« schreibt er in einem Brief an einen seiner engsten Vertrauten. Am 1. Juli 1900 findet in der Schloßkapelle zu Reichstadt (die näheren Umstände dieses in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Ereignisses habe ich in meinem Buch »Die böhmische Großmutter« geschildert) die Trauung statt. Dem somit auch offiziell legalisierten Liebesglück von Franz Ferdinand und Sophie ist allerdings nur eine Dauer von vierzehn Jahren beschieden: Es endet, wie es schlimmer nicht enden könnte – mit dem Doppelmordattentat von Sarajewo.