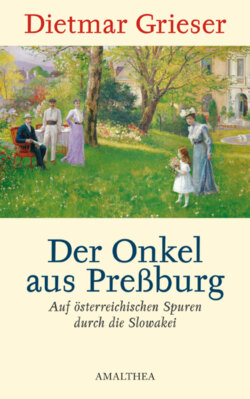Читать книгу Der Onkel aus Preßburg - Dietmar Grieser - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Orgel der Franziskaner
ОглавлениеDie Slowakei ist ein guter Boden für Musikanten, Sänger und Komponisten und ein besonders guter für die frühreifen unter ihnen. Bei Franz Schmidt, dem die Musikwelt zumindest zwei Klassiker verdankt, nämlich die Oper »Notre Dame« und das Oratorium »Das Buch mit sieben Siegeln«, setzt die musikalische Ausbildung schon im Alter von sechs Jahren ein: Mutter Maria, geborene Ravasz, ist es, die ihrem Sprößling, bevor er noch in der Volksschule eingeschrieben wird, ein Kinderklavier ins Spielzimmer stellt und den ersten Unterricht erteilt.
Die Familie lebt zu dieser Zeit – es ist das Jahr 1880 – im sogenannten Reidner-Haus am Grünen Platz, dicht am alten Zentrum von Preßburg. Der Vater betreibt ein gutgehendes Speditionsunternehmen (und versucht sich in seiner Freizeit an diversen Blasinstrumenten); die Mutter, ungarischen Geblüts, ist eine hervorragende Pianistin.
Noch bevor der kleine Franz Notenlesen gelernt hat, macht er sich daran, auf seinem Instrument die Tasten zusammenzusuchen, die er braucht, um die Kirchenlieder, die er bei der Sonntagsmesse oder bei einer der Festtagsprozessionen aufgeschnappt hat, zu »repetieren«. Ganz besonders hat es ihm das Orgelspiel in der Preßburger Domkirche angetan: Statt an der Seite seiner Kameraden bei der sogenannten Volksschulmesse im Chor mitzusingen, schleicht er sich auf die Empore und schaut dem Organisten über die Schulter.
Mutters Klavierunterricht ist höchst ambitioniert: Allen Ernstes hat sie vor, dem begabten Anfänger binnen kurzem ein strenges Pensum abzuverlangen – jeden Tag ein Präludium und jeden zweiten eine Fuge aus dem »Wohltemperierten Klavier«. Franz besucht die deutsche Grundschule – auch im Elternhaus wird Deutsch gesprochen. In einer gemischtsprachigen Stadt wie Preßburg weiß man sich allerdings auch auf ungarisch zu verständigen, und für den Umgang mit dem aus dem Umland stammenden Hauspersonal bedient man sich des Slowakischen.
Als es Maria Schmidt im Lauf der Zeit mit der Hausarbeit zuviel wird, beschließt sie, den Klavierunterricht ihres Sohnes in fremde Hände zu übergeben: Rudolf Mader, Volksschullehrer und Domorganist, soll sich des Siebenjährigen annehmen. Zwei Jahre steht der freundliche alte Herr dafür zur Verfügung, dann beginnt er zu kränkeln und zieht sich aus seinem Beruf zurück: Man muß nach einem Nachfolger Ausschau halten.
Dieser erweist sich allerdings als keine glückliche Wahl: Der fünfunddreißigjährige Ludwig Burger stammt aus Deutschland; er war eine Zeitlang Kapellmeister am Preßburger Stadttheater und hält sich für ein verkanntes Genie. Schlimm genug, daß er beim Unterrichten planlos vorgeht und seine Schüler – wie Franz Schmidt später in seinem Lebensrückblick beklagen wird – »alles Mögliche durcheinanderspielen« läßt, verleidet der notorische Choleriker seinem Schützling die Klavierstunden auch dadurch, daß er in einem fort über seinen Vorgänger herzieht – und das in den wüstesten Tiraden. Kein Wunder, daß Franz bei seinen Eltern auf Ablöse drängt: Der Unterricht des aufbrausenden Herrn Burger sei »ergebnislos und gänzlich unerfreulich«.
Als der Zwölfjährige dann auch noch – hinter dem Rücken seines Lehrers – am Hof von Erzherzog Friedrich eingeführt, von dessen Gemahlin, der kunstsinnigen Erzherzogin Isabella, zu Wohltätigkeitskonzerten ins Grassalkovich-Palais eingeladen und vom dortigen Auditorium als Wunderkind gefeiert wird, kommt es endgültig zum Bruch: Franz erhält abermals einen neuen Musiklehrer. Es ist der junge Franziskanerfrater Felician. Und diese Verbindung erweist sich vom ersten Augenblick an als ideal.
Kloster und Kirche der Preßburger Franziskaner sind von Franz Schmidts Elternhaus in wenigen Minuten Fußmarsch erreichbar. Ihre Bibliothek, ihr Musikalienarchiv und vor allem ihre Orgel können es ohne weiteres mit der Konkurrenz des St.-Martin-Domes aufnehmen. Die 1297 geweihte Franziskanerkirche, eine einfache einschiffige Basilika im gotischen Stil, ist der älteste erhaltene Sakralbau der Stadt – bei den Feierlichkeiten zur Krönung der ungarischen Könige, die traditionell in Preßburg stattfindet, ist auch sie in das diesbezügliche Zeremoniell einbezogen. Was den Gymnasiasten Franz Schmidt an diesem Gotteshaus besonders anzieht, ist die wunderbare Klöckner-Orgel, von der er später sagen wird, ihr Ton sei »so unbeschreiblich schön und von einem so eigenartigen Silberglanz«, daß er sich gar nicht von ihr trennen mag, sondern jede freie Minute in ihrer Nähe zubringt.
Dieses starke, für die weitere Entwicklung Franz Schmidts so entscheidende Erlebnis läßt sich heute, 125 Jahre danach, nur mit viel Phantasie nachvollziehen: Beim 600-Jahr-Jubiläum der Franziskanerkirche anno 1897 wird im Zuge einer Totalrenovierung auch die Orgel ausgetauscht, und diese neue, eine Kreation der Jägerndorfer k. u. k. Hoforgelfabrik Rieger, kann es mit der Klangschönheit der früheren in keiner Weise aufnehmen. Der junge Franziskanerfrater, der für mich, den schweren Schlüsselbund in der Hand, die Kirche aufsperrt und mich auf die Empore begleitet, läßt sich nur auf nachdrückliches Bitten dazu überreden, sich am Spieltisch niederzulassen und mir ein paar Takte vorzuspielen. Da er nur slowakisch spricht, darf ich von ihm keinerlei Auskünfte über seinen Vorvorvorgänger Felician erwarten.
Umso liebevoller geht die einschlägige Literatur, die mir zur Verfügung steht, auf die überragende Rolle dieses hochmusikalischen Kirchenmannes ein; sie beschreibt den 1861 geborenen Josef Móczik, der den Ordensnamen Felician annimmt, als Preßburger Arbeitersohn, der an und für sich eine akademische Malerausbildung absolviert hat, seine eigentliche Bestimmung jedoch im Orgelspiel findet. Obwohl ihm im Franziskanerkloster auch ein vorzüglicher Bösendorfer zur Verfügung steht, ist das Klavierspielen seine Sache nicht: Frater Felician und sein Schützling sind sich vom ersten Augenblick an darin einig, daß für sie ausschließlich die Beschäftigung mit der Königin der Instrumente in Betracht kommt.
Hier also werden dem jungen Franz Schmidt im täglichen Zusammenspiel alle jene Kenntnisse vermittelt, die ihn viele Jahre später dazu befähigen werden, die Aufnahmeprüfung für Anton Bruckners Kontrapunktklasse am Wiener Konservatorium zu bestehen.
Auch Felician profitiert von der Freundschaft zwischen Lehrer und Schüler: Franz weiht den dreizehn Jahre Älteren, der sich nur radebrechend auf deutsch verständigen kann, in die Feinheiten seiner Muttersprache ein. Umgekehrt vervollkommnet er im Umgang mit dem Herrn Lehrer seine eigenen Lateinkenntnisse.
Preßburg hat zu dieser Zeit ein reiches Kulturleben: Aus den Privatsalons der Aristokratenfamilien verlagert sich die Musikausübung mehr und mehr in die öffentlichen Konzertsäle. Schon 1871 wird an der örtlichen Oper Richard Wagners »Lohengrin« aufgeführt, es folgen »Tannhäuser« und ein weithin gerühmter »Fidelio«; Stars wie Anton Rubinstein, Pablo de Sarasate und das Hellmesberger-Quartett absolvieren Gastspiele.
Daß der junge Franz Schmidt ihnen allen lauschen, ja sogar ihre persönliche Bekanntschaft machen kann, verdankt er einer Preßburger Musikenthusiastin, zu deren Kreis er im Herbst 1887 Zutritt findet. Es ist die Klavierlehrerin Helene von Bednarics, die nicht nur die höheren Töchter der Stadt unterrichtet und in ihrem Salon die Musikprominenz aus aller Welt um sich schart, sondern auch Franz Schmidts überragendes Talent erkennt. Glühende Wagner-Verächterin, läßt sie allerdings nur Schumann und Chopin gelten. In puncto Urteilskraft schwört sie auf einen Konzertpianisten, der zu dieser Zeit weltweit als die Nummer eins unter den Klavierpädagogen gilt: der aus Polen stammende und seit 1840 in Wien wirkende Theodor Leschetizky. Wer sich die stolzen Honorare des Meisters leisten kann, schickt seine Kinder zu Leschetizky in die Weimarerstraße; einer von ihnen ist der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, der sich seiner Tochter Clara zuliebe fast zwei Jahre in Wien aufhält.
Auch Franz Schmidt läßt sich – über Vermittlung von Fräulein von Bednarics – bei ihm zum Vorspielen anmelden. Daß dies ein schwerer Fehler ist, der den Kandidaten um Jahre zurückwerfen wird, kann niemand ahnen: Leschetizky, dem Franz Schmidt später vorwerfen wird, nur an weiblichen Schülern interessiert gewesen zu sein (die er dann umso mehr umschmeichelt, getätschelt und liebkost habe), moniert an Franz Schmidts Talentprobe dessen Mangel an »Charme« und läßt sich sogar zu dem geschmacklosen Verdikt hinreißen: »Wenn einer Schmidt heißt, soll er nicht Künstler werden.«
Schon vor diesem Vorfall sind im Hause Schmidt einschlägige Überlegungen angestellt worden: Franz könnte den magyarischen Namen seiner Mutter annehmen. Leschetizkys Entgleisung hat zur Folge, daß diese Pläne von einer Minute auf die andere vom Tisch sind. Eines allerdings läßt sich nicht aus der Welt schaffen: Franz ist von dem vernichtenden Urteil des »Meisters« so tief betroffen, daß er ernstlich mit dem Gedanken spielt, das Klavierspielen, ja überhaupt jegliche Beschäftigung mit Musik aufzugeben.
Noch ein zweiter böser Vorfall wirft dunkle Schatten auf das Leben des Dreizehnjährigen. Franz besucht die dritte Klasse Gymnasium; Professor Dohnányi, sein Physiklehrer, erteilt ihm nebenbei auch Violinunterricht. Die Dohnányis führen in Preßburg ein musikfreudiges Haus: Sohn Ernst, drei Jahre jünger als Franz Schmidt, ist ein beachtliches Klaviertalent. Schon spricht sich in Preßburg herum, in dem erst Zehnjährigen reife ein wahres Wunderkind heran. Seiner geringen Körpergröße wegen muß er zum Spielen auf den Sessel gehoben werden, und damit die zu kurzen Beine das Pedal erreichen, lassen ihm die Eltern eine eigene Spezialvorrichtung konstruieren.
Zum Abschluß des Unterrichtsjahres wird in der Aula des Gymnasiums ein Festkonzert veranstaltet, an dem alle beide, Franz Schmidt und Ernst von Dohnányi, mitwirken. Doch obwohl ersterem die schwierigere Aufgabe (eine Liszt-Rhapsodie) zufällt, während letzterer nur den Solo-Part von Mozarts Klavierquartett g-Moll zu spielen hat, ist es ebendiese Programmnummer, die die besondere Aufmerksamkeit des Auditoriums auf sich zieht. Noch schlimmer die Presseberichterstattung: Dohnányi wird als noch nie dagewesenes Genie bejubelt, Schmidt fast mit keinem Wort erwähnt.
Dabei wird es übrigens auch in späteren Jahren bleiben: Die Hinwendung zum Komponistenberuf, die im Fall Schmidt erst im reifen Alter erfolgen wird, tritt bei Dohnányi sehr viel früher ein – ganz zu schweigen von der allgemeinen Strahlkraft des Namens Dohnányi (Ernst von Dohnányi wird sowohl als Dirigent wie als Komponist Karriere machen; sein Sohn Hans, eine der Spitzen des Berliner Reichsjustizministeriums, wird vor Kriegsschluß 1945 als Widerständler von den Hitler-Leuten hingerichtet werden; auch die Enkelsöhne Klaus und Christoph gehen in die Geschichte ein – der eine als SPD-Spitzenpolitiker, der andere als Dirigent von Weltruf; und Oliver Dohnányi ist der Name des derzeitigen Preßburger Operndirektors).
Doch zurück ins Schicksalsjahr 1888. In Franz Schmidts Elternhaus bahnt sich eine Katastrophe an: Der väterliche Betrieb, das Preßburger Speditionsunternehmen, bricht zusammen. Angesichts der akuten Existenzsorgen, die aus der eben noch wohlhabenden über Nacht eine bettelarme Familie machen, ist an eine weitere musikalische Ausbildung des Sprößlings nicht zu denken. Damit auch dieser seinen Beitrag zum Lebensunterhalt im elterlichen Haushalt leisten kann, tritt der erst Vierzehnjährige eine Stelle als Hauslehrer bei einem Preßburger Gymnasiasten an – gegen Kost und Logis. Da ist es für den zutiefst Irritierten fast eine Erlösung, daß die Familie Schmidt ihren angestammten Wohnort aufgibt, in die Nähe Wiens übersiedelt und in der Wienerwaldgemeinde Perchtoldsdorf einen Neuanfang versucht.
Es wird sich tatsächlich als Franz Schmidts Rettung erweisen – wenn auch nur als Rettung auf lange Sicht. Sein Violinstudium beim Wiener Hofkapellmeister Joseph Hellmesberger, sein Engagement als Solo-Cellist der Wiener Philharmoniker und seine Lehrtätigkeit an Konservatorium und Hochschule führen ihn schließlich (und auf vielen Umwegen) seiner eigentlichen Berufung zu: seiner Selbstverwirklichung als Komponist, die im durchschlagenden Erfolg seiner Symphonien, seiner Oper »Notre Dame« und vor allem seines Oratoriums »Das Buch mit sieben Siegeln« (sehr zu empfehlen: Franz Welser-Mösts CD-Einspielung mit dem Bayerischen Radio-Symphonieorchester) ihre späte Krönung finden wird. Doch das ist schon wieder ein eigenes Kapitel. Die behütete Preßburger Kindheit hat dafür allerdings die Voraussetzungen geschaffen.