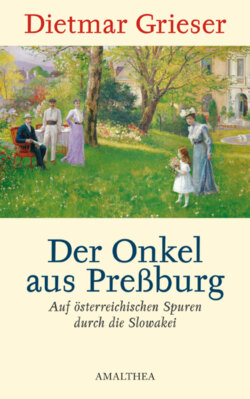Читать книгу Der Onkel aus Preßburg - Dietmar Grieser - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
In Preßburg fing alles an
ОглавлениеWieso heißt die Albertina Albertina?
Quizfrage Nr. 2: Wo hat die weltberühmte Kunstsammlung ihren Ursprung?
in Wien
in Dresden
in Venedig
Antwort: In keinem der drei. Sondern in Preßburg.
Wien mit seinen vielen Museen verfügt über zwei Häuser, die miteinander im Wettstreit liegen, die Nummer eins zu sein: das »Kunsthistorische« und die Albertina. Allein letztere bringt es im Schnitt auf 600 000 Besucher pro Jahr – Tendenz weiter steigend. Kunstfreunde aus allen Teilen der Welt stürmen den aus dem Palais Taroucca und Teilen des Augustinerklosters hervorgegangenen Musentempel hinter der Staatsoper, um sich an deren Ausstellungen zu delektieren, auch wenn gerade keiner der Superstars der Albertina auf dem Programm steht: Dürer oder Rembrandt, Michelangelo oder Leonardo da Vinci, Raffael oder Rubens, Cranach oder Goya, Munch oder Picasso, Schiele oder Klimt. Mit ihren über 50 000 Zeichnungen und anderthalb Millionen Druckgraphiken gilt die Albertina als die größte graphische Sammlung der Welt, und seit der in den letzten Jahren unter enormem Kostenaufwand durchgeführten Restaurierung der prunkvollen Ausstellungsräume würde sich eine Besichtigung selbst dann lohnen, hinge kein einziges Bild an der Wand.
Doch zurück zu den Eingangsfragen nach dem Gründer der Albertina und dem Ort ihrer Gründung. Daß es sich bei ersterem wohl um irgend einen Albert handelt, legt der Name nahe, den das Institut seit Jahr und Tag trägt. Doch Preßburg als Keimzelle – wieso Preßburg?
Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen und die österreichische Erzherzogin Maria Josepha haben vierzehn Kinder. Albert Casimir, am 11. Juli 1738 in Schloß Moritzburg bei Dresden geboren, ist ihr elftes. Der junge Prinz wächst am Dresdner Hof auf; die pädagogische Strenge und das religiöse Eiferertum seines Erziehers Freiherr von Wessenberg mögen die Gründe dafür sein, daß sich der Heranwachsende schon früh dem Geist der Aufklärung zuwendet, ja später sogar zu einem der Anführer der Freimaurerbewegung aufsteigen wird. Auch seine ersten Kriegserfahrungen tragen wesentlich dazu bei, ihn seiner Geburtsheimat zu entfremden: Aus Abneigung gegen alles Preußische flüchtet der Einundzwanzigjährige nach Wien und bietet den Habsburgern seine Dienste an.
Kaiserin Maria Theresia nimmt den jungen Offizier mit offenen Armen auf, und da er ihr auch persönlich äußerst sympathisch ist, gibt sie Albert ihre Lieblingstochter Marie Christine zur Frau: Am 6. April 1766 wird in Schloßhof bei Wien geheiratet. Die beiden Brautleute passen vorzüglich zusammen: Wie Albert ist auch seine vier Jahre jüngere Gemahlin eine sensible, hochgebildete, kunstinteressierte Person.
Jetzt braucht man nur noch eine standesgemäße »Verwendung« für das vielversprechende Paar: Maria Theresia überantwortet Herzog Albert das Fürstentum Teschen (also das seinerzeitige Österreich-Schlesien) und setzt ihn zum Statthalter von Ungarn ein. Um die beiden möglichst in ihrer Nähe zu haben, bestimmt die Kaiserin die ungarische Krönungsstadt Preßburg zur künftigen Residenz des geliebten Schwiegersohnes: Von hier aus, sechzig Kilometer vom Wiener Hof entfernt, soll Albert an der Seite seiner Marie Christine das vom Haus Habsburg verfügte Reformprogramm durchsetzen: die Verbesserung der landwirtschaftlichen Bodennutzung und die Aufhebung der Leibeigenschaft.
Maria Theresia, der Nachbarstadt und deren Adel und Bürgerschaft ohnedies von Herzen zugetan, läßt das Preßburger Burgschloß großzügig ausbauen und ausstatten: Albert, als Sohn eines verschwenderischen Vaters, der Sachsen in den Staatsbankrott führt, von Haus aus mittellos, soll es an seinem neuen Wirkungsort an nichts fehlen. An die 700000 Gulden beträgt die Mitgift, die Marie Christine in die Ehe einbringt – es ist die höchste Summe, die jemals einer habsburgischen Prinzessin gewährt worden ist.
Auf dem Gelände des Burgschlosses wird für das junge Paar ein eigenes Palais errichtet (das später den Namen Theresianum führen wird); der zweistöckige Bau im Stil des Wiener Frühklassizismus enthält neben den Wohnräumen auch Bibliothek, Waffensammlung und Ahnengalerie. Ziergärten werden angelegt, natürlich Stallungen und eine überdachte Reitschule, Unterkünfte für die Schloßgarden, sogar ein Theater und – nicht zu vergessen! – eine Reihe von Kabinetten, die die Kunstsammlung des Hausherrn aufnehmen sollen. Doch davon später, denn das ist bereits die Urgeschichte der Albertina …
Der Einzug des Statthalterpaares in Preßburg gestaltet sich festlich: Die Magnaten und der Klerus der Stadt sowie die Beamten der Hofkammer bereiten Albert und Marie Christine ein herzliches Willkommen. Um die Zufahrt zum Schloß zu erleichtern, hat man eigens die alte Befestigungsmauer durchbrechen lassen. Auffallend auch die extreme Breite der Marmortreppen: Die Pferdenärrin Maria Theresia soll – laut Volksmund – die Angewohnheit gehabt haben, bei ihren häufigen Besuchen im Schloß das obere Stockwerk hoch zu Roß zu erklimmen …
»Meine Frischvermählten sind in Preßburg überglücklich!« schreibt die Kaiserin in einem Brief an eine ihrer Vertrauten, und ihrer Tochter Marie Christine, die sich an das neue Domizil erst noch gewöhnen muß, macht sie mit den Worten Mut: »Alle Welt zeigt sich entzückt von Preßburg, man sieht nur breite Mäuler.« Auch rät sie ihr zu Ausfahrten durch Stadt und Land: »Ihr tut recht daran, Euch am ersten Mai öffentlich zu zeigen; das macht immer einen guten Eindruck.«
Wann genau Herzog Albert mit dem Erwerb und systematischen Sammeln von Kunstwerken beginnt, ist schwer zu datieren. Den ersten Hinweis liefert das Tagebuch des aus Hessen stammenden und seit 1736 in Paris ansässigen Kupferstechers und Kunsthändlers Johann Georg Wille, der ab August 1768 laufend über nach Preßburg adressierte Lieferungen zeitgenössischer Stiche Buch führt. Alberts Kunstsinn paart sich hierbei aufs schönste mit den Interessen seiner Gemahlin, die selber eine passionierte Malerin ist, ja vor ihrer Eheschließung sogar ganze Zimmerausstattungen in Schönbrunn mit ihren Handzeichnungen bereichert hat.
Richtig in Schwung kommt Herzog Alberts Sammeltätigkeit mit dem Auftrag, den er 1774 dem kaiserlichen Gesandten in Venedig, Graf Jacopo Durazzo, erteilt: Der Siebenundfünfzigjährige, der zehn Jahre lang die Wiener Hoftheater geleitet (und nach seiner Heimkehr nach Italien unter anderem Mozart zu Besuch gehabt) hat, soll ihm eine möglichst vollständige Kollektion zeitgenössischer italienischer Kupferstiche beschaffen. Durazzo, übrigens derselben Freimaurerloge angehörend wie Albert, unterzieht sich seiner Aufgabe mit geradezu fieberhaftem Fleiß: Binnen zwei Jahren hat er an die 30 000 zum Teil erlesenste Stiche beisammen, dazu die Lebensläufe und Werkverzeichnisse von 1400 Künstlern, sowohl chronologisch wie nach den diversen Schulen aufgegliedert. Am 4. Juli 1776 erfolgt in Venedig die feierliche Übergabe: Es ist der Höhepunkt der knapp siebenmonatigen Italienreise, die Herzog Albert und Gemahlin Marie Christine des weiteren auch nach Ferrara, Bologna, Turin, Florenz, Rom und Neapel führt. Man ist inkognito unterwegs, nur zwei Adjutanten und zwei Hofdamen begleiten das Statthalterpaar.
Wie stolz Herzog Albert auf seine »Beute« ist, die ihm Graf Durazzo im Palazzo Loredan, dem Sitz der kaiserlichen Gesandtschaft in Venedig, ausfolgt, belegt jene Aquarellminiatur des Wiener Hofmalers Friedrich Heinrich Füger, die das Wiedersehen der nach Wien Zurückgekehrten mit Maria Theresia im Bild festhält: Schwiegersohn und Tochter führen der tiefbeeindruckten Kaiserin ihren Schatz vor, der im Anschluß daran an seinen Zielort Preßburg geschickt wird. Im Obergeschoß des Schlosses sind die für die Aufbewahrung der Bilder vorgesehenen Räumlichkeiten hergerichtet – sie werden dereinst den Grundstock der Wiener Albertina bilden …
Auch, als Herzog Albert nach zehnjährigem Wirken in Preßburg dem Ruf folgt, die Statthalterschaft in Brüssel anzutreten, setzt der inzwischen Einundfünfzigjährige seine Sammeltätigkeit in großem Stil fort: Allein in der Zeit von 1783 bis zu seinem Tod im Jahr 1822 wird es ein Gesamtbetrag von knapp 1,3 Millionen Gulden sein, den der Ahnherr der Albertina für den Erwerb von Kupferstichen und Handzeichnungen aufwendet. Daß davon – verursacht durch eine Vielzahl sowohl politisch wie verkehrstechnisch bedingter Verluste – nur ein verschwindend geringer Teil in den Bestand der Wiener Albertina Eingang finden wird, mindert nicht die außerordentliche Bedeutung der zwischen 1766 und 1780 in Preßburg angelegten Sammlung: Von hier, den Kunstkabinetten des kaiserlichen Statthalters, hat das Unternehmen seinen Ausgang genommen. Wie aber gelangt der mittlerweile unermeßlich reiche Schatz nach Wien, und vor allem: Wie gelangt er an seinen endgültigen Standort, in die künftige, nach ihrem Begründer benannte Albertina?
Natürlich ist es wieder einmal die hohe Politik, die den Stein ins Rollen bringt. Am 20. April 1792 hat Frankreich Österreich den Krieg erklärt, die französische Armee fällt in Belgien ein, der österreichische Generalstatthalter muß fluchtartig das Land verlassen. Albert und Marie Christine reisen rheinaufwärts, während drei schwerbeladene Schiffe das Mobiliar, die Bibliothek und die Kunstsammlungen von Rotterdam nach Hamburg bringen sollen. Ein Sturm im Ärmelkanal vernichtet eines der Schiffe und mit ihm einen Teil der kostbaren Ladung.
Dresden, wo das plötzlich heimatlose Paar fürs erste Unterschlupf findet, kann keine Dauerlösung sein – da schaltet sich der junge Kaiser Franz I. ein und lädt seine Tante, die Erzherzogin, und deren Gemahl ein, sich in Wien niederzulassen. Ein kleines, an die Hofburg angrenzendes Palais, mehrere leerstehende alte Häuser und einen Teil des aufgelassenen Augustinerklosters bietet er Albert und Marie Christine zum Umbau an: 1801 sollen sie samt ihrer Kunstsammlung in den neuen Räumen Einzug halten.
Doch der Plan geht nur zum Teil auf: Mitten während der Bauarbeiten stirbt die erst sechsundfünfzigjährige Marie Christine. Dem trauernden Witwer bleibt nur, das Testament der geliebten Gattin zu erfüllen: Selber kinderlos, setzt er den von ihm adoptierten Erzherzog Carl (den späteren Sieger von Aspern) als Alleinerben ein.
Eingedenk des Umstandes, daß Marie Christine sich mit dem Genuß unreinen Wassers den Tod geholt hat, läßt Albert eine Wasserleitung errichten, die über ein System von 16000 Doppelrohren Wien mit Trinkwasser von der Hohen Wand versorgt. Außerdem erteilt er einem der führenden Bildhauer der Zeit, Antonio Canova, den Auftrag, für den Betrag von 20 000 Gulden ein marmornes Grabmal für die verstorbene Erzherzogin zu errichten – es ist jenes für die benachbarte Augustinerkirche bestimmte Monument, das Jahre später Napoleon, wenn er es persönlich in Augenschein nimmt, unter die drei bedeutendsten Kunstwerke der Welt reihen wird.
Herzog Albert selbst hat noch vierundzwanzig Lebensjahre vor sich; er nützt sie dazu, seine Kunstsammlung weiter auszubauen, sein Lebenswerk zu vollenden. Gerührt liest man in den Berichten eines Zeitgenossen, »wie der Greis seine Tage in diesen geheiligten Räumen vom frühen Morgen bis zu vorgerückten Nachtstunden verbrachte und sich nur so viel freie Zeit gönnte, als die Mahlzeiten und Spaziergänge erforderten. Durchreisende Gelehrte und Künstler fanden ihn immer daselbst, stets beschäftigt mit der Anordnung und Vergrößerung seiner Kunstschätze. Die Empireperücke auf dem schmalen Haupt, im blauen Frack und hohen Stiefeln, nur gefolgt von seinem weißen Hündchen, schritt der einsame Mann durch die Räume …«
Als Herzog Albert von Sachsen-Teschen am 10. Februar 1822 vierundachtzigjährig stirbt, geht der gesamte Besitz an seinen Adoptivsohn Erzherzog Carl über, wird jedoch vom Hof zum Fideikommiss erklärt, was beim Zusammenbruch der Monarchie anno 1918 den Anspruch der Republik Österreich begründet, die komplette Sammlung in Staatsbesitz zu überführen. Und dabei bleibt es für alle Zeiten: Die Albertina ist unser.
Und was wird aus ihrer Preßburger Keimzelle? Ein Haufen Schutt und Asche. Die Schloßburg samt dem Prunkbau Theresianum, in dessen Obergeschoß Herzog Albert in jungen Jahren den Grundstein für seine nachmals weltberühmte Kunstsammlung gelegt hat, geht 1811 in Flammen auf: Der durch Unachtsamkeit der in der Preßburger Burg stationierten Soldaten ausgelöste Großbrand vernichtet die gesamte Anlage. Volle anderthalb Jahrhunderte bleibt sie Ruine, erst 1953 setzt allmählich ihr Wiederaufbau ein.