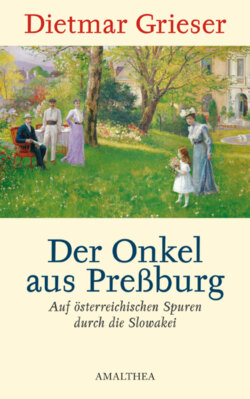Читать книгу Der Onkel aus Preßburg - Dietmar Grieser - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zum Gansl-Essen nach Preßburg
ОглавлениеZumindest in Europa ist es ein Unikum: zwei Hauptstädte, die kaum sechzig Kilometer voneinander entfernt sind. Und seitdem die Ostgrenzen gefallen sind, ist mancherlei im Gange, die kartographische Nähe zwischen Wien und Preßburg auch zur logistischen, vielleicht sogar zur mentalen Nähe auszubauen. Gemeinschaftsprojekte beherrschen die mutuelle Fremdenverkehrswerbung, sogar von Twin Cities kann man lesen, und Bahnkunden werden mit dem kecken Wortspiel »BratisLover« auf Tagesfahrten in die Nachbarmetropole eingestimmt. Im Stundentakt verkehren die Züge zwischen Wien Südbahnhof und Bratislava hlavná stanica, und das heißt nicht nur: alle sechzig Minuten, sondern auch in sechzig Minuten. Da mag älteren Wienern, die schon in Kindertagen auf den Kahlenberg geführt worden sind, um bei klarem Wetter bis zur Preßburger Burg zu blicken, das alte Sprichwort einfallen: Wenn einer in Wien niest, antwortet einer in Preßburg mit »Haptschi«.
Mein Gott, was war das alles kompliziert, als noch der Eiserne Vorhang Österreich und die Slowakei voneinander trennte: schlechte Straßen, umständliche Züge, lästige Grenzkontrollen. Jetzt hingegen günstige Pauschaltickets, die auch die freie Nutzung der Preßburger Straßenbahnen und Stadtbusse einschließen – Fahrradmitnahme gratis, Kinder zahlen die Hälfte. Fehlt nur noch der Begrüßungscocktail im Coupé oder am Perron. Fast könnte man glauben, die gute alte Zeit sei wiedergekehrt. Die gute alte Zeit der »Preßburgerbahn« …
Hundertzehn Jahre ist es her, daß die ersten Pläne zum Bau einer »Elektrischen« diskutiert werden, die Wien mit Preßburg verbinden soll. Josef Tauber heißt der Mann, der am 17. November 1899 der zu einer Sondersitzung einberufenen Wiener Verkehrskommission seine Vorschläge bezüglich Trassenführung, Abriß bestehender Bauten und Einleitung von Ablöseverhandlungen unterbreitet. Die für den niederösterreichischen Abschnitt der Neunzig-Kilometer-Strecke vorgesehenen Haltestellen finden durchwegs lebhafte Zustimmung: Welche der zahlreichen Gemeinden zwischen Wien und dem Grenzort Berg wäre nicht glücklich über eine ebenso rasche wie bequeme Verkehrsanbindung an die Hauptstadt!
Einwände kommen nur von zwei Seiten: Die Schifffahrtsgesellschaften, die ihre Passagiere zwar um vieles langsamer, doch dafür preiswert ans Ziel bringen, befürchten eine existenzbedrohende Konkurrenz, und auch die Preßburger Kaufleute legen sich quer: Was ist, wenn dadurch noch mehr Kunden nach Wien abwandern? Die erhoffte Einigung bleibt also aus, Ingenieur Taubers Pläne werden fürs erste ad acta gelegt.
Neuen Auftrieb erhält das Projekt fünf Jahre darauf von seiten des Militärs: Für den Fall einer Generalmobilmachung oder gar eines Waffenganges – so die Argumentation des Kriegsministeriums – wäre eine effiziente Bahnverbindung zwischen Wien und Preßburg nicht nur eine wertvolle Unterstützung bei der Abwicklung der Truppen- und Materialtransporte, sondern diente zugleich der Versorgung der Bevölkerung.
Diesmal gehen die Pläne durch, am 12. November 1904 übernimmt der Niederösterreichische Landtag die Zinsengarantie für die mit 10,7 Millionen Kronen veranschlagte Prioritätsanleihe; als Ablöse für Ingenieur Taubers Vorkonzession macht die Niederösterreichische Landesbahn 43 000 Kronen locker. Weitere fünf Jahre später wird auch die für den ungarischen Streckenabschnitt zuständige Gegenseite in das Projekt eingebunden, und am 3. Juni 1911 kann die mit dem Auftrag betraute Firma AEG Union mit den Bauarbeiten beginnen. Den für den Bahnbetrieb erforderlichen Strom sollen das gemeindeeigene Elektrizitätswerk Simmering bzw. die Preßburger Straßenbahn-AG liefern.
Das Neue an der Preßburgerbahn ist ihre Kombination aus Tramway und »Vollbahn«: Die 12,5-Kilometer-Strecke zwischen Wien und Schwechat wird per Straßenbahn, der fünfzig Kilometer lange Überlandabschnitt zwischen Schwechat und Kittsee per Vollbahn und das sieben Kilometer lange Reststück auf ungarischem Boden wieder per Straßenbahn abgewickelt. Ausgangspunkt ist das Hauptzollamt im 3. Wiener Gemeindebezirk: Großmarkthalle, Bürgertheater sowie die schon bestehenden Stadtbahn-, Straßenbahn- und Verbindungsbahnhaltestellen bieten sich als der ideale Knotenpunkt an. Ebenso befindet sich auch die Preßburger Endstation in zentraler Lage – es ist der dortige Krönungshügelplatz. Die Überlandstrecke folgt im großen und ganzen der Route der alten römischen Heerstraße längs der Donau; wichtige Haltepunkte sind die Ortschaften Fischamend, Maria Ellend, Regelsbrunn, Wildungsmauer, Petronell, Deutsch Altenburg, Hainburg und Wolfsthal.
Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit können die ersten Testfahrten stattfinden, denen am 22. Jänner 1914 ein Pressetermin und zehn Tage später die offizielle Eröffnung folgen. Obwohl in Wien dreißig Zentimeter Schnee liegt, verläuft alles klaglos: Eisenbahnminister Freiherr von Forster, Fürsterzbischof Piffl und die übrigen Honoratioren finden sich auf dem festlich geschmückten Platz in der Gigergasse ein, wo die zwei aus je einem II. und III.-Klasse-Waggon bestehenden Zugsgarnituren zur Abfahrt bereitstehen. Nach den üblichen Ansprachen und der nach katholischem Ritus vorgenommenen Weihe setzen sich um 10.25 Uhr die beiden Festzüge in Bewegung. Sämtliche Stationen sind dem Anlaß entsprechend geschmückt, zwecks Begrüßung sind die jeweiligen Ortsbürgermeister zur Stelle. Im Grenzbahnhof Berg gibt Staatssekretär Lers in ungarischer Sprache das Zeichen zur Weiterfahrt – er faßt es in die pathetischen Worte: »Es gibt keine zwei Staaten auf der Welt, die sich so glücklich ergänzen wie Österreich und Ungarn.«
Auch auf der Preßburger Seite wird nicht mit Jubel gespart: In den Straßen der Stadt stehen die Leute Spalier und winken dem Eröffnungszug zu, Bürgermeister Brolly bittet die Ehrengäste zum Festmahl ins Carlton-Hotel. Am Abend wird die Rückfahrt nach Wien angetreten.
Für die vier Tage später anberaumte Aufnahme des regulären Personenverkehrs stehen elf Zugspaare zur Verfügung; die gelbbraunen Waggons mit den großzügig bemessenen Fenstern, den elegant gestalteten hölzernen Sitzbänken und den jeweils sechzehn Elektrolampen erregen allgemeine Bewunderung. Kein Geringerer als Stararchitekt Otto Wagner zeichnet für die Innenausstattung verantwortlich.
Der Fahrplan sieht sowohl Personenzüge wie Schnellzüge vor. Erstere brauchen je nach Zahl der Halte bis zu drei Stunden, letztere eine Stunde und 54 Minuten. Der Fahrpreis beträgt 220 bzw. 340 Heller. Während der Inflationsjahre schnellt der Preis bis auf 25000 Kronen hinauf; nach der Währungsumstellung zahlt man 2,50 Schilling. Sehr beliebt beim Bildungsbürgertum ist der sogenannte Theaterzug, der seine Passagiere noch zu später Stunde heimbringt.
Auch das »normale« Publikum macht von der neuen Verbindung zwischen Wien und Preßburg reichlich Gebrauch: Schon im ersten Betriebsjahr werden über drei Millionen Billets verkauft, was zur Folge hat, daß der Wagenpark um siebzig Prozent erweitert und von Zwei-Wagen-Zügen auf Garnituren mit vier oder fünf umgestellt werden muß. Die Bilanz für das Jahr 1915 weist einen Gewinn von 335 000 Kronen aus. Nur auf der (kurzen) ungarischen Strecke kommt es zu Verlusten, die dazu führen, daß aus Ersparnisgründen vorübergehend sogar der Direktor der Betreibergesellschaft sowie dessen Sohn und Tochter als Lokführer eingesetzt werden müssen.
Eine wichtige Rolle kommt der Preßburgerbahn zu, was die Eßgewohnheiten der Wiener betrifft – und zwar im guten wie im schlechten: Sind es vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges die niedrigeren Gasthauspreise in Preßburg, die die Wiener in hellen Scharen zu Tagesfahrten in die Nachbarstadt locken, so führt die 1915 einsetzende allgemeine Lebensmittelverknappung zu einer dramatischen Zunahme der Einkaufsfahrten. Brot und Mehl, Zucker, Fett und Kaffee gibt es nur noch auf Lebensmittelkarten, zur Erzeugung von Ersatzprodukten wird auf Beimengungen aus Rüben und Mais zurückgegriffen. Da ist es immerhin ein Trost, wenn man sich bei den Bauern draußen auf dem Lande mit Kartoffeln und Gemüse eindecken kann: Die Züge der Preßburgerbahn sind bis auf die Trittbretter mit Hamsterfahrern besetzt.
Mit dem Zusammenbruch der Monarchie und der Ausgliederung Ungarns setzt auch der vormals so florierende »Kleine Grenzverkehr« aus und wird erst im Winter 1920/21 wieder aufgenommen. 1935 ist es mit dem durchgehenden Bahnverkehr Wien-Preßburg vollends vorbei: Die Passagiere müssen an der Station Berg aussteigen, ihre Formalitäten erledigen, die Grenze zu Fuß überschreiten und das letzte Stück der Strecke per Autobus zurücklegen.
Auch der Zweite Weltkrieg bringt für die Preßburgerbahn eine Reihe einschneidender Veränderungen. Jetzt sind es vor allem die Fronturlauber, später auch die Flüchtlinge, die die chaotisch überfüllten Züge bevölkern; die Bombenangriffe, die Brückensprengungen und der Einmarsch der Russen schränken den Verkehr weiter ein. Erst 1946/47 beginnen sich die Verhältnisse wieder halbwegs zu normalisieren – allerdings nur bis zum nunmehrigen Endbahnhof Wolfsthal. Im Grenzstreifen der slowakischen Seite wird auf den fortan verwaisten Gleisresten eine Betonmauer errichtet – ein trauriges Symbol für das Ende der vielgeliebten Preßburgerbahn. Die alten Waggons werden ausgemustert – nur ein einziges Exemplar überlebt: als Klublokal, das die ÖBB dem Verein der Eisenbahnfreunde zum Geschenk machen. Um einen der originalen Triebwagen zu inspizieren, müßte man sich ins Schwechater Eisenbahnmuseum bemühen, wo unter den vielerlei Ausstellungsstücken übrigens auch ein vergilbtes Exemplar der »Arbeitsordnung für den Streckenbau« zu bestaunen ist. Die Verfasser dieses umfangreichen Kataloges von Rechten und Pflichten der Werktätigen haben wirklich an alles gedacht – sogar an das Recht auf freie Religionsausübung. »An Feiertagen«, so lesen wir da, »ist den Arbeitern die nötige Zeit einzuräumen, um den ihrer Konfession entsprechenden Verpflichtungen zum Besuche des Vormittagsgottesdienstes nachzukommen …«