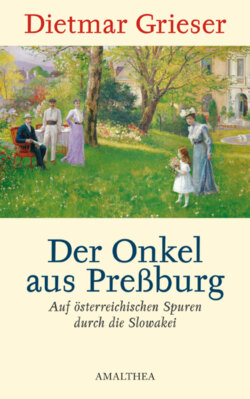Читать книгу Der Onkel aus Preßburg - Dietmar Grieser - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hoch hinaus
ОглавлениеMan kennt das von Prag: Die Hitler-Deutschen haben die tschechische Hauptstadt eingenommen; die Schaffner der öffentlichen Verkehrsmittel werden dazu angehalten, sämtliche Haltestellen zweisprachig auszurufen. Eine der frequentiertesten ist die Umsteigestation Múzeum. Und was hört man über sie? Man hört von einem couragierten Schaffner, der seinem Hohn über die »Besatzer« freien Lauf läßt, indem er »Múzeum – Museum – das Zweite ist deutsch!« ausruft.
Eine ähnliche Geschichte wird mir in Preßburg erzählt, sie spielt während des KP-Regimes: Wenn die Straßenbahn die Haltestelle Stalinplatz erreicht, ergänzen manche der Schaffner ihren Ausruf um den demonstrativen Zusatz »Manderla«.
Manderla – das ist der Fleischfabrikant Rudolf Manderla, der dem an dieser Stelle errichteten ersten Hochhaus von Preßburg seinen Namen gegeben hat. Sogleich kursiert unter den regimekritischen Bürgern das Witzwort, im »Ranking« der führenden Personennamen von Preßburg sei der Fleischfabrikant Manderla im Begriff, den Genossen Stalin auszustechen.
Mit klangvollen Namen werden wir es in diesem Kapitel noch öfter zu tun bekommen – vor allem mit dem des Erbauers des Manderla-Hauses, des Preßburger Architekten Christian Ludwig. Aber auch dessen gleichnamiger Sohn muß genannt werden: Es ist der ab den sechziger Jahren zu einem der renommiertesten Maler Österreichs aufsteigende Christian Ludwig Attersee. Doch schön der Reihe nach.
Herbst 2008, ich bin wieder einmal zu Fuß in Preßburg unterwegs. Der frühere Stalinplatz (und noch frühere Marktplatz) heißt inzwischen Platz des Slowakischen Nationalaufstandes, kurz SNP. Es ist eine der belebtesten Zonen am Rande der Altstadt: Einzelhandelsgeschäfte, Bürobauten, Gastwirtschaften. Der Weg führt mich an dem imposanten Gebäude des Hauptpostamtes vorbei. Neben dem Eingang fällt mein Blick auf eine blumengeschmückte Gedenktafel: Sie erinnert an jenen Studenten Peter Legner, der an dieser Stelle – obwohl völlig unbeteiligt an den Ereignissen vom August 1968 – von einem Soldaten der russischen Eingreiftruppe abgeknallt worden ist.
Ich setze meinen Weg fort, erreiche das Manderla-Haus. Was bei dessen Einweihung anno 1935 noch einer Sensation gleichgekommen ist, fällt heute, wo es auch in der slowakischen Hauptstadt von Wolkenkratzern wimmelt, kaum mehr auf: Preßburgs erstes Hochhaus hat in den über siebzig Jahren seines Bestehens Patina angesetzt. Seine (das Erdgeschoß eingerechnet) zwölf Stockwerke werden längst von Bauten aus neuerer Zeit überragt; auch ist der auf mächtigen quadratischen Pfeilern ruhende Stahlbetonriese mit seiner graubraun verwitterten Fassade dringend renovierungsbedürftig. Die das Objekt krönenden, zweieinhalb Meter hohen Buchstaben des Namens Manderla sind durch die riesige Reklametafel eines Versicherungsunternehmens ersetzt; nur auf dem Firmenschild eines im Erdgeschoß installierten Imbißstandes lebt der Name des Bauherrn fort: Nonstop pod Manderlou. Aus dem legendären Café Grand ist ein Bingo Dorado geworden, die alte Ladenpassage wartet auf neue Betreiber, die Büroräume werden von der Türkischen Handelskammer, einem Architekturstudio und einer Au-pair-Agentur genützt.
Der Rest sind – so wie von Anfang an – Wohnungen: Ich zähle 50 Briefkästen. Was dem Manderla-Haus – zum Unterschied von anderen Preßburger Wohnbauten – einen gewissen polyglotten Anstrich verleiht, sind die von Hausbesorgerhand gefertigten Mahnschilder, die bei Betreten des Entrées nicht nur in slowakischer, sondern auch in englischer Sprache vor der drohenden Rattengefahr warnen und den Liftbenützer (sogar auf deutsch!) dazu anhalten, darauf zu achten, »daß die Tür nach Ihrer Ankunft wirklich richtig zugemacht ist.« Dem aus Wien anreisenden Besucher wird außerdem eine der Etagenbezeichnungen vertraut vorkommen: Das große M an der Aufzugstür des Zwischengeschosses steht für Mezzanin.
Wer kann sich 1934, also in der noch immer von der Weltwirtschaftskrise gebeutelten Slowakei, den Bau eines Hochhauses leisten? Die 1892 gegründete Firma Manderla ist die führende »Dampf-Wurstfabrik« des Landes. Sie verfügt über drei Adressen: In der Hochstraße 7 befindet sich die Produktionsstätte, in der Lorenzertorgasse 28 und am Marktplatz 24 erfolgt der Detailverkauf. Um sowohl die deutsche wie die ungarische Klientel zu erreichen, wird in den Zeitungsannoncen auf Zweisprachigkeit geachtet: Johann Manderla macht den einen seine Würste schmackhaft, János Manderla den anderen.
Inzwischen ist es Sohn Rudolf, der den Betrieb führt, und der ist offensichtlich ein Mann von unternehmerischem Weitblick: Von einer Amerikareise heimgekehrt, die ihn vor allem der dortigen Wolkenkratzer wegen tief beeindruckt hat, entschließt er sich zum Erwerb eines Grundstücks im Zentrum von Preßburg, und da der dafür zur Verfügung stehende Platz nicht nur sündteuer, sondern vor allem beengt ist, plant er statt in die Breite in die Höhe: Architekt Christian Ludwig, 1901 als Sproß einer alten Weinhändlerdynastie in Preßburg geboren, Absolvent der örtlichen Metallgewerbeschule sowie der Technischen Hochschulen von Brünn und München und seit 1928 mit dem Kollegen Emerich Spitzer und dem Baumeister Augustín Danielis gemeinschaftlich tätig, soll ihm einen zwölfstöckigen Bau entwerfen, der Traditionelles mit gemäßigt Modernistischem verbindet: Preßburgs erstes Hochhaus. Die erstklassig ausgestatteten Wohnungen wird er vermieten, für sich selber richtet er im Erdgeschoß einen Fleischerladen ein.
Der siebzig Meter hohe Baukran, der bei dem stolzen Unternehmen zum Einsatz kommt, versetzt die Obst- und Gemüsehändler, die vor der Baustelle ihre Marktstände haben, in Angst und Schrecken: Was ist, wenn das Ganze einstürzt und ihnen ihre Existenzgrundlage raubt? Wenige Schritte von hier entfernt befand sich einst der Zugang zu einem unterirdischen Beinhaus aus mittelalterlichen Tagen – auch nicht gerade ein gutes Omen für das »frevlerische« Werk. Doch es gelingt, die Widerstände der Preßburger Bürgerschaft zu überwinden, und nach nur zehn Monaten Bauzeit kann im Mai 1935 das Manderla-Haus in Betrieb genommen werden. Preßburg hat sein neues Wahrzeichen – und das mitten im Herzen der Stadt.
Was seinen Schöpfer, den zu dieser Zeit vierunddreißig Jahre alten Christian Ludwig, betrifft, so bleibt es nicht bei diesem einen Großprojekt: Auch Preßburgs erstes Warenhaus, der 1936 in nächster Nähe errichtete Koloß der Firma Brouk & Babka (heute Dunaj), geht auf sein Konto; der neunstöckige Bau erregt nicht zuletzt wegen der nächtlichen Fassadenbeleuchtung mittels Neonröhren und der neuartigen Thermoglasfenster Aufsehen. Auch die aus schwedischem Granit gefertigte Sockelmauer und die Fassadenverkleidung mit lichtgrünen Keramikplatten ziehen die Blicke der Passanten auf sich. Es folgen der multifunktionale Bau des Café Regina sowie eine Reihe kleinerer Wohnhäuser und Villen, und auch für Sakralbauten wird der der Reformierten Kirche angehörende Christian Ludwig herangezogen.
Da er 1939 einem Ruf in die oberste Bauleitung der Reichsautobahnen (mit Sitz in Linz) folgt, ist gegen Kriegsende sein weiterer Verbleib in Preßburg auszuschließen: Die Familie übersiedelt nach Oberösterreich, wo auf Christian Ludwig neue Aufgaben warten – in den Bereichen Bundesbahnen und Industriearchitektur. Mit dem Bau eines Bootsklubhauses am Attersee schließt sich der Kreis: Ging es nicht seinerzeit in den zwanziger Jahren, als der junge Christian Ludwig in seiner Vaterstadt Preßburg seinen allerersten Auftrag erhielt, ebenfalls um ein Bootshaus (und zwar das des ungarischen Ruderklubs)?
Christian Ludwig stirbt am 9. Februar 1967 in Linz. Sein gleichnamiger Sohn ist zu dieser Zeit sechsundzwanzig Jahre alt und seinerseits auf dem Weg zur großen Karriere. Der 1940 in Preßburg Geborene hat den Künstlernamen Attersee angenommen und in Berlin die erste Einzelausstellung seiner Farbzeichnungen und Acrylbilder absolviert. Das Multitalent Attersee, als Flüchtlingskind mit Eltern und Bruder zunächst auf einem Hausboot auf der Donau lebend, in Aschach die Volksschule und in Linz das Realgymnasium besuchend, debütiert vorerst im literarischen Fach, schreibt, vertont und singt Lieder, versucht sich als Zeichner von Comics, entwirft Bühnenbilder. Erst nach dem Studium an der Wiener »Angewandten« wendet er sich mit voller Kraft der Malerei zu: Der Name Attersee (dem er übrigens auch als leidenschaftlicher Wassersportler und dreimaliger österreichischer Staatsmeister im Segeln seine Reverenz erweist) wird zum Markenzeichen. 1984 vertritt der Vierundvierzigjährige seine neue Heimat Österreich bei der Biennale von Venedig, 1992 erhält er eine Professur an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, und 1997 wird sein Lebenswerk mit der Verleihung des Großen Österreichischen Staatspreises gekrönt.
Zurück nach Preßburg. Würde Christian Ludwig Attersee, der heute – als einer der gefeiertsten Künstler Österreichs – in der ganzen Welt daheim ist, an Ort und Stelle den Spuren seiner frühesten Kindheit nachgehen, käme er, insbesondere was das Werk des Vaters betrifft, voll auf seine Rechnung: Die meisten der von Architekt Christian Ludwig entworfenen Bauten haben sich erhalten, und das gilt vor allem für sein Hauptwerk, das legendäre Manderla-Haus. Unter den zahlreichen Geschichten und Geschichterln um Preßburgs erstes Hochhaus und dessen weiteres Schicksal würde man dem berühmten Sohn vielleicht auch jene Episode aus den KP-geprägten siebziger Jahren erzählen, mit der ich mein Kapitel beschließen möchte:
Es ist zu der Zeit, da unter den mehrerlei Gassenlokalen des Manderla-Hauses auch der gute alte Fleischerladen noch in Betrieb ist. Es ist allerdings ein durch die Kommandowirtschaft der CSSR stark eingeschränkter Betrieb: Sowohl Warenangebot wie Service lassen sehr zu wünschen übrig. Ein Kunde, so wird erzählt, betritt das Geschäft, kauft sein Stück Fleisch, verlangt nach Einwickelpapier. Die Verkäuferin weist ihn brüsk ab, drückt ihm die Ware wortlos in die bloße Hand: Papier ist wieder einmal knapp im realsozialistischen Preßburg. Bevor der aufgebrachte Kunde unter Protest den Laden verläßt, hält er bei dem neben der Eingangstür hängenden Beschwerdebuch inne, reißt aus diesem zwei Seiten heraus, wickelt sein Fleisch darin ein und zieht triumphierend ab. Eine – man muß es sagen – zwar drastische, doch überzeugende Antwort. Kein Verpackungsmaterial – einen solchen Niedergang der Geschäftssitten hätte sich Rudolf Manderla, als er 1935 seinen nachmals berühmten Fleischerladen im eigenen Haus eröffnete und zu einem der populärsten Einzelhandelsgeschäfte der Stadt machte, wohl nicht träumen lassen.