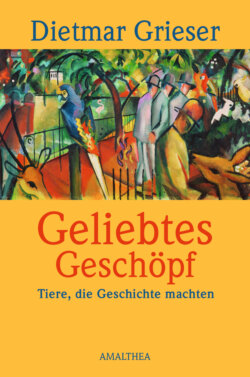Читать книгу Geliebtes Geschöpf - Dietmar Grieser - Страница 12
Lolita und die Schmetterlinge
ОглавлениеVladimir Nabokov auf der Pirsch
Ich weiß zur Not, was man unter einem Leptosomen versteht – aber auch nur, weil ich selber einer bin: ein Mensch mit schmalwüchsigem Körperbau. Aber wer oder was ist ein Lepidopterologe? Mein sonst so braver Brockhaus verweigert jede Auskunft, es ist ja auch ein wirklich kompliziertes (und unaussprechliches) Wort. Da hilft nur googeln. »Schmetterlingskundler« spuckt der Computer aus und nennt auch Namen, die in diesem Spezialfach der Zoologie Berühmtheit erlangt haben. Einer von ihnen ist ein Mann, den wir eigentlich als Dichter kennen – und zwar als Dichter von Weltrang. Nicht erst seit seinem Sensationserfolg von 1955, dem Romanbestseller »Lolita«, steht der Name Vladimir Nabokov für exquisite Sprach- und raffinierteste Erzählkunst. Kaum zu glauben, daß der gebürtige Russe und naturalisierte Amerikaner bei der Vergabe der Literaturnobelpreise regelmäßig leer ausgegangen ist.
Dafür ist er in seinem »Nebenfach«, der Lepidopterologie, mit Ehrungen überhäuft worden. Daß eine der von ihm entdeckten Schmetterlingsarten nach ihm benannt worden ist, zählt fast zu den Selbstverständlichkeiten. Auch in puncto Schachspiel, Boxsport und Änigmatik gilt Nabokov als Koryphäe. Doch »der edelste Sport der Welt«, so sagt er in einem Zeitungsinterview, ist für ihn die Schmetterlingsjagd. »Die Freuden und Genugtuungen der literarischen Inspiration«, bekennt er freimütig, »sind nichts im Vergleich zu dem Entzücken, unter dem Mikroskop ein neues Schmetterlingsorgan oder auf einem Berghang eine in der Fachliteratur noch nicht verzeichnete Spezies zu entdecken.«
Kein Opfer ist Nabokov zu groß, um seiner Leidenschaft zu frönen: Bis zu vierzehn Stunden sind es an manchen Tagen, die er dafür aufzuwenden bereit ist, und auch den dadurch bedingten Verdienstentgang nimmt er gern in Kauf. Als ihm 1977, wenige Wochen vor seinem Ableben, im Schweizer Nobelkurort Montreux Sohn Dmitrij einen seiner letzten Besuche abstattet, bricht der Achtundsiebzigjährige in Tränen aus – doch nicht des nahenden Todes wegen, sondern weil er sich darüber klar wird, daß er nun nicht mehr imstande sein werde, einen bestimmten Falter, dessen Flugzeit gerade begonnen hat, einzufangen, ihn zu betrachten, zu sezieren, die einzelnen Organe unters Mikroskop zu legen, mit dem obligaten Glyzerin zu präparieren, in das mit einem Gemisch aus Alkohol und Wasser gefüllte Glasröhrchen zu betten und dieses mit einem Etikett zu versehen, das über Ort und Stunde seines Fundes Auskunft gibt. Von solchen Wonnen kann der Sterbende nur noch träumen.
Wie hat es mit alledem begonnen?
Vladimir Nabokov, als erstes Kind seiner hochangesehenen und steinreichen Eltern am 22. April 1899 im alten St. Petersburg geboren, durchlebt, wie er später in einem Pressegespräch sagen wird, »die glücklichste Kindheit, die man sich vorstellen kann«. Zu dieser Kindheit gehört neben dem mit jeglichem Luxus ausgestatteten Palais im Zentrum der Millionenstadt ein 80 Kilometer von dort entferntes Landgut, auf dem die Familie ihre Sommer verbringt. »Wyra und seine Umgebung«, so zitiert Brian Boyd, der Autor der unübertrefflichen, zweitausendseitigen Nabokov-Biographie, den Dichter, »sind die Stätten, die ich über alles in der Welt liebe.« Das Herrenhaus ist von Tannen- und Buchenwäldern, von Wiesen und Mooren umgeben – einem Areal, das für einen aufgeweckten, neugierigen und auch zu einem gewissen Rowdytum neigenden Buben ein Paradies gewesen sein muß.
Das Haus selbst ist mit kostbarsten Schätzen angefüllt, unter denen die Schmetterlingssammlung des Vaters besondere Bedeutung genießt und ein eigenes Zimmer einnimmt. Ein Hauslehrer aus Deutschland ist es gewesen, der den Hausherrn in jungen Jahren mit jenem »Schmetterlingsfieber« angesteckt hat, das nun, Jahrzehnte später, auch auf den kleinen Vladimir übergreift. Er ist sieben Jahre alt, als er an einem wolkenlosen Sommertag – so schildert es Biograph Boyd – auf einer Heckenkirsche beim Haupteingang des Gutshofs »voller Entzücken einen leuchtend gemusterten Schwalbenschwanz erspäht«. Um ihn einzufangen, geht dem Buben der neben ihm stehende Hausmeister zur Hand: Vladimirs Mütze dient ihm als Schmetterlingsnetz. Doch das die Nacht über in einer der Garderoben geborgene Tier kann entkommen. Erst der zweite Versuch gelingt: Es ist ein sogenannter Schwärmer, eines jener Exemplare, die vor allem zur Dämmerstunde »unterwegs« sind. Diesmal ist es Vladimirs Mutter, die ihrem Sohn »assistiert«: Sie zeigt ihm, wie man das Insekt mit Äther tötet, wie man es zum Zweck der Aufbewahrung spannt und wie man es, säuberlich beschriftet, in einem gläsernen Behältnis birgt.
Die Leidenschaft ist geweckt: Der siebenjährige Vladimir geht nun regelmäßig auf die Pirsch, oft schon frühmorgens und bis zu fünf Stunden am Tag. An einem Schlechtwettertag macht er beim Durchstöbern einer Rumpelkammer einen weiteren wichtigen Fund: Er entdeckt einen Stapel Schmetterlingsbücher aus dem elterlichen Besitz. Klar, daß die »Beute« ins Kinderzimmer wandert und dort aufs gründlichste studiert wird. Zum Zeichen ihres Einverständnisses mit dem Hobby ihres Ältesten lassen die Eltern einen der renommiertesten Photographen von St. Petersburg nach Wyra kommen: Er soll Vladimir samt seiner größer und größer werdenden Sammlung im Bild festhalten.
Das mit der Schmetterlingsjagd zwangsläufig verbundene Töten der Tiere fällt Vladimir, dem jegliche Grausamkeit gegenüber der Kreatur ein Greuel ist, alles andere als leicht: Es ist halt der Preis, den er für seinen Forscherdrang zu entrichten hat. In späteren Jahren, als er bei der Beschäftigung mit den Schmetterlingen bereits hochwissenschaftlich vorgeht, wird er seine Fänge nicht mehr durch Eintauchen in carbonat-getränkte Baumwolle töten, sondern, dem Beispiel amerikanischer Sammler folgend, mittels eines Handgriffs, der binnen weniger Sekunden das Leben des Tieres auslöscht: Mit Zeigefinger und Daumen wird der Thorax zusammengedrückt.
Daß Nabokov mit dem stundenlangen Experimentieren unterm Mikroskop sein Augenlicht dauerhaft beschädigen wird, nimmt er ebenso hin wie die dramatischen Gewichtsverluste, die seine anstrengenden Pirschgänge und Kletterpartien zur Folge haben. Es wird Zeiten geben, wo er durch diesen Stress bis zu zehn Kilo verliert, was für den stämmigen und zuletzt auch korpulenten Mann allerdings auch von Vorteil sein kann.
Zurück nach Wyra – in die Zeit der Anfänge unseres Schmetterlingsjägers. Seine Aktivitäten zunächst noch auf die unmittelbare Umgebung des elterlichen Landsitzes beschränkend, weitet der Elfjährige mit der Zeit sein Revier aus. Man kann ihn nun also auch in den entlegeneren Wiesen und Wäldern herumstreifen sehen. Sogar in den kalten Herbstnächten ist er mit seinem Musselinnetz unterwegs, um Nachtfalter einzufangen. Damit sie ihm auf den Leim gehen, bestreicht er die Baumstämme mit Zuckerwasser. Und um seine Fachkenntnisse zu vertiefen, beschafft er sich die Adressen von Experten, denen er in Briefform seine Fragen vorlegt. Da Vladimir neben der Muttersprache Russisch auch Englisch beherrscht, abonniert er außerdem englische Fachblätter, deren Studium ihn ein Jahrzehnt später dazu befähigen wird, seinen ersten eigenen lepidopterologischen Forschungsbericht zu Papier zu bringen (der denn auch tatsächlich in der Zeitschrift »The Entomologist« abgedruckt werden wird). Während seine Spielkameraden draußen in der Natur die geeigneten Gelände für Räuber und Gendarm suchen, sondert er sich auf der Jagd nach seltenen oder gar neuen Schmetterlingen von ihnen ab und riskiert sogar, daß er für die Aussicht auf einen attraktiven Fund in einem Moor landet und dort bis zum Bauch im kalten Schlamm steht.
Unser Lepidopterologe ist keine zwölf Jahre alt, da tritt die Familie Nabokov eine Deutschlandreise an. Die drei Monate, die man in Berlin verweilt, nützt der Halbwüchsige dazu, einen Schmetterlingsladen aufzusuchen, von dem er gehört hat. Alle paar Tage spricht er in dem Geschäft im Stadtbezirk Charlottenburg vor, deckt sich mit den von ihm begehrten Exemplaren ein oder gibt, falls nicht auf Lager, die entsprechenden Bestellungen auf. Es kann ihm nicht rasch genug gehen: Immer wieder fragt er nach, ob die betreffende Lieferung schon eingetroffen ist.
Achtzehn Jahre später – Vladimir Nabokov lebt inzwischen auf Dauer in Berlin, hat in russischen Emigrantenblättern seine ersten schriftstellerischen Texte veröffentlicht und verdient sich mit Privatunterricht in Englisch und Russisch sowie Boxsport und Tennis seinen Lebensunterhalt – frönt er nicht nur weiterhin seiner Jagdleidenschaft, sondern nimmt auch einen Nebenjob im Dahlemer Zoologischen Museum an, wo man ihn die dortige Sammlung seltener Schmetterlinge klassifizieren läßt. Noch während des vorangegangenen Literaturstudiums am Trinity College der englischen Eliteuniversität Cambridge hat er die Veröffentlichung seiner ersten wissenschaftlichen Arbeit in Insektenkunde feiern können; sie fußt auf Erfahrungen, die er 1917 auf der Krim gemacht hat, wo die Nabokovs nach der Oktoberrevolution vorübergehend Zuflucht gefunden hatten.
Nabokov gewöhnt sich ans Emigrantendasein. Auf die Berliner Jahre, während deren er seine künftige Ehefrau, die russische Jüdin Vera Slonim, kennenlernt und mit fünfunddreißig Vater eines Sohnes wird, folgt 1937 die Flucht aus Nazi-Deutschland nach Frankreich. Auch hier, namentlich in der Umgebung des südfranzösischen Bergdorfes Saurat, sieht man ihn mit dem Schmetterlingsnetz die Gegend durchstreifen. Die Einheimischen trauen ihren Augen nicht, wenn sie den ihrer Meinung nach »Verrückten« beim Kraxeln über unbegehbare und schlangenverseuchte Bergpfade oder beim Waten durch reißende Flüsse beobachten.
Als es 1940, mit der drohenden Invasion der Hitler-Truppen, mit dem Frankreich-Aufenthalt vorbei ist und die notleidende dreiköpfige Familie schon für ihre Überfahrt nach Amerika rüstet, gilt es auch Abschied zu nehmen von Nabokovs mittlerweile riesiger Schmetterlingssammlung. In der Obhut eines Freundes zurückgelassen, der die in einer Korbtruhe verstauten Schaukästen im Keller seines Hauses versteckt, wird der Schatz beim Einmarsch der Deutschen entdeckt und brutal verwüstet werden.
Der Neuanfang in den USA gestaltet sich hoffnungsvoll – und zwar sowohl, was Nabokovs eigentlichen Beruf, die Schriftstellerei, wie auch sein aufwendiges Hobby betrifft. Ersteres sogar auf zweifache Weise: Kaum ist sein noch in Europa (und auf Englisch) verfaßter Roman »Das wahre Leben des Sebastian Knight« in Buchform erschienen, erhält der Zweiundvierzigjährige auch eine Dozentur für russische Sprache am Wellesley College in Massachusetts, die ihn und seine Familie die nächsten sieben Jahre ernähren wird. Parallel dazu gelingt es ihm, auch sein Hobby für einige Zeit zum Beruf zu machen: Die Forschungsabteilung des Museums für Vergleichende Zoologie der Harvard University überläßt dem Neubürger das Fachgebiet Lepidopterologie.
Mit Eifer stürzt er sich in die neue Arbeit. Dem Anlegen der Schaukästen für die zur Konservierung und Registrierung bestimmten Schmetterlinge gehen umfangreiche und bis ins kleinste Detail ausgetüftelte zeichnerische Dokumentationen voraus – eine zu gleichen Teilen wissenschaftliche wie künstlerische Aufgabe, die ihn so sehr begeistert, daß er darüber brieflich seinem alten Zeichenlehrer in St. Petersburg (aus dem 1924 Leningrad geworden ist) berichtet. Exkursionen führen ihn in weite Teile der USA; im Bundesstaat New Mexico, so schreibt Biograph Brian Boyd, »hätte man ihn um ein Haar eingesperrt, weil er die Bäume eines Farmers mit Zucker bestrich, um eine bestimmte Sorte Nachtfalter anzulocken.« Und im Yosemite Nationalpark habe er sich, vom Jagdfieber erfaßt, so weit vorgewagt, daß er sich urplötzlich einem (zum Glück schlummernden) Bären gegenübersah.
Auch, als Nabokov 1948 an der Cornell University im Staat New York eine Professur für russische und europäische Literatur antritt und zehn Jahre darauf Amerika mit seinem Roman »Lolita« in einen Schockzustand versetzt, führt er seine Forschungen zur Formenlehre, Verbreitung, Systematik und Ökologie der Schmetterlingsarten unbeirrt fort, läßt sein »fasziniertes Interesse für die Wunder und Feinheiten der Strukturen, die Erregung über Entdeckungen, die Geheimnisse der Metamorphose und die Möglichkeiten eines bewußten Plans hinter der Natur« zu keiner Zeit nach. Um Gattin Vera, die ihn auf seinen morgendlichen Pirschgängen begleitet, auf Trab zu bringen, stellt er sämtliche Uhren im Haus vor. Dabei sind die Schmetterlinge zu dieser Tageszeit noch gar nicht wach, lassen sich erst blicken, wenn das Gras nicht mehr naß ist vom Tau. Und kehrt er einmal ohne Beute heim, kann es passieren, daß er – auch dies verrät Brian Boyd – in Tränen der Enttäuschung ausbricht.
»Der edelste Sport der Welt« (Vladimir Nabokov über seine große Leidenschaft, die Schmetterlingsjagd)
Im November 1960 verlassen die Nabokovs Amerika und kehren nach Europa zurück. In Montreux am Genfersee finden sie ihren idealen Alterssitz, beziehen im 6. Stock des berühmten Palace Hotels eine ausgedehnte Suite, die eines verwöhnten und durch den Weltbestseller »Lolita« reich gewordenen Genies würdig ist. Auch hier geht er, sofern es das Wetter zuläßt, Morgen für Morgen auf Schmetterlingsjagd. Mit Seilbahn oder Sessellift erreicht er jene Höhen, wo er findig zu werden hofft; die anschließenden Fußmärsche können bis zu 15 Kilometer betragen. Doch im Sommer 1976 übernimmt sich der inzwischen Siebenundsiebzigjährige und stürzt bei einer Kletterpartie in 1900 Meter Höhe ab: »Sein Schmetterlingsnetz«, so lesen wir in der Nabokov-Biographie, »verfängt sich im Ast einer Föhre, er klettert dem Netz nach, stürzt ein zweites Mal und kann nicht mehr aufstehen. Er hat sich zwar nichts gebrochen, muß aber mehrere Tage im Bett zubringen.« Seinen Plan, im folgenden Jahr nach Israel zu fliegen, um auch die dortige Insektenfauna zu erkunden, muß der Dichter fallenlassen. Von der Idee, neben seinen schriftstellerischen Arbeiten auch zwei lepidopterologische Fachbücher zu verfassen (eines über die Schmetterlinge Europas und eines über Schmetterlinge in der Kunst), hat er sich schon lange vorher verabschiedet.
Am 2. Juli 1977 stirbt Vladimir Nabokov im Krankenhaus von Lausanne an einer Bronchialinfektion, im nahen Vevey wird der Leichnam beigesetzt. Bis zu seiner »Heimkehr« in die Geburtsheimat Rußland verstreichen volle zwölf Jahre: Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kann auf dem Landsitz Roshdestweno, 70 Kilometer südlich von St. Petersburg, den er kurz vor der Oktoberrevolution von einem Onkel geerbt hat, das seinem Andenken gewidmete Museum eröffnet werden.