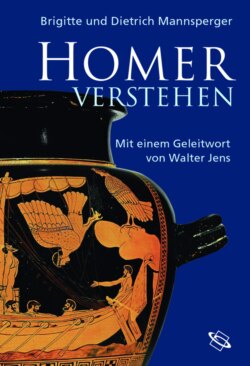Читать книгу Homer verstehen - Dietrich Mannsperger - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. DAS EPOS ALS GANZES Annäherung an den Gegenstand – das 1. Buch der Ilias
ОглавлениеDie erste Begegnung des Lesers mit dem Werk ist wichtig: Hier fällt die Entscheidung, ob man weiterliest, ob der Gegenstand Spannung, der Stil Gefallen, die Form Interesse erregt. Der Eingang der Ilias bietet von allem etwas:
„Mēnin aeide theā Pēlēiadeō Achilēos“,
„Den Zorn singe, Göttin, des Peleussohnes Achilleus“.
Vorwort
Der traditionelle Name des Gedichts lautet „Ilias“, „Gedicht über die Stadt Ilios“, doch erst in Vers 19 ist von der „Stadt des Priamos“, in Vers 71 von „Ilios“, in Vers 129 von „Troia“ die Rede. Der Dichter bittet hingegen im ersten Satz eine Göttin, den verderblichen Zorn und Groll eines Mannes zu besingen, der vielen Helden den Tod brachte. So wurde der Plan des Zeus erfüllt, infolge eines Streits zwischen dem Männergebieter Agamemnon und dem göttlichen Achill. Sieben Verszeilen in äußerst knapper Konzentration umreißen die eigentliche innere Thematik des Epos, die schicksalhaften Folgen menschlicher Leidenschaften unter Lenkung der Götter, der eigentliche Schauplatz wird als bekannt vorausgesetzt.
Einstieg in die Handlung
Nach diesem Eröffnungsakkord zur Einstimmung geht es unmittelbar hinein in die Handlung. Die zwei Hauptakteure Achill und Agamemnon sowie der leitende Gott Zeus sind im Prooimion genannt, doch nun erweckt eine Frage nach den Ursachen besondere Neugierde: Wer von den Göttern trieb sie zum Streit? Der Sohn Letos und des Zeus zürnte dem König und sandte eine Seuche über das Heer, weil dieser, der Sohn des Atreus, den Priester Chryses verunehrt hatte. Der nämlich kam zu den Schiffen der Achäer mit reichem Lösegeld für seine Tochter, die heiligen Binden Apollons in Händen, und flehte die Achäer insgesamt, vor allem jedoch die beiden Heerführer, die Atriden, an.
Szenerie
Knappe zusätzliche Informationen verdeutlichen damit in rückschreitender Enthüllung Szenerie und Situation; ein Heer, ein Schiffslager ist da unter dem Befehl der Atriden, heimgesucht von der göttlichen Strafe einer Epidemie. Der knappe Bericht steigert sich zur wörtlichen Rede und Gegenrede von König und Priester: Der Priester wünscht den Achäern göttlichen Segen für die Eroberung von Priamos’ Stadt und glückliche Heimkehr, fordert sie jedoch auf, die Tochter freizugeben für Lösegeld, aus Scheu vor Apollon. Alle anderen stimmen zu, doch Agamemnon schickt den Alten unter Drohungen weg: „Verschwinde und reize mich nicht, sonst passiert dir was …“ Den Oberfeldherrn verführt das Gefühl der Allmacht und Würde zur Miss achtung göttlicher Satzung. Der Priester geht schweigend zum einsamen Meeresstrand und bittet seinen Gott in kultisch-zeremonieller Anrufung um Rache.
Apollon mit dem Silberbogen — Ausbruch des Zorns — Athenes strahlendes Auge — Parallelhandlung
Der erhört ihn und steigt herab vom Olymp, zürnend und finster wie die Nacht, klirrend von Waffen. Die erste Vision eines leibhaftig agierenden Gottes tritt uns entgegen, beschworen durch wenige optische und akustische Merkmale. Unter dem schrecklichen Klang des silbernen Bogens sterben Tiere und Menschen, neun Tage lang brennen die Totenfeuer, bis am zehnten wieder ein Gott eingreift: Hera, besorgt um die Danaer, veranlasst Achill zur Einberufung einer Volksversammlung und Seherbefragung. Kalchas, der die Flotte nach Ilios gelenkt hatte, erbittet und erhält von Achill Rückendeckung gegen Agamemnon, ehe er diesen als Schuldigen benennt und zur Rückgabe des Mädchens auffordert. Der Herrscher, ergrimmt über den Unglückspropheten, erklärt sich zwar zum Nachgeben bereit, fordert jedoch eine Entschädigung. Die äußerst gespannte Atmosphäre entlädt sich unter beständiger Steigerung in einem doppelten Wortwechsel Achill – Agamemnon, Achill – Agamemnon: „Habgierigster von allen“ – „Betrüger“ – „Schamloser Egoist“ – „Verhasster Aufrührer“. Agamemnon wird seine Ehrengabe, die Sklavin Chryseis, zurückgeben, aber dem Achill die seinige, Briseis, wegnehmen. Damit ist der Höhepunkt des ersten Buches, das Zentralmotiv der Dichtung, erreicht. Die mēnis des Achill hat szenische Gestalt gewonnen. Der Zwiespalt im Herzen des Wütenden – Mord und Totschlag oder Selbstbeherrschung – wird durch göttliches Eingreifen entschieden. Wieder ist es Hera, um beide besorgt, die nun Athene entsendet. Achill, der schon die Waffe gegen Agamemnon zückt, erkennt die Göttin am strahlenden Auge, beugt sich ihrem besänftigenden Rat und stößt das Schwert zurück in die Scheide, in der allgemeinen Erkenntnis: „Wer den Göttern gehorcht, den erhören sie wieder.“ Stattdessen bekräftigt er seinen Entschluss beim herrschaftlichen Zepter, das er symbolisch zur Erde niederwirft. Selbst der nun erstmals auftretende weise Nestor kann in weit ausholender Rede die Streitenden nicht besänftigen; Achill zieht sich mit dem Gefährten Patroklos in sein Lager zurück, Agamemnon entsendet den klugen Odysseus mit einem Schiff, um die Tochter des Chryses zurückzubringen, und zwei Herolde, um dem Achill die Briseis wegzunehmen. Diese beiden gleichzeitig ablaufenden Handlungen werden nacheinander verfolgt: Das Schiff entschwindet auf dem Meer, das Geschehen im Lager läuft weiter; Achill gibt die Briseis heraus, die nur ungern von ihm scheidet, zieht sich unter Tränen an den einsamen Meeresstrand zurück und ruft seine Mutter, die Meergöttin Thetis, an. Die taucht auf aus der Tiefe wie ein Nebel, streichelt ihn und fragt nach seinem Kummer: „Kind, was weinst du …“ Achill referiert das Geschehen in längerer Rede, schildert seine Entehrung und bittet die Mutter darum, ihren Einfluss bei Göttervater Zeus für ihn zu verwenden: Der soll den Troern Sieg verleihen, die Achäer ans Meer zurückwerfen und Agamemnon zur Erkenntnis seiner Verblendung (atē) bringen. Thetis weiß um den frühen Tod ihres Sohnes und verspricht ihm wenigstens jetzt Genugtuung: Zwar sind Zeus und ihm folgend die anderen Götter für elf Tage auf Besuch zu den fernen Aithiopen gegangen, doch am zwölften will sie nach seiner Rückkehr auf dem Olymp flehend seine Knie umfassen. Damit verlässt die Göttin den einsam Grollenden, und die Erzählung nimmt nun die eingeleitete Odysseushandlung auf: Die Fahrt des Schiffes vom Achäerlager zum Hafen von Chryse, Ankerwerfen und Ausschiffung, Übergabe der Chryseis an ihren Vater und der Sühnehekatombe an Apollon, Gebet des Priesters und dessen Erhörung, Opfer, Mahl, Tanz und Festgesänge zur Freude des Gottes füllen den Lauf des Tages, bei Sonnenuntergang legt man sich am Schiffsheck zum Schlafe nieder, mit der Morgenröte geht es zurück zum Schiffslager, der günstige Wind Apollons bläht die Segel, und die Welle rauscht um den Kiel. Mit den Heimkehrern findet der Leser zurück zum unablässig grollenden Achill, der nicht an Ratsversammlung oder Kampf mehr teilnahm, so sehr er sich danach sehnte.
Raum und Zeit — Gewährungsnicken des Zeus — Götter unter sich
Die detailreich und doch zügig geschilderte Sühnemission des Odysseus dauert nur gut einen Tag und eine Nacht; die reale Entfernung des Apollonheiligtums von Chryse zum Schiffslager vor Ilios wird dadurch nachvollziehbar, der geographische Handlungsraum des Epos präziser umrissen. Die zeitliche Parallelität der Handlungsstränge wird nicht pedantisch nachrechenbar gemacht, sondern stimmungsmäßig überspielt; die elftägige Handlungspause während der Abwesenheit der Götter ist nicht mit Aktion gefüllt, sondern sie dient zur Vergegenwärtigung der qualvollen Selbstzerfleischung des zürnenden Helden. Erst am Morgen des zwölften Tages setzt die Haupthandlung wieder ein, die nun ganz auf dem Olymp, im Kreise der Götter spielt: Zeus ist zurück, Thetis erinnert sich ihres Auftrags, taucht auf aus dem Meer in aller Frühe, findet den Himmelsgott einsam sitzend auf der höchsten Bergspitze und fleht ihn an: „Gib meinem Sohn, dem Todgeweihten, die Ehre zurück!“ Zeus schweigt, und Thetis beginnt ein zweites Mal: „Gib mir eine deutliche Zusage, oder verweigere sie!“ Da fährt der Wolkenversammler auf: „Soll ich mich mit Hera verfeinden? Schnell geh weg, damit sie nichts merkt, ich nicke dir Gewährung!“ – sagte es, und mit dunklen Brauen nickte der Kronide, und die göttlichen Locken wallten vom unsterblichen Haupt des Herrschers, den großen Olymp erschütternd. In der anschließenden Götterversammlung bricht dann der Ehestreit los: Hera hat alles bemerkt, Zeus droht ihr mit Gewalt. Die Götter murren, Hera erschrickt, doch der gemeinsame Sohn Hephaistos besänftigt sie, indem er Nektar ausschenkt und an eigene Erfahrungen mit dem mächtigen Vater erinnert. Was sollen sich Götter wegen Sterblicher streiten? Hera lächelt und trinkt, unauslöschliches Lachen erhebt sich unter den glückseligen Göttern beim Anblick des den Saal durchkeuchenden Hephaistos. Den ganzen Tag bis Sonnenuntergang schmausten sie im Saale, Apollon spielte und die Musen sangen, bis sie alle sich zu süßem Schlafe legten, Zeus bei der goldthronenden Hera.
So löst sich die Düsternis menschlicher Verblendung (atē), die sich zum Zorngeschehen (mēnis) steigert und mit dem Nicken des Zeus als Höhepunkt die Handlung der Dichtung einleitet, auf der göttlichen Ebene nach Überwindung interner Spannungen in überlegener, olympischer Heiterkeit. Der Stimmungsbogen des ersten Gesangs schließt versöhnlich im Einklang mit dem natürlichen Tagesablauf, die später kanonisierte Bucheinteilung folgt hier wie meist den vorgegebenen kompositorischen Einschnitten des Dichters.
Erste Eindrücke
Wer der Entfaltung des epischen Geschehens bis hierher gefolgt ist, sei es am Urtext, in metrischer oder Prosa-Übersetzung oder im parallelen Vergleich von beiden, dem sind bereits wichtige Wesenszüge homerischer Dichtung entgegengetreten. Versform und Rhythmus, Sprache und Wortwahl sind allgegenwärtig und schon das Vorwort (Prooimion) stellt spezifische Gestaltungselemente vor. Hier bedarf es göttlichen Beistandes, denn es geht nicht um Alltägliches: Musenanruf. Hier werden keine fortlaufenden Geschichten von Helden erzählt, sondern es geht um die Problematik und Folgen ihrer Emotionen und Leidenschaften: Zorn des Achill. Die Hervorhebung eines solchen Hauptmotivs erfordert den spontanen Einstieg in die Handlung, den Sprung medias in res. Eine gewisse Kenntnis der Personen, der Schauplätze und der Vorgeschichte kann bei Zeitgenossen und Nachwelt vorausgesetzt werden. Bekannt oder nicht, ihre schrittweise Einführung, Entfaltung und Ergänzung durch Rückgriff, Nachtrag und Einblendung schaffen Spannung, Überraschung oder Wiedererkennungsfreude, jedenfalls erzählerische Abwechslung und Tiefgang. Dem gleichen Zweck dient der virtuose Wechsel der Darstellungsmittel. Bericht geht über in direkte und indirekte Rede, Wortwechsel und Schimpfkanonaden tragen bei zur Charakterisierung der Personen, gleichzeitige Handlungen überlagern sich bei wie derholtem Wechsel des Schauplatzes. Bisweilen steigert sich eine Rede zur prägnant zugespitzten Lebensregel.
Hintergründe des Geschehens
Die Konzentration auf psychologische Affekte als Triebkräfte und Ursachen des Geschehens führt in philosophisch-theologische Fragestellungen hinein. Die Unterworfenheit unter die Aufwallungen der Leidenschaft (thymos), die Gier nach Ehre (time), Überheblichkeit (hybris), Verblendung (atē), Groll und Zorn (mēnis, cholos) sind Ausdruck menschlicher Unvollkommenheit, bei den Heroen der Vorzeit gewinnen auch sie übermenschliche Dimensionen. Hier im Bereich des Unbewusst-Dämonischen wirken die Götter: Die Verblendung des Agamemnon und der Zorn des Achill sind eingebaut in die Planung des Zeus (boulē). Apollon, Hera und Athene, schließlich auch Thetis und Hephaistos, greifen ein, mahnend, strafend oder besänftigend. Den Menschen erkennbar sind sie dabei nur an markanten Zeichen, im Klang des Silberbogens, am strahlenden Blick der Augen, als Meeresnebel, selbst Zeus manifestiert sich in seiner Majestät vor allem im Wallen des Haupthaars. Das Eingreifen der Götter in menschliches Handeln wird oft auf ihre Gunst und Missgunst zurück geführt, sie selbst werden vermenschlicht. Auch zu Hause auf dem Olymp kann es offensichtlich interne Spannungen geben, Familienzwist und Ehekrach, doch bald findet man zurück in die gelöste und heitere Sphäre eines höheren Götterlebens, im unauslöschlichen Gelächter.