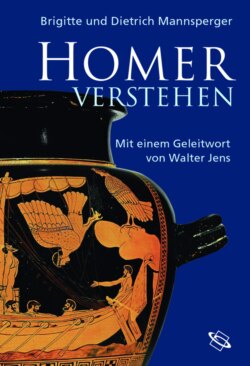Читать книгу Homer verstehen - Dietrich Mannsperger - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gliederung, Komposition und Handlungsführung
ОглавлениеAnalyse des Großepos
Das Großepos als literarische Vorform des Romans verlangt eine klar erkennbare Thematik, Gliederung und Handlungsführung, wenn es Unübersichtlichkeit und Monotonie vermeiden soll. Ilias und Odyssee mit ihren rund 16.000 und 12.000 Versen haben nicht zuletzt deshalb ihre Attraktivität durch die Zeiten hindurch bewahrt, weil sie diese Voraussetzungen in vorbildlicher Weise erfüllen. Über die Voraussetzungen und Praktiken, wie und zu welcher Zeit diese Einheit entstanden ist, gab es lange Auseinandersetzungen, die auch mit der Frage nach dem Dichter, den Dichtern oder den Redaktoren zusammenhängen. Die sorgfältigen Beweisführungen der „Analytiker“ einerseits und der „Unitarier“ andererseits haben alle ihren Anteil zur Erhellung des Gegenstandes beigetragen, so dass wir uns diesem heute mit geschärftem Blick zuwenden können. Die Betrachtung der äußeren Gliederung wird dabei mehr dem analytischen, die der kompositorischen Linienführung mehr dem unitarischen Ansatz verpflichtet sein.
Funktion des Proömiums
Ein antikes Literaturwerk hat von sich aus keinen eigentlichen Titel. Als solcher dient gewöhnlich der erste Satz, bei Ilias und Odyssee ist es das sog. „Prooimion“, der „Vorspruch“, ein Wort, das auch eine Gebetsanrufung wie die homerischen Götterhymnen bezeichnen kann. Ihre Doppelfunktion als Titel und Themaangabe sowie als Bitte um göttlichen Beistand zur Bewältigung der gewaltigen Aufgabe erfüllen die Proömien beider Epen perfekt. Die Stichworte „Zorn“ und „Mann“ stehen am Anfang, sofort wird näher erläutert, wessen Zorn es war und was er bewirkte und wer der Mann war, dessen Charakter und Schicksale so denkwürdig sind.
Thematik und Methode — Musenanruf eröffnet Zugang zu höherer Einsicht
Mit dem „Zorn des Peliden“ und jenem „vielgeprüften Mann“ sind zugleich die beiden Haupthelden vorangestellt, aber ihre eigentlichen Namen Achill und Odysseus werden erst in den Versen 1 und 7, bzw. 21 eher beiläufig erwähnt. Damit ist klar zum Ausdruck gebracht, dass ein Grundwissen um den Mythos vorausgesetzt wird, und das Hauptinteresse des Dichters kein stoffliches, sondern ein psychologisch-ethisches ist: Wohin führt die ungezügelte Emotion, und mit welchen Fähigkeiten kommt einer durch die Fährnisse des Lebens, und dies jeweils an einer dem Alltag entrückten vorzeitlichen Heldengestalt exemplifiziert. Neben der eigentlichen Thematik wird im Proömium auch die methodische Vorgehensweise angesagt. Das Epos soll einen künstlerisch komponierten, gerafften Ausschnitt aus dem präexistenten Mythenkontinuum geben, wo sich ein jeder den ihn interessierenden Stoff herausgreifen kann, wie es auch viele Vorgänger wohl schon getan haben. In der Odyssee heißt es ausdrücklich: „Von dem allem, von einem bestimmten Punkt aus einsetzend, sage uns, Göttin“, und der Beginn der Erzählung bezeichnet diesen Punkt genau: „Da waren die anderen alle schon zu Hause …“ Auch die Ilias nennt den Moment des Einstiegs ausdrücklich: „Singe den Zorn, Göttin … von da an, wo die beiden zuerst im Streit sich entzweiten …“ (Od. 1,10f.; Il. 1,1; 6). Dieses Hineinspringen in den Stoff kann nicht zufällig geschehen, sondern es bedarf einer höheren künstlerischen Einsicht, die von der Muse erbeten wird. Die göttliche Hilfe muss sich jedoch auch auf die Gestaltung der durchgehenden Kompositionslinien erstrecken, denn hinter allem Geschehen steht letztlich ein göttlicher Plan: „Der Plan des Zeus wurde vollendet“, heißt es für die Ilias, und in der Odyssee entwerfen Zeus und Athene in der Götterversammlung ihre Pläne, die anschließend für die kunstvolle Handlungsführung des Epos maßgeblich werden (Il. 1,5; Od. 1,81–95). Um diesen höheren Willen können nur göttliche Wesen wissen, deshalb steht am Anfang der Proömien der Musenanruf, auf den der Dichter auch in anderen kritischen Situationen des Geschehens zurückgreifen wird.
Offener Epenschluss und Ausschnittcharakter — Abschluss des Themas, nicht Ende der Geschichte
Der Eingang der Gedichte dient also zugleich der Schürzung des Knotens, aus dem die einzelnen Handlungsstränge entspringen sollen. Der Ausgang andererseits lässt durch ein fast abruptes Abbrechen im Text den Ausschnittcharakter der behandelten Ereignisfolge erkennen. „So begingen sie die Bestattung des Pferdebändigers Hektor …“, schließt unsere Ilias, „Friedensschluss zwischen beiden bewirkte Pallas Athene, dem Mentor gleichend an Gestalt und Stimme …“ die Odyssee. In einigen Handschriften endet der Vers von Hektors Bestattung mit dem Zusatz „dann kam die Amazone“, ein deutliches Zeichen dafür, dass die Geschichte weiterging, dass prinzipiell eine Fortsetzung möglich war. Das Eingreifen der Amazonenkönigin Penthesilea auf Seiten der Trojaner war ebenso wie das des Äthiopen Memnon im Mythos – vielleicht auch schon in dichterischer Form – vorgegeben, und die Epen des sog. „Kyklos“ haben alles in chronologischer Reihenfolge erzählt. Erhalten geblieben sind diese zyklischen Fortsetzungen jedoch nur in trockenen Nacherzählungen der Spätantike, ein deutliches ästhetisches Werturteil. Auch Goethe hat sich durch das „offene Ende“ zur Fortführung der Ilias animieren lassen und gleichsam den heraushängenden Handlungsfaden aufgegriffen. Der Anfang seiner „Achilleis“ beginnt mit dem Brand von Hektors Scheiterhaufen: „Hoch zu Flammen entbrannte die mächtige Lohe noch einmal …“, aber das geplante Epos kam über 651 Verse nicht hinaus. Ein möglicher Fortsetzungsfaden für die Odyssee wird schon früher im Gedicht angedeutet, wenn der Seher Teiresias in die weitere Zukunft des Helden blickt (Od. 11,121–137). Der Überraschungseffekt des knappen unprätentiösen Epenschlusses darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das eigentliche Thema in der Handlung abgeschlossen und zur Ruhe gekommen ist, der Zorn des Achill und die Heimkehr des Odysseus. Dass diese Heimkehr erst mit der Beilegung des politischen Konflikts auf Ithaka ein harmonisches Ende findet, haben alle diejenigen übersehen, die ein märchen- oder romanhafteres Ende vorgezogen haben und die ursprüngliche Odyssee mit den Versen 23,342f. enden lassen wollten: „Dies war das letzte Wort, das er erzählte, als ihn der gliederlösende Schlaf überfiel und ihm die Kümmernisse vom Herzen löste“. Die knappen vielsagenden Dramenschlüsse Schillers, „Dem Manne kann geholfen werden …“, „Dem Fürsten Piccolomini …“, „Er ist zu Schiff nach Frankreich …“, verraten in ihrer aperçuhaften Zuspitzung das homerische Vorbild. Auch sie wollen keine wirkliche Fortsetzung einleiten.
Die in den Proömien umrissenen eigentlichen Themen beider Epen finden sich in den uns geläufigen Titeln nur bedingt wieder. Bei der Odyssee mag dies noch zutreffen, doch die Ilias verdankt ihren eher irreführenden Namen der Tendenz des Großepos, den aus einem Zusammenhang herausgenommenen überschaubaren Ausschnitt so auszuweiten, dass er doch wieder das Ganze in sich aufnimmt. Genau genommen handelt es sich um ein Gedicht vom Zorn des Achill, nicht um eine „Achilleis“, und schon gar nicht um die Darstellung des Krieges um Ilios.
Kurztitel zur Verständigung
Dennoch ist das gesamte Schicksal des Helden wie der Stadt im Hintergrund präsent und verleiht so den vordergründig geschilderten epischen Ereignissen Tiefgang und Sinn. Auf den zweiten Blick ist also die Bezeichnung „Ilias“ als griffige Wiedergabe dieses weiteren Horizonts dann doch verständlich, eine Parallelbildung der antiken Philologie neben Namen wie „Thebais“ oder „Aithiopis“ für Epen mit Bezug auf die Stadt Theben oder den Aithiopen Memnon.
Episode oder Einzellied?
Auch für in sich geschlossene Passagen und Episoden innerhalb der Epen hat die spätere Tradition solche kennzeichnenden Kurztitel gebraucht. So sprach man von „Boiotia“ für den Schiffskatalog des zweiten Buchs der Ilias, weil dieser in Böotien beginnt, von der „Teichoskopie“ (der „Mauerschau“) im dritten, der „Aristie des Diomedes“ im fünften, der „Homilie“ („Begegnung“) von Hektor und Andromache im sechsten oder auch der „Dolonie“ im zehnten Buch, obwohl der feige Dolon kaum als Hauptfigur der Episode gelten kann. Entsprechend werden in der Odyssee u.a. die Polyphemgeschichte als „Kyklopeia“, der Gang in die Unterwelt als „Nekyia“ und die Fußwaschungsszene als „Niptra“ bezeichnet. Auf diese Weise lassen sich besonders spannende und beliebte Partien aus dem Zusammenhang herausgreifen, die sich für einen kürzeren Vortrag eignen und vielleicht auch von besonderer Aktualität sind. So wünscht sich Odysseus bei den Phäaken ein Lied über das hölzerne Pferd, und der Sänger Demodokos beginnt nach einer Gottesanrufung „von da an, wo die Argeier abfuhren und das Pferd mit Odysseus und seinen Gefährten im Innern schon auf der Akropolis der Trojaner stand“, also nicht ganz von vorne mit seinem Bau, sondern im kritischen Moment der Entscheidung (Od. 8,500–503). Dieses „von da an beginnend“ entspricht dem „von irgendwo aus“ am Anfang der Odyssee und verdeutlicht nochmals das Kunstmittel des Einstiegs medias in res und der effektvollen Schürzung einer Episode.
Einheit von Dichter und Werk?
Die Reihenfolge solcher Abschnittstitel konnte zugleich als vorläufiges Inhaltsverzeichnis und Hilfsmittel einer äußerlichen Gliederung des Großepos dienen, ehe die antiken Philologen die heute noch gültige Bucheinteilung vornahmen. Diese Einteilung folgt nicht immer den inhaltlichen Themen, da sie auch auf das Einheitsmaß der Buchrollen Rücksicht nehmen musste. Aus diesem Grunde blieben die eingängigen Bezeichnungen thematischer Einheiten auch weiterhin in den Handschriften im Gebrauch, und gerade sie waren es, die der „Liedertheorie“ und anderen Ansätzen der Analytiker entgegenkommen mussten. Immerhin schien es doch plausibel, dass der Schiffskatalog, die Gesandtschaft (presbeia) oder gar die Dolonie der Ilias ursprünglich selbstständige Einheiten oder spätere Einschübe waren, die von einem Redaktor oder auch Dichter zusammengefügt wurden, oder dass die Odyssee aus einem Irrfahrtenbericht, einem Heimkehrergedicht und als jüngstem Bestandteil der „Telemachie“ zusammenwuchs. Sobald man erst mit der Herauslösung einzelner Teile begonnen hatte, kam man durch die Beobachtung von festen Formeln, Wiederholungen, Dubletten, Handlungsfugen, inhaltlichen, stilistischen und kulturellen Widersprüchen zu immer kleineren Einheiten. Der Dichter Homer, von dem man schon in der Antike so gut wie nichts, kaum den richtigen Namen wusste, löste sich damit gleichermaßen auf wie das Werk. An seine Stelle traten der dichtende Volksgeist, die Tradition der Liederdichter und Rhapsoden oder die improvisierenden Formelsänger der „mündlichen Dichtung“, im Gegenzug dann wieder eine kleinere Gruppe von zwei oder drei Dichtern, Schriftstellern oder Redaktoren. Eine wichtige Rolle spielte die Frage der Schriftlichkeit: Gab es überhaupt Schrift in so früher Zeit, und damit die Möglichkeit zur Komposition und Niederschrift umfangreicher Texte? Die Entdeckung der kretisch-mykenischen Schriftsysteme und Tontafelarchive sowie die Aufhellungen der Frühgeschichte des griechischen Alphabets brachten hier wieder mehr Zuversicht, so dass man sich einer intensiveren Beobachtung der durchgehenden Linien und Zusammenhänge zuwenden konnte.
Leitmotive der Handlungsführung
Auch dieses vereinheitlichende Element des Epos ist bereits im Proömium angedeutet, wenn jeweils ein Leitmotiv herausgestellt und das göttliche Planen erwähnt wird. Wie die Formelhaftigkeit, die inhaltliche Buntheit und der episodische Charakter dem methodischen Ansatz der Analytiker entgegenkommen, so bringt die Observation der bewusst angewandten einheitlichen Kunstmittel sowie das Nachzeichnen der Handlungsstränge und Motivketten, der Vorausdeutungen und Rückgriffe Unterstützung für den Standpunkt der Unitarier. Für ein umfangreiches Großepos, wie immer auch es entstanden sein mag, wird die Strukturbetrachtung unter gene tischem Aspekt die am meisten angemessene sein. Wo unterschiedliche Bestandteile komponiert und eingebaut werden müssen, da entsteht automatisch auch die Notwendigkeit eines erkennbaren Bauplans und wegweisender Leitlinien, wenn überhaupt die bloße Addition vermieden werden soll.
Das Hauptgeschehen in Ilias und Odyssee erwächst jeweils aus den in den Proömien genannten Kern- oder Leitmotiven. Dies ist zum einen der Zorn des Achill und seine Folgen, vor allem die Niederlage der Achäer, und zum anderen die zehnjährige Abwesenheit des Odysseus mit ihren Folgen, dem Chaos auf Ithaka. Diese aus sich heraus interessanten und dramatisch ergiebigen Krisensituationen produzieren die vordergründige Rahmenhandlung mit ihrem Auf und Ab, ihren gegenläufigen Bewegungen und Parallelaktionen. Das unversöhnliche Zürnen des Vorkämpfers im Schiffslager und das Freierchaos auf Ithaka sind latent im Hintergrund immer vorhanden, sie werden mit allerlei Tricks in Erinnerung gebracht und ins Vordergrundgeschehen hineingespiegelt, die Stadien ihrer Entwicklung mit den möglichen Auswirkungen auf die Haupthandlung an wichtigen Schlüsselstellen signalisiert.
Zorneslinie als fester Rahmen
Auf seinen Höhepunkt kommt der Zorn des Achill bereits mit seinem Ausbruch im 1. Buch der Ilias, wo er im Gespräch mit Thetis einmündet in die Planungen des Zeus: Der soll seine Ehre wieder herstellen und die Hybris Agamemnons bestrafen. Die Göttin verlässt ihren Sohn in seiner Wut über den Verlust der Geliebten, und mit ihr der Leser, der nun über mehr als 50 Verse den Odysseus auf seiner Fahrt nach Chryse begleitet, bis er zu dem dauerhaft Zürnenden zurückkehrt (Il. 1,427–492). Danach tritt das wechselhafte Kampfgeschehen in den Vordergrund, erst mit den Siegen der Achäer, wo man den Achill fast zu vergessen scheint, dann mit den Siegen der Troer, als man sich der Zeiten erinnert, als Achill noch kämpfte und Hektor sich kaum zum Tor hinauszugehen traute (z.B. Il. 5,788–791). Auf dem ersten Höhepunkt der Niederlagenserie der Achäer im 9. Buch, als Achill anlässlich der Bittgesandtschaft vorübergehend wieder in den Vordergrund der Handlung tritt, gewinnt der Zorn erneut eindringliche Gestalt, allerdings zum Schluss ganz leicht gemildert, wenn die angedrohte endgültige Heimfahrt erst mit Bedenkzeit auf den Folgetag verschoben und dann sogar der Brand der Schiffe als Kriterium für eine eventuelle Wiederaufnahme des Kampfes genannt wird (Il. 9,618–655). Als dieser äußerste Fall dann eingetreten ist, stellt ein Botengang des Patroklos wieder, wie schon im 11. Buch, die Verbindung zu dem in seiner Behausung Zürnenden her, doch der kann sich nur zu einem halbherzigen Zugeständnis aufraffen, indem er den Freund in seinen Waffen entsendet (Il. 16,1–256). Nach dessen Tod wird der Zorn hastig und eher äußerlich beigelegt, verwandelt sich vielmehr in einen rasenden Rachezorn, der die Bücher 18–22 mit wenigen zwischengeschalteten Ruhepausen erfüllt und erst nach dem Zwischenspiel der Wettkämpfe des 23. im 24. Buch zur Ruhe kommt.
Diese Zorneslinie bildet zugleich den Rahmen für das Epos, mit einem ersten Akzent zu Anfang und dem breiten Ausklang in der zweiten Hälfte. Eine ähnliche Funktion und Proportion hat das Motiv der chaotischen Zustände auf Ithaka in der Odyssee. Auch sie werden bereits im 1. Buch eindringlich vorgeführt durch den mit der Zeusplanung verbundenen Besuch der Athene beim kaum erwachsenen Sohn im herrenlosen Palast und dann während der Reise des Telemachos bei den Gesprächen in Pylos und Sparta immer wieder berührt (Bücher 2–4). Danach tritt das Heimkehrgeschehen, der „Nostos“ des Odysseus, ganz in den Vordergrund, zunächst als direkte Handlung, dann im Rückgriff als Erzählung des Helden selbst (Bücher 5–12). Die wichtigste Brücke und Querverbindung zwischen beiden Handlungssträngen findet sich am entrücktesten Punkt der Irrfahrten, in der Unterwelt, wo Odysseus zum ers ten Mal Näheres über die Zustände zu Hause erfährt, zuerst aus dem Munde des Sehers Teiresias und dann im Gespräch mit einer Augenzeugin, der Seele seiner inzwischen verstorbenen Mutter Antikleia (Od. 11,115–120; 170–203).
Rahmendes Hauptthema der Odyssee — Kompositionsschwerpunkt im letzten Drittel
Mit dem Erwachen des Odysseus am Strand von Ithaka im 13. Buch, also kurz nach der Mitte des Epos, beginnt die Dominanz des Hauptthemas, und zwar mit einer schrittweisen Annäherung: Erst einmal muss der Heimkehrer die fremdgewordene Heimat wieder erkennen, dann erfährt er im 14. Buch im Gehöft des Eumaios das Neueste über die Entwicklung in der Stadt. Im folgenden 15. Buch erfolgt die Verknüpfung der im 4. Buch verlassenen Nebenlinie, der Reise des Telemachos, mit der Haupthandlung: Telemachos kehrt glücklich zurück, nachdem er dem Mordanschlag der Freier entkommen ist. Auch deren Ausfahrt und Lauerstellung im Hinterhalt bei der Insel Asteris, die ebenfalls im 4. Buch als weitere Parallelhandlung eingeführt worden war, hat der Dichter nicht vergessen. Im anschließenden 16. Buch, nachdem sich Odysseus und sein Sohn erkannt und zusammengefunden haben, kehrt auch das Schiff der Freier unverrichteter Dinge zurück, und nun sind alle Akteure und Handlungsfäden auf Ithaka zum großen Finale vereint. Dieser abschließende Schwerpunkt der Komposition, der Sieg des Heimkehrers über die Aufrührer und ihre Angehörigen mit anschließender Friedensstiftung der Göttin Athene füllt die Bücher 17–24, also ähnlich wie in der Ilias das letzte Drittel des Epos. Die Ereignisse auf Ithaka geben den äußeren Rahmen ab für die eingelegte Irrfahrtenerzählung, die ihrerseits wieder in Rahmenhandlung und Ich-Erzählung des Odysseus gegliedert ist. Diese Kunstform der „Rahmenerzählung“ hat von der Odyssee ausgehend in der Weltliteratur begeisterte Nachfolge gefunden, aber anders als Boccaccio, Goethe oder Hauff weiß Homer das angemessene Gleichgewicht zwischen den Bestandteilen zu wahren. Hier ist der Rahmen nicht Vorwand für die Aneinanderreihung unterschiedlicher Geschichten, sondern er trägt das volle Gewicht der Haupthandlung, und die Einlagen behaupten sich dagegen durch ihre phantastische Buntheit. Dass dabei die Herkunft des Ganzen aus verschiedenen ursprünglichen Bestandteilen ein entschiedenes Mitverdienst hat, steht außer Zweifel. Die erkennbare Virtuosität, mit der alles zusammengefügt ist, macht es jedoch unwahrscheinlich, dass Zufall oder bloße Kompilation bei der Genese beteiligt waren.
Der Plan des Zeus — Die Zeus-Vorhersage — Ausblicke und Rückgriffe
Wie die Proömien andeuten, wird der Gang der Handlung gesteuert durch ein göttliches Planen und das Walten des Schicksals, und auch hier kann man durchgehende Linien verfolgen. Schon in der Antike hat man erkannt, dass dabei tiefer gehende Fragen nach dem Sinn der Geschichte und dem Gewicht moralischer Maßstäbe bei der Bewertung von menschlichen Handlungen und Haltungen angesprochen sind, dass der „Götterapparat“ auch in dieser Hinsicht nicht nur anmutiges Spiel ist. Der „Plan des Zeus“, der sich in der Ilias vollendete und so unzählige Todesopfer gefordert hat, scheint sich zunächst nur auf den Zorn und seine Folgen zu beziehen, aber im Hinblick auf die Gesamtkatastrophe des trojanischen Krieges, die in Rück blick und Vorausschau stets gegenwärtig ist, wurde er ausgeweitet auf eine allgemeine göttliche Absicht. Durch das allgemeine Sterben sollte die Erde erleichtert werden von der Last einer Menschheit, die durch Blindheit und Hybris mehr und mehr in Schuld geraten war: Die Stätte von Ilios wurde in allegorisierender Weise zum „Hügel der Ate“, wo Zeus die Personifikation der Verblendung auf die Erde geworfen hatte und nacheinander alle ihr verfallen waren, angefangen vom Stadtgründer Ilos über seinen Sohn Laomedon bis zum Enkel Paris nebst Helena, aber auch Agamemnon als Veranlasser des Streits mit Achill. Die Motive der Erbschuld und der folgenreichen Verblendung, verbunden mit mehr oder weniger missachteten Prophezeiungen, Vorzeichen und Warnungen, ziehen sich als weitere Orientierungslinien neben dem Zeusplan durch das Handlungsgefüge der Ilias. Ausgehend von dem Gewährungsnicken des Göttervaters im 1. Buch zeigt sich sein Planen vor allem an vier markanten Punkten, zu Beginn des 2. Buchs, wo er dem Agamemnon den trügerischen Traum sendet, dann am Anfang des 8. Buchs, wenn er den anderen Göttern jegliches Eingreifen ins Geschehen verbietet, im 11. Buch durch die Botschaft der Iris an Hektor mit der Verheißung seines Sieges nach dem Ausscheiden der drei wichtigsten Gegner und dann vor allem im 15. Buch in der weit ausholenden Vorhersage des bevorstehenden Geschehens lange über das Ende der Ilias hinaus: „Hektor soll die Achäer wieder in die Flucht schlagen, zurück zu den Schiffen des Achill. Der wird seinen Freund Patroklos in den Kampf schicken, der viele verderben wird, darunter meinen eigenen Sohn Sarpedon, bis ihn wieder Hektor tötet vor den Toren von Ilios. Im Zorn darüber wird dann der göttliche Achill den Hektor töten, und von da an könnte ich wohl einen Gegenangriff von den Schiffen mit unaufhörlicher Offensive einleiten, bis die Achäer Ilios erobern, mit Hilfe und Rat der Athene. Vorher werde ich dem Zorn kein Ende setzen und auch keinen anderen der Unsterblichen den Danaern helfen lassen, bis der Wunsch der Peliden erfüllt ist, wie ich ihm damals mit dem Nicken meines Hauptes zugesagt habe“ (Il. 15,59–75). Mit dieser Prophezeiung beschreibt Zeus exakt den Gang der Handlung bis zum Ende der Ilias und der Beilegung des Zorns. Für die Entwicklung des Krieges danach wird die Aussage des planenden Gottes eigenartig vage: Fest steht nur, dass Ilios schließlich fallen muss, aber die Gegenbewegungen durch das Eingreifen der Amazonen und der Äthiopen werden nicht erwähnt. Man könnte nun annehmen, dass der Dichter davon noch nichts wusste, aber auch vom Tod Achills ist nicht die Rede, obwohl ihm dieser in der Ilias mehrfach vorhergesagt wird, so von seinem eigenen Pferd und besonders detailliert von dem sterbenden Hektor, der ihn warnt vor „dem Tag, wenn Paris und Phoibos Apollon dich verderben werden, so stark wie du bist, am Skäischen Tor“ (Il. 19,416f.; 22,359f.). Über die Art und Weise, wie und von wem Ilios erobert werden soll, gibt Zeus ebenfalls nur eine Andeutung, aber der „Rat der Athene“ kann sich nur auf die List mit dem hölzernen Pferd beziehen, die sie dem Odysseus eingegeben hat, dem Helden, dessen Name fest mit dem Attribut „Stadteroberer“ verbunden ist.
Gegenaktion der göttlichen Opposition
Wenn also die über das Epos zerstreuten Ausblicke auf die Zukunft ebenso wie die zahlreichen Rückgriffe auf die Vergangenheit, so zum Beispiel das erst im 24. Buch, 28–30 erwähnte Parisurteil, bewusst undeutlich gehalten sind, dann dient diese Technik der besonderen Hervorhebung und Scharfeinstellung des ausgewählten Ausschnitts vor dem weiteren Hintergrund des Mythos. Dass der schicksalhaft vorgegebene Ablauf der Geschichte jedoch auch scheinbar irrationale Brüche und Gegenbewegungen aufweisen kann, wird durch die Opposition der trojafeindlichen Opposition Götter gegen den Zeusplan motiviert. Der durchgehenden Linie der Zeusvorhersagen entspricht die Kette der Sabotageakte des Widerstands mit ihren Folgen. Sie beginnt ebenfalls im 1. Buch mit dem Aufbegehren der Hera, setzt sich fort mit dem Eingreifen von Hera und Athene im 5. Buch zugunsten des Diomedes, das auch Zeus noch billigt, einem ähnlichen Aufbruch der beiden Göttinnen im 8. Buch, der mit furchtbaren Drohungen unterbunden wird, und erreicht ihren Höhepunkt im 14. Buch mit der Verführung und Einschläferung des Zeus durch Hera, die das Eingreifen des Posei don zugunsten der Achäer unterstützt und die vorübergehende Ausschaltung Hektors bewirkt (Il. 1,536–570; 5,711–895; 8,350–437; 14,153–441).
Die Hektor-Hybris-Linie — Warnungen des Polydamas
Beide gegenläufige Linien, Zeusplan und Widerstreit, werden mit der großen Zeusvorhersage an Hera im 15. Buch zusammengeführt und zur Ruhe gebracht, und zu Beginn des 20. Buchs, vor dem großen Finale, hebt Zeus sein Verbot des Eingreifens der anderen Götter vom Anfang des 8. Buchs endgültig auf. Das Werkzeug und tragische Opfer des Zeusplans wird Achills Gegenspieler Hektor, dessen Rolle in der Ilias ebenfalls eine klar erkennbare Entwicklung durchläuft. Diese Entwicklung ist die eines durch zweideutige Verheißungen und blendende Anfangserfolge zur Hybris verführten Mannes, die sich in übersteigerten Zukunftsplänen und einer Reihe missachteter Warnungen äußert. Im 6. Buch wird bei der Begegnung mit Andromache alle Sympathie des Lesers auf Hektor gelenkt, im 7. durch den Zweikampf mit Ajas sein Mut und seine Ritterlichkeit hervorgehoben. Seine eigentliche Hybrislinie beginnt im 8. Buch; nach dem nur durch den Einbruch der Nacht aufgehaltenen Siegeslauf entwirft er in einer großen Rede zuversichtliche strategische Pläne. Unterstützt werden diese durch die Siegeszusage des Zeus im 11. Buch, die allerdings, von Hektor nicht beachtet, nur bis zum Abend des dritten Kampftags gilt, “bis du die Schiffe erreichst, die Sonne sich senkt und das Dunkel heraufzieht“ (Il. 8,497–542; 11,200–209). Hektors zunehmende Hybris wird deutlich durch seine Reaktionen auf die Abfolge der Polydamas-Warnungen. Auch diese setzen Orientierungspunkte für das tiefere Verstehen des Geschehens durch den Leser. Polydamas steht im gleichen Alter wie Hektor und hat als Sohn des Apollonpriesters Panthoos prophetische Gaben. Zu Anfang des 12. Buches rät er, die Streitwagen am Graben zurückzulassen, und Hektor lässt sich noch überzeugen, zum eigenen Vorteil, doch kaum 200 Verse später weist er die nur schüchtern vorgebrachte warnende Deutung des Vogelzeichens höhnisch zurück, unter Verweis auf jene frühere Zusage des Zeus. Mit seinem dritten Ratschlag im 13. Buch kann Polydamas Hektors Starrsinn nochmals überwinden, aber in der Beratung der Troer am Vorabend von Achills Rückkehr in den Kampf wird seine Besonnenheit endgültig abgeschmettert. Hektor setzt im Hochgefühl des Sieges alles auf eine Karte, zu seinem und des Volkes Unheil: „So redete Hektor, und die Troer jubelten ihm zu, die Toren, denn Athene raubte ihnen den Verstand. Den Hektor lobten sie, der Schlechtes plante, doch keiner den Polydamas mit seinem guten Rat“ (Il. 12,60–80; 210–250; 13,723–752; 18,249–311). Den endgültigen Schlusspunkt in dieser über acht Bücher hinweg geführten Auseinandersetzung mit dem lästigen Warner setzt dann Hektor selbst kurz vor der Katastrophe, als er nicht mehr zurück kann: „Weh mir, wenn ich mich jetzt ins Tor und hinter die Mauern zurückziehe, dann wird mir Polydamas als erster Vorwürfe machen, er, der mich hieß, die Troer in die Stadt zurückzuführen in dieser schrecklichen Nacht, als Achill sich wieder erhob, ich aber folgte ihm nicht, obwohl es viel besser gewesen wäre. Jetzt freilich, nachdem ich das Volk mit meinem Unverstand ins Unglück gestürzt habe, scheue ich mich vor Troern und Troerinnen, es könnte einer, geringer als ich, mir vorwerfen: Hektor hat mit seinem Selbstvertrauen das Volk ruiniert – so werden sie sagen“ (Il. 22,99–108).
Gegenseitige Verflechtung der Leitlinien
Die Hektor-Linie und die damit verbundene Folge der Polydamas-Warnungen steht in enger Verbindung mit dem Zeusplan und der Gegenbewegung dazu, und alles ist wiederum dem Zorngeschehen um Achill untergeordnet. Dieses Geflecht in sich verschränkter Leitlinien lässt einen planenden Geist erkennen, der auf diese Weise die überquellende Fülle des Ilias-Geschehens sinnvoll strukturiert hat. Der Sinngehalt der darin enthaltenen Aussagen erhebt sich dabei wieder in die zeitlose Sphäre, wo es von geringerem Interesse ist, ob sich hinter Achill und Hektor ein Kern der Erinnerung an historische Gestalten verbirgt.
Ansätze zur Theodizee — Wiederherstellung der göttlichen Ordnung
Für den Odysseus gilt dies in noch weit höherem Maß, und die sinndeutenden Leitlinien in der Odyssee sind, entsprechend den viel weiter ausholenden und klar überschaubaren Handlungslinien, erheblich einfacher gestaltet als die der Ilias. Hier genügen zwei Götterversammlungen im 1. und 5. Buch, um die übergeordnete Planung festzulegen, und auch die ethische Motivation des Geschehens ist eindeutiger und stärker ins Allgemeine gehoben. Bezeichnenderweise geht Zeus selbst zunächst von ganz grundsätzlichen Überlegungen aus, für die er ein aktuelles Beispiel zur Erläuterung heranzieht: „Nein, wie doch die Menschen die Götter immer beschuldigen! Von uns sollen alle Übel kommen, und doch leiden sie aus eigenem Unverstand und über ihr Schicksalslos hinaus, so wie jetzt Aigisthos, der trotz unserer Warnungen die Frau des Atriden geheiratet und ihn selbst ermordet hat …“ (Od. 1,32–39). Für „Unverstand“ steht hier dieselbe Vokabel, die auch der reuige Hektor gebraucht, atasthaliē, das mit dem Wort für Verblendung, atē, stammverwandt ist. Von dem ruchlosen Mörder Agamemnons hebt sich Odysseus positiv ab, und so bringt jetzt Athene die Verbesserung von dessen Schicksal ins Gespräch. Zeus stimmt zu, und neben Hermes wird sich vor allem Athene selbst mit der Einleitung der nötigen Schritte und dem Schutz des Helden befassen. Ihr erst unsichtbares, dann immer wieder leibhaftiges Eingreifen in das Geschehen bildet die Hauptlinie des göttlichen Planens bis zum Ende des Epos, bis Odysseus in die Heimat zurückgekehrt, die Schuld der Freier gesühnt und die soziale Harmonie wieder hergestellt ist. Auch die Gegenaktion auf göttlicher Ebene ist vorhanden, um die Rückschläge und Hemmnisse auf dieser Bahn zu motivieren, im Wesentlichen auf das Eingreifen des Poseidon beschränkt. Der Rechtsgrund für seine wie auch des Helios Rache an Odysseus sind dessen sehr viel verzeihlichere Vergehen, wie die Blendung Polyphems und das Massaker seiner Gefährten an den heiligen Rindern. Die Unheilslinie der Odyssee endet in dem Gespräch zwischen Zeus und Poseidon im 13. Buch, wo sich Letzterer mit dem Plan seines Bruders abfindet: „Jetzt habe ich zugelassen, dass Odysseus nach vielen Leiden heimkommt, denn ganz wollte ich ihn nicht der Rückkehr berauben, da du sie ihm lange versprochen und zugesagt hast“ (Od. 13,131–133). Hingegen kann die positive Linie der göttlichen Gerechtigkeit erst im 24. Buch zur Ruhe kommen, nachdem die Seelen der bestraften Freier in der Unterwelt angekommen sind, der im 1. Buch herangezogene Vergleich mit Agamemnon und Aigisthos wieder aufgenommen und der Friede auf Ithaka wieder hergestellt ist, mit jenem allerletzten Satz des Epos: „Vertrag zwischen beiden bewirkte Pallas Athene, die Tochter des Zeus“.
Das Buch und seine Schicksale
In einer solchen, im Vorstehenden kurz skizzierten äußerlich und innerlich doch recht einheitlichen Gestalt sind die Epen auf uns gekommen. Doch „je nach der Aufnahme durch den Leser haben Bücher so ihre Schicksale“. Diese Schicksale im Verlauf von bald 3000 Jahren mögen unterschiedlichen Entstehungsprozess, Verluste und Brüche, aber auch Zusätze und Retouchen mit sich gebracht haben. Erkennbare Mängel, Risse und Differenzen im Gesamtwerk könnten darauf zurückgeführt werden, dass gelegentlich auch Homer in Schlaf verfallen sein mag, dass er im Lauf seines Lebens, wenn er je gelebt hat, sein eigenes Werk überarbeitete, dass er dann die Ilias in voller Schaffenskraft, die Odyssee aber in der Altersmilde der untergehenden Sonne verfasste, oder dass die Letztere erst in späterer Zeit aus seiner Schule hervorging. Alle diese Überlegungen der eher unitarischen Richtung in der antiken und modernen Wissenschaft und mehr noch die weitergehenden Einzelanalysen sowie die Fragen nach den literarischen und historischen Quellen bis zurück in die Bronzezeit sollten jedoch den Griff des Lesers nach dem Buch allenfalls anregen, aber nicht lähmen oder gar verhindern.