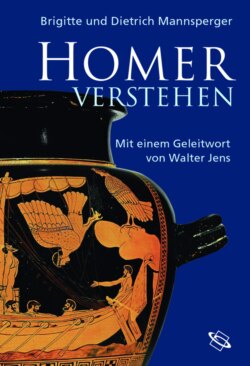Читать книгу Homer verstehen - Dietrich Mannsperger - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dichter und Dichtung
ОглавлениеDie homerischen Texte selbst geben die zuverlässigsten Informationen über das Selbstverständnis des Dichters und die Erwartungen seiner Zuhörer. Für den modernen Leser ist das Wissen darum der beste Schutz gegen Missverständnisse und interpretatorische Irrwege, und ein wichtiger Schlüssel für den Zugang.
Selbstverständnis des Dichters
Solche Informationen bieten zunächst die Passagen, wo der Autor im eigenen Namen, also in der Ich-Form spricht, beim gebetsartigen Anrufen der Musen oder in der direkten Anrede beim Gegenüber mit handelnden Personen, sowie überall dort, wo er grundsätzliche Äußerungen einflicht. Diese Bemerkungen begegnen uns vor allem im Zusammenhang mit dem Auftritt stellvertretender Sängerfiguren in der Dichtung selbst, gleichsam als szenischer Vergegenwärtigung der Dichterrolle.
Göttliche Überlegenheit, menschliche Schwäche
„Sage mir (ennepe), Muse, den Mann …“, beginnt die Odyssee, und die Gebetsanrufung wird bekräftigt: „Davon, Göttin, Tochter des Zeus, sage (eipe) auch uns“ (Od. 1,1–10). Die Bitte des Dichters bezieht sich auf den sachlichen Inhalt, die Information, das Transportvehikel dafür ist das „Wort“, epos, die Bezeichnung, die dann auch zum Namen der Literaturgattung „Epos“ wurde. Ausgehend von der Ich-Form „mir“ wird dann sogleich das Publikum mit einbezogen, „auch uns“. Die Mitteilung von Fakten allein macht jedoch noch nicht das Wesen dieser Dichtung aus. „Singe (aeide) den Zorn, Göttin …“, heißt es am Anfang der Ilias, das „Singen“ bezieht sich auf eine spezielle, gehobene Art und Präsentation dieser Mitteilung, ihre musische Gestalt im weiteren Sinn, die auch das eigentlich Musikalische mit einschließt. „Singen und Sagen“ gehören also irgendwie zusammen. Die hier angerufene Muse mag die spezielle Göttin des Dichters, vielleicht auch für seine Dichtungsgattung „Epos“ zuständig sein. Jedenfalls hat sie noch mehrere Schwestern, die beim Gelage der Götter zum Saitenspiel Apollons auf der Phorminx ihren Wechselgesang mit schöner Stimme ertönen lassen (Il. 1,603f.). In der Mehrzahl werden die Musen dann auch ausdrücklich angerufen, wenn sich der Dichter zur Bewältigung einer wahrhaft übermenschlichen Aufgabe anschickt. „Jetzt sagt an mir, ihr Musen, die ihr auf dem Olymp eure Wohnungen habt – denn ihr seid Göttinnen, seid allgegenwärtig und allwissend, wir aber hören alleine das Gerede und wissen gar nichts – wer alle die Feldherrn waren und Anführer der Danaer. Deren Masse nämlich könnte ich weder aufzählen noch benennen, auch nicht wenn ich zehn Zungen hätte und zehn Münder, eine unverwüstliche Stimme und ein ehernes Herz mir innewohnte, wenn nicht die olympischen Musen, Töchter des ägishaltenden Zeus, in Erinnerung riefen, wie viele gen Ilios kamen. Also werde ich aufzählen die Führer der Schiffe, und auch alle Schiffe“ (Il. 2,484–493).
Neunzahl der Musen — Funktion der Musenanrufe
Dieser ausführlichste aller Musenanrufe ist zugleich der aufschlussreichste. Die Bitte um göttlichen Beistand entspringt dem Bewusstsein menschlicher Schwäche angesichts der gewaltigen Aufgaben des Dichters. Dieser selbst, und wieder bezieht er sein Publikum ein, auch wir alle wissen ja nichts. Raum und Zeit, Zahl und Namen, die ganze Fülle der Welt und der Tradition, der unendliche Schatz der Erinnerung, wie lassen sie sich umfassend und verlässlich ausschöpfen, wenn man aufs bloße Hörensagen (kleos) angewiesen ist? Gedächtnis und Erinnerung (mnēmē) verwalten die an der Allmacht ihres Vaters Zeus teilhabenden Musen, deren kanonische Neunzahl bereits in der Odyssee anlässlich der Bestattungsfeier für Achill genannt wird (Od. 24,60f.). Später, im homerischen Hermeshymnos (v. 429) und im Eingang der Theogonie des Hesiod (v. 1–115) werden sie dann Töchter der Mnemosyne genannt. Bei Hesiod erscheinen neben der Neunzahl auch die jeweiligen Namen der Musen, die mit ihrer speziellen Funktion zu tun haben. Kalliope, „die Schönsingende“, später die Muse der epischen, ja der Dichtung überhaupt, wird als die vorzüglichste bezeichnet, weil sie die ehrwürdigen Könige begleitet (Theog. v. 79f.). Ihr mag bei Homer die Anrufung in der Einzahl gelten, doch die Hilfe ihrer Schwestern ist ebenfalls im Epos erforderlich, wenn es unter anderem um Geschichte (Klio), Liebesangelegenheiten (Erato) oder den Himmel (Urania) gehen soll. Nach den über 260 Versen des Schiffskatalogs mit seinem gewaltigen geographisch-historischen Gesamtpanorama folgt zur Lösung eines Spezialproblems ein weiterer Musenanruf in der Einzahl: „Wer aber von denen der Beste war, das sage mir, Muse, von ihnen selbst und den Pferden …“ (Il. 2,761f.). Die drei weiteren Musenanrufe in der Ilias greifen jeweils den durch markanten Binnenreim wie ein Fanfarenstoß wirkenden Formelvers Espete nyn moi Mousai Olympia dōmat’ echousai von Il. 2,484 wieder auf. Sie dienen dazu, im unübersichtlichen Schlachtgetümmel entscheidende Wendepunkte zu markieren und hervorzuheben, den Siegeszug Agamemnons bis zu seiner Verwundung, das Ein greifen des Poseidon zugunsten der Achäer, und vor allem das Verbrennen des ersten Achäerschiffes durch Hektor, das Zeus selbst als Fanal für die Wende bestimmt hatte: „Jetzt sagt an mir, ihr Musen, die ihr auf dem Olymp eure Wohnungen habt, wie denn zuerst das Feuer fiel in die Schiffe der Achäer“ (Il. 16,112f., vgl. auch 11,218–220 und 14,508–510).
Musen als Verkörperung der Erinnerung
Das Verhältnis des Dichters zu den Musen entspricht dem des homerischen Menschen zu den Göttern überhaupt. Was auf den ersten Blick wie eine Projektion menschlichen Fühlens, Verhaltens und Schaffens auf höhere Mächte und Wesenheiten aussehen mag, das wird doch immer getragen von einer religiösen Grundüberzeugung. Mündliche und literarische Sagentradition, historische Chroniken und detaillierte Seefahrerberichte, archivalische Überlieferungen, fingiert oder echt, mit Heeres- und Flottenlisten aus Heiligtümern und Palästen, mögen dem Dichter zur Verfügung stehen. Doch selbst wenn es das ehrwürdige Original eines auf Papyrusblättern festgehaltenen Urkatalogs der Schiffe und Mannschaften des trojanischen Krieges gegeben haben sollte, vielleicht sogar aus mykenischer Zeit überkommen und im Tempel der Athena Ilias zu Troja in der Hut der Priesterschaft aufbewahrt: Ein Dichter Homer, der im 8. Jahrhundert v. Chr. dort am Hof eines Herrschers aus dem Geschlecht des Äneas – dieser und seine Kindeskinder sollten ja künftig nach der Prophezeiung des Poseidon über die Trojaner herrschen (Il. 20,307f.) – Zugang zu einer solchen Urkunde gehabt haben könnte, hätte die Schrift von Menschenhand dann zwar als göttliche Kraft der Erinnerung, als „Muse“ hypostasieren können. Aber für die Bewältigung der Traditionsmasse, für die Umwandlung der bloßen Information in literarische Kunstgestalt vor einem anspruchsvollen Publikum bedurfte es der höheren Inspiration, des Enthusiasmos. Wenn die Musen den Dichter damit erfüllen, dann gewinnt seine Dichtung eine eigene, höhere Realität, in der er gleichsam mitlebt. So kommt es dann dazu, dass außer den Musen auch noch bestimmte Lieblingsfiguren die Ehre einer direkten Anrede im Gedicht (apostrophē) erfahren. In der Ilias sind dies einmal Achill (Il. 20,2), vor allem aber Patroklos und Menelaos, in der Odyssee wird ausschließlich der Schweinehirt Eumaios in dieser Weise vom Dichter ausgezeichnet. Während die Zuwendungsgeste jedoch bei Eumaios nach ihrer Einführung bei der ersten Nennung seines Namens – „dem entgegnetest du und sagtest, Sauhirt Eumaios …“ (Od. 14,55) – als schematisch häufig eingesetzter Formelvers erstarrt, weil er metrisch bequem ist, erscheint sie in der Ilias durchaus individuell:
Verhältnis des Dichters zu seinen Personen
Dem heimtückisch aus dem Hinterhalt angeschossenen Menelaos wendet sich dadurch die besondere Fürsorge zu: „Und die seligen Götter vergaßen dich nicht, Menelaos …“ „So befleckten sich dir, Menelaos, mit Blut die Schenkel …“ (Il. 4,127f.; 146f.). Auf den besonders tragischen Kampf des Patroklos richtet sich die Anteilnahme des Dichters, und damit auch des Lesers durch eine dreimalige Anrede vor, während und gegen Ende seines Siegeslaufs (Il. 16,20; 692f.; 787). Die zweite Stelle gewinnt dabei geradezu den Charakter eines Musenanrufs, einer Bitte um Auskunft an den Helden selbst: Der Dichter reflektiert eingehend über dessen Verblendung, den Anweisungen des Achill nicht gefolgt zu sein, und fragt ihn: „Jetzt, wen hast du als Ersten, und wen als Letzten getötet, Patroklos, als dich die Götter zum Tode riefen?“
Der Sänger in der Gesellschaft — Der blinde Sänger
Neben diesem Eintauchen des Autors in die selbst geschaffene Realität stehen seine Stellvertreterfiguren in der Handlung: In der Alltagswelt des Epos ist der Sänger eine wichtige Persönlichkeit, und zwar zunächst in seiner Eigenschaft als Musiker. Der Formelvers für diesen Umstand lautet: „Unter ihnen sang der göttliche Sänger und spielte dazu die Phorminx“ (Il. 18,604f.; Od. 4,17f.). Die hier gebrauchte Bezeichnung für „singen“ (melpein) erscheint dann wieder im Namen der „Melpomene“, der Muse der Tragödie, und tatsächlich sind an beiden Homerstellen Tanzvorführungen mit dem Auftritt des Sängers verbunden. In der Ilias steht dieser Auftritt als festlicher Höhepunkt am Ende der Weltschau auf dem Schild des Achill, das Publikum ist dort „eine große entzückte Menge“ auf dem öffentlichen Tanzplatz der Stadt. Am Hof des Menelaos in der Odyssee ist es hingegen die familiäre Hochzeitsgesellschaft von Nachbarn und Verwandten. Es wäre also einseitig, dem „Aoiden“ eine exklusive Stellung in der Adelsgesellschaft zuzuweisen; die Philologie ist ohnehin davon abgekommen, den Formelvers als „unpassende Wiederholung“ in der Ilias ganz zu streichen. Dieser inspirierte „göttliche Sänger“ (theios aoidos), wie er mit stehendem Beiwort charakterisiert wird, begegnet uns auch sonst mehrfach in der geordneten Alltagswelt der Odyssee. Dort gehört er allerdings mehr zum gehobenen Lebensstil der kulturtragenden Kreise an den großen und kleineren Höfen, in Sparta, Scheria oder Ithaka. In Mykene hatte ein Aoide sogar die Vertrauensstelle eines „Hofmeisters“, dem Agamemnon die Aufsicht über seine Ehefrau Klytämnestra anvertraut hatte (Od. 3,267–272). In der kriegerischen Ilias hingegen, im Baracken- und Schiffslager vor Troja, war man normalerweise auf Improvisation angewiesen. Dort spielt der zur selbst gewählten Zwangsmuße genötigte Achill selbst auf einer prunkvollen, erbeuteten Phorminx und singt dazu von Ruhmestaten der Männer, sich selbst zur Freude, mit Patroklos als einzigem, schweigendem Zuhörer (Il. 9,186–191). Als Inbegriff und Idealbild des berufsmäßigen Sängers finden wir am Hof des Phäakenkönigs Alkinoos den blinden Demodokos, den göttlichen Sänger, „göttlich“, „denn Gott verlieh ihm vor anderen die Gabe, zu erfreuen mit Gesang, wie sein Gemüt ihn antreibt“, „den hochbeliebten Sänger, den die Muse vor anderen mit besonderer Liebe auszeichnete, dem sie Gutes und Übles verlieh: Zwar beraubte sie ihn des Augenlichts, doch gab sie ihm süßen Gesang …“ Und Odysseus selbst preist ihn vor allen anderen: „Entweder hat dich die Muse gelehrt, die Tochter des Zeus, oder Apollon selbst, denn in so angemessener Weise besingst du das Geschick der Achäer, alles was sie taten und litten und auf sich nahmen, als wärst du selbst dabei gewesen, oder hättest es von einem anderen Augenzeugen gehört“ (Od. 8,43–45; 62–64; 487–491).
Gleichsam als ein weiteres zweites Ich des Dichters der Odyssee tritt bereits im ers ten Buch der hochberühmte Sänger Phemios, Sohn des Terpios („Künder, Sohn des Erfreuers“), auf und besingt im Haus des verschollenen Odysseus die traurige Heimfahrt der Achäer, zum Leidwesen der Penelope, die ihn um ein anderes Thema bittet, während der junge Telemachos für die dichterische Freiheit und Objektivität eintritt: „Mutter, was missgönnst du dem Sänger, so zu unterhalten, wie seine Einsicht ihn treibt, denn nicht die Sänger sind schuld, sondern Zeus allein, der den Menschen zuteilt, was er will. Deshalb darf auch dieser das böse Geschick der Danaer singen, denn die Menschen preisen besonders jenes Lied, das ihnen beim Zuhören als das aktuellste entgegentritt“ (Od. 1,325–353). Auch Phemios beruft sich später in höchster Todesgefahr auf seine Immunität als göttlicher Sänger: „Odysseus, ich flehe dich an, erweise mir Ehrfurcht und Mitleid, denn dir selbst wird es später noch Leid tun, wenn du den Sänger tötest, der ich singe für Götter und Menschen; gelehrt habe ich mich selbst, doch Gott hat mir vielfache Themen eingepflanzt, drum kann ich dich jetzt auch beschwören wie einen Gott …“ (Od. 22,344–349).
Autobiografische Züge?
Das in derartigen Partien zum Ausdruck kommende Selbstverständnis des Dichters kann man zweifellos auf den Ependichter selbst übertragen. In der Antike ist man darin noch weiter gegangen und hat seine Sängergestalten mit Homer in eine direkte persönliche Verbindung gesetzt. So wurde Phemios in der Legende zu einem Lehrer in Smyrna und Adoptivvater des Homer, und die angebliche Blindheit des Dichters geht natürlich auf die des Demodokos zurück. Der Verlust des Augenlichts mag nun tatsächlich mit einer Stärkung der inneren Geisteskräfte zusammengehen und deshalb auch faktisch zu einer häufigeren Verbindung mit dem Berufsbild des Sängers geführt haben. Den „blinden Mann aus Chios, dessen Gesänge auch künftig die besten sein werden“, der im homerischen Apollonhymnus v. 169–173 erwähnt wird, hat schon der Historiker Thukydides (3,104) mit Homer selbst identifiziert. Auch in der Ilias ist von einem berühmten blinden Sänger die Rede, dem Thraker Thamyris, offensichtlich dem Verfasser eines Epos über die „Eroberung Oichalias“. Doch der wurde zur Strafe von den Musen nicht nur geblendet, sondern auch der Sangeskunst und der Fähigkeit zum Kitharaspielen beraubt, denn er hatte sich gebrüstet, selbst sie im Wettkampf besiegen zu können (Il. 2,595–600).
Dichter- und Götterperspektive
Wie für den Menschen überhaupt, so sind vor allem auch für den Dichter Bescheidenheit und Selbstkritik vonnöten, und dadurch die Offenheit für eine höhere Inspiration. Dies betrifft sowohl den Inhalt seiner Dichtung, also Faktizität, Authentizität und Aktualität der Darstellung, wie auch ihre Form, das heißt die richtige Gliederung, Raffung und Bewältigung der Stoffmenge sowie die eingängige und ergreifende sprachliche Behandlung. All dies können nur die Musen vermitteln, gleichsam die Verkörperung des schriftstellerischen Gewissens und Könnens. Die Dichter perspektive, die Sicht des „allwissenden Autors“ ist also recht eigentlich die Götterperspektive, für den „Götterapparat“ des Epos sind letztlich die Musen zuständig. Dies gilt für den Beruf des „göttlichen Sängers“ in der Verbindung von schulmäßiger Übung und göttlicher Inspiration, wobei die musikalische Darbietung mit inbegriffen ist, doch auch die im Epos erzählenden Laien sind den grundlegenden narratologischen Bedingungen unterworfen. Auch sie müssen sich um kompositorische Ökonomie bei der Anordnung der Stoffmassen, um interessante Zuspitzung und Raffung, um Glaubhaftigkeit der Erzählperspektive, um die adäquate und eingängige sprachliche Form bemühen.
Berichte von Zeitzeugen — Hörensagen — Anekdoten beim Gelage
Wenn Achill die „Ruhmestaten der Männer“ zur Phorminx besingt, so mag er bekannte Lieder wiedergeben. Aber die fesselnden Berichte von Nestor, Menelaos, Helena, Eumaios oder gar Odysseus selbst über ihre Heldentaten, Abenteuer, Schicksale oder Erfahrungen werden als originale Leistungen des Erzählers behandelt und von ihrem Publikum auch entsprechend gewürdigt. Auch Nestor verweist den jungen Telemachos auf die Unmöglichkeit, alle Geschehnisse des trojanischen Feldzugs als Ganzes wiederzugeben: „Welcher sterbliche Mensch könnte all unsere Leiden erzählen? Auch wenn du fünf oder sechs Jahre dasäßest und jede Einzelheit erfragtest, schließlich würdest du unbefriedigt wieder heimfahren …“ (Od. 3,113–117). Er beschränkt sich daher auf die Erzählung seiner eigenen Heimkehr und die Nachrichten über die Schicksale der anderen Helden. Über Telemachos’ Vater Odysseus weiß er nichts; dass dieser noch lebt und seit Jahren auf der einsamen Insel der Kalypso sitzt, wissen bisher nur die Götter und, dank dem durch die Musen inspirierten Dichter, die Leser der Odyssee. Auch der andere prominente Heimkehrer, Menelaos, erzählt spannend über die erstaunlichen Erlebnisse seiner eigenen Fahrt (Od. 4,333–586); über das Schicksal des Odysseus ist er zwar nicht durch Autopsie informiert, doch er hat in Ägypten einen göttlichen Zeugen kennen gelernt. Der Meeresgott Proteus hatte den elenden Dulder weinend in seiner hilflosen Lage auf der Kalypsoinsel gesehen, und diese Kunde gibt er an Menelaos, dieser an Telemachos, und der wieder an Penelope weiter (Od. 4,555–560; 17,140–147). Auf diese Weise ergibt sich jenes bloße Hörensagen, dem der Mensch ausgesetzt ist, und auf Ithaka bleibt man dann auch recht skeptisch. In Sparta jedoch hatte zuvor schon eine andere prominente Zeitzeugin, die schöne Helena persönlich, sich als Erzählerin betätigt: „Jetzt aber setzt euch im Saal, lasst’s euch schmecken und freut euch an Geschichten, denn Passendes will ich berichten (katalexō) …“ (Od. 4,238f.). In anekdotischer Zuspitzung schildert sie ihr Zusammentreffen mit dem verkleideten Odysseus im belagerten Troja, und ihr Gatte Menelaos setzt sogleich eine nicht weniger aufregende Pointe dagegen: Er selbst mit Odysseus im Bauch des hölzernen Pferdes und Helena in zweideutiger Rolle außen davor (Od. 4,240–289). Hier wird also die dokumentarische Zuverlässigkeit der Berichterstatter unmittelbar vorgeführt, die Odysseus an den Kunstgebilden des Demodokos so gepriesen hatte, „als wärest du selbst dabei gewesen“ (Od. 8,491).
Professionalität des Laien — Quellennachweis — Mischung von Wahrheit und Lüge — Realismus und Historizität? — Der Sack des Aiolos
Das monumentale Prunkstück eines derartigen selbst erlebten „Tatsachenberichts“ präsentiert dann der Held der Odyssee selbst, und seine bezauberten Gastgeber am Hof der Phäaken anerkennen die hohe Professionalität des Erzählers: „Du verfügst über die sprachliche Form, in dir wohnt ein edler Sinn, die Geschichte (mythos) hast du verständig wie ein Sänger vorgetragen (katelexas)“ (Od. 11,367f.). Der König Alkinoos betont ausdrücklich die Glaubwürdigkeit des Odysseus, der kein hergelaufener Lügner sei wie so viele, und das gerade mitten in der phantastischen Erzählung vom Besuch des Helden in der Unterwelt. Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit lässt ihn der Dichter dann auch sogleich im folgenden Buch demonstrieren, wenn er ein Göttergespräch wörtlich wiedergibt, von dem er unmöglich aus eigenem Erleben wissen konnte. „Das habe ich von Kalypso gehört, und die sagte, es selbst von Hermes gehört zu haben“ (Od. 12,389f.). Wenn auch nicht die Musen selbst, so kann er als Heros doch andere göttliche Gewährspersonen für sich ins Feld führen. Allerdings darf sich der treuherzige Leser dann nicht wundern, wenn er den Listenreichen in anderen Situationen, wo es die Opportunität nahe legt, in raffinierter Verkleidung oder beim munteren Draufloslügen ertappt. Adressaten solcher nicht ganz verlässlicher Einlassungen werden nicht nur der menschenfressende Kyklop, dem schließlich nur Recht geschieht, sondern auch der biedere Schweinehirt, die treue Gemahlin, der verzweifelte Vater und sogar die fürsorgliche Schutzgöttin Athene (Od. 9,259–370; 14,192–359; 19,165–202; 24,303–314; 13,256–286). Diese allerdings steht in olympischer Heiterkeit über den Dingen; sie lächelt und streichelt ihren Liebling, in dem sie ihren Geistesverwandten erkennt (Od. 13,287–302). Nicht immer lassen sich eben die rigorosen Maßstäbe der Moral im Alltag anwenden, auch aus Mitleid oder Vorsicht kann man bisweilen von der Wahrheit abweichen, wie bei Penelope: „So sprach er, und erfand viel Falsches dabei, dem Wahren recht ähnlich“, kommentiert der Dichter diese Lügenrede (Od. 19,203). Diesen nicht so ganz unbedenklichen Mischcharakter der Aussage beanspruchen dann bei Hesiod die olympischen Musen selbst für sich und ihre Werke: „Wir wissen viel Falsches zu sagen, dem Echten vergleichbar, wir wissen jedoch, wenn wir wollen, auch das Wahre zu erzählen“ (Hesiod, Theogonie 27f.). Damit ist einerseits das Prinzip der „dichterischen Freiheit“ für alle Poesie aufgestellt, und andererseits verrät die Anwendung derselben Charakterisierung auf die Odysseusrede bei Homer, dass auch seine Personen innerhalb des Epos mit ihren Erzählungen an diesem allgemeinen Wesen der Dichtung teilhaben. Ihr ist es erlaubt, „Wahres“ und „Unwahres“ zu mischen, ihr kreativer Maßstab ist Plausibilität im jeweiligen Kontext, nicht eine positive Wahrheit der Sachinformation oder die peinlich genau durchgehaltene Perspektive des Berichts. Zwar wird jeweils eine scheinbare Objektivität suggeriert, mit allen Kunstgriffen und Farbnuancen der Zunft, denn gerade darin besteht das Handwerk des erfahrenen Sängers und Erzählers. Aber das Endergebnis bleibt doch eine Kunstwelt, ihr „Realismus“ wird zu einer Art von stilisiertem Hyper-Realismus, ihre „Historizität“ ist letztlich doch zauberhafte Fiktion im Gewand einer „dokumentarischen“ Hyper-Historizität. Wenn man also Ereignisse und Personen, soziale Verhältnisse und natürliche Umwelt des Epos keineswegs eins zu eins mit den realen Verhältnissen einer bestimmten Epoche gleichsetzen kann, so darf man auch aus der Darstellung des Sängers im Epos nicht automatisch auf die soziale Stellung und reale Arbeitsweise eines Sängers im 8. Jahrhundert v. Chr. schließen. Demodokos und Phemios bleiben wie Achill und Odysseus hyperreale dichterische Gestalten, in denen sich Reales und Ideales mischen. Informationen über Homers literarische Intensionen lassen sich daraus also höchstens über ein zurückhaltendes „Dichtungsfilter“ gewinnen. Wie auf allen anderen Gebieten, so gilt auch hier die Warnung des alexandrinischen Geographen und Dichters Eratosthenes aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert, die Irrfahrten des Odysseus werde man erst dann lokalisieren können, wenn man den Schuster ausfindig gemacht habe, der einst den Ledersack des Aiolos, des Herrn der Winde, gefertigt hatte …