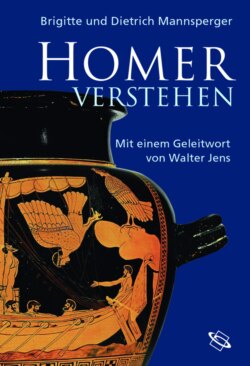Читать книгу Homer verstehen - Dietrich Mannsperger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ZUM GELEIT
Оглавление„Was den Homer angeht, ist mir wie eine Decke von den Augen gefallen“: Ich spreche den Satz, den Goethe während seiner italienischen Reise anno 1787 in Neapel formulierte, mit Dankbarkeit und Vergnügen nach: Es gilt, ein Handbuch, Homer verstehen, anzuzeigen, das, von den Autoren mit anrührender Bescheidenheit als „Büchlein“ etikettiert, für die Leser der Voß-, Schadewaldt- und Hampe-Übersetzungen in gleicher Weise wie für jene Graezisten von Nutzen ist, denen die beiden Epen von der Sekunda-Lektüre bis zur Emeritierung in immer neuem Licht erscheinen. Zustimmung auf beiden Rängen also ist zwei Altertumswissenschaftlern, Brigitte und Dietrich Mannsperger, gewiss, die ihr opus in langen Jahren meist in Tübingen, aber, unter der Ägide des unvergessenen Manfred Korfmann, auch vor Troja konzipiert haben, um am Ende die Arbeitsweise, genauer: das Handwerk Homers in einer Summe zu veranschaulichen.
Wie haben sie geschrieben, wird gefragt, der Ilias- und der Odyssee-Dichter – der eine in seiner Unvergleichlichkeit und der andere auf dessen Spuren, aber, erfindungsreich, wie er war: ein Meister der Variationen, nie im Schatten des Ersten? Wie haben sie die Idealität der Götter, verfremdend und auf Distanz bedacht, im Hier und Jetzt realisiert, das Publikum ihrer Zeit nicht aus den Augen verlierend? Wie haben sie das Märchen von gestern ins Heute übertragen? „Namen und Ereignisse der heroischen oder mythischen Tradition können“, so die Schlüsselworte des Kompendiums, „transloziert oder anachronistisch transferiert, eingeschmolzen und neu komponiert werden.“ Es geht also um die Erhellung von kühnen artistischen „Montagen“, mit denen die beiden Meister – ungefähr zwischen den Jahren 730 und 710 – eigenständige Kunstwerke in Gestalt einer Wunderwelt schufen, die den Zuhörer sowohl in einem imaginären Olymp wie auf der mit Landkarten ausmessbaren Insel Ithaka zu Hause sein ließen. Ferne und Nähe fügten sich in überzeugender Dialektik zueinander. Mir ist es wirklich wie eine Decke von den Augen gefallen, als ich unter dem Stichwort „Großraum mit unscharfer Peripherie“ die – hier frei formulierten – Sätze las: „Die Ereignisse von Ilias und Odyssee sind in einen Kosmos hineinprojiziert, der, von diffusen Rändern ausgehend, immer mehr an Präzision zunimmt, bis sich schließlich geographische und topographische Wegmarken zu durchaus realistisch anmutenden Schauplätzen zusammenfinden. Während die Komposition der Odyssee dabei mehr und mehr von der Peripherie her ins Zentrum führt, dominiert in der Ilias von Anfang an der engere Schauplatz, der von Fall zu Fall erweitert wird.“
Beobachtungen wie diese verweisen auf die Fähigkeit der Tübinger Autoren, homerische Geschichten zugleich vom Newton point of view, der „normalen“ Sichtweise, aber auch aus der Perspektive derer zu betrachten, die hinter dem Wissen des Dichters zurückbleiben.
Zwei Altertumswissenschaftler bei dem Entwurf von Charakterogrammen: ein lehrreiches Spiel, bei dem nicht zuletzt rhetorische Aspekte im Zentrum stehen. Wer unter den Akteuren ist zunächst dem Pathos, wer dem Ethos, wer dem Logos verpflichtet? Präfigurationen der Dreistillehre im frühen Epos: ein aspektreiches Exerzitium, bei dem die Synkrisis mit ihrer Kunst der wechselseitigen Erhellung den Primpart spielt: Hektor und Achill – Brutalität und Sanftmut, alternierend aus zweierlei Sicht betrachtet. Achill contra Odysseus: Sagt der eine: „Auf, Männer, sofort in die Schlacht!“, repliziert der andere: „Erst müssen die Mannschaften essen.“ Odysseus, immer der Erdnahe, dem Alltäglichen zugewandt, und zugleich ein Meister raffinierter Kalkulationen. Die Autoren plädieren entschieden für ihn; zu keinem Akteur fällt ihnen so viel ein wie zu Ulyss: Der Mann „misstraut grundsätzlich jedem und bei jeder Gelegenheit. Er zögert gegenüber Leukothea und sieht in Kalypsos Vorschlag zum Floßbau eine hinterhältige Absicht: ‚Erst musst du mir den großen Eid schwören.‘ Im Umgang mit dämonischen Frauen ist offensichtlich besondere Vorsicht geboten, Zurückhaltung sogar bei Nausikaa, Arete und selbst Penelope. Dieser Vorsicht entspringen alle die Lügengeschichten des angeblichen Kreters mit der immer wieder abgewandelten Verschleierung der Fakten.“
Intelligenz als movens eines ambivalenten, hier gütig, dort martialisch auftretenden Akteurs: Die Handbuch-Autoren können sich bei ihrem Psychogramm auf die vielfältigen Analysen in der Literaturgeschichte stützen. Odysseus, immer wieder Odysseus! Odysseus, der von seinem alter ego Palamedes aufs Kreuz gelegte Pazifist, Odysseus, ein unentfremdeter Mensch, der – ich schlage einen weiten Bogen hin zu Horkheimer und Adorno – in der Sirenen-Szene lernt, ein freies Leben zu führen, mit mancher Entsagung, aber auch hohen Genusses (unter der Bedingung freilich, dass die Sirenen tatsächlich singen). Eben das aber taten sie in Franz Kafkas Fabelvariation nicht, sondern griffen zu ihrer schärfsten Waffe, dem Schweigen – „sei es, dass sie glaubten, diesem Gegner könne nur das Schweigen beikommen, sei es, dass der Anblick der Glückseligkeit im Gesicht des Odysseus sie allen Gesang vergessen ließ. Odysseus aber hörte ihr Schweigen nicht. Er glaubte, sie sängen, und nur er sei behütet, es zu hören. Flüchtig sah er zuerst die Wendungen ihrer Hälse, das tiefe Atmen, die tränenvollen Augen, den halb geöffneten Mund, glaubte aber, dies gehöre zu den Arien, die ungehört um ihn verklangen.“
Eine grandiose Version, diese Parabel von Kafka, eine poetische Analyse, die den Leser des Büchleins, dank der oft einprägsam formulierten Psychogramme in den beiden alten Epen, immer wieder zum Ausmalen, Weiterdenken und Ergänzen veranlassen: Mein Gott, diese Shakespeare-Grimassen, der Kläffer Ajas und der Hurenbock Achill, ein sex-man, der es mit Patroklos auf dem Lotterbett treibt. Die Handbuch-Portraits spornen den Leser wieder und wieder zu Expeditionen durch die Literaturgeschichte an: Er denkt nicht nur nach, sondern blickt auch voraus, einerlei, ob ihm nun Joyce oder Bertolt Brecht die Feder führt. Bei der knapp skizzierten homerischen Kassandra-Szene erinnere ich mich eines Dramenentwurfs von Brecht: „Kassandra, die Troerin, die uns vorschwebt als bleiche, hagere Fanatikerin, war in Wirklichkeit eine liebreizende, lebenslustige Person. Das falsche Bild entstand wohl, weil man […] die Vertrauten der Überirdischen gemeinhin als etwas unnatürliche Wesen mit erschreckender Aufführung betrachtete.“
In der Tat, die Phantasie des Lesers ist grenzenlos und lässt ihn das Altbekannte immer neu unter zeitgenössischen Aspekten betrachten. Ein Glück nur, dass die Pflicht, das Büchlein auch statarisch zu lesen, zunächst einmal strikte Beschränkung verlangt: Auf den Text verwiesen notiert der Rezensent Fortschritte und Rückwärtsbewegungen im homerischen Handlungsverlauf, Übereinstimmungen und Kontraste, Verschränkungen und Offenheiten. Wieder und wieder stellt er sich Fragen-Kataloge zusammen: Lassen sich die Musen-Anrufe mit Hilfe der platonischen Formel Enthusiasmus und Logos verstehen? Wo endet, wenn überhaupt, die dichterische Freiheit in archaischer Zeit? Sind die olympischen Götter nur Freiwild für libertäre Attacken? Und weiter: Welche Passagen kennst du, Leser, um die ingeniös beschriebene „Spannung zwischen Formelhaftigkeit und Variation, die überraschende Abwandlung des Vertrauten, die Anpassung an individuelle Aussagen, die an die Kennerschaft eines bestimmten Publikums appellieren“, im homerischen Text und, weiterdenkend, in jenen Tragödien nachzuweisen, welche zu Recht „Schnitten vom Mahle Homers“ genannt worden sind?
Den Interpretationen der beiden Mannspergers folgend muss sich der Leser Gedanken über die Behandlung der jeweiligen Stilebene machen – Komik bei Homer: ein noch nicht genug beackertes Feld! –, muss die Kunst des Zeitraffens, vor allem die Verwandlung der realen in die fiktive Zeit bedenken, muss die „filmischen“ Schnitte, ja, die Technik des Zooms bedenken, die den Szenenwechsel akzentuieren. Stilisierende Tendenzen überall: Im Augenblick des höchsten Liebesglücks – Odysseus und Penelope „erkennen“ einander auf dem ehelichen Lager – hält Athene die Nacht an und hindert die Morgenröte, ihre Rosse anzuschirren.
An vielen Ausrufungszeichen, die für Zustimmung stehen, und einem oft wiederholten ecce! sic! und recte! mangelt es nicht, auch einige wenige, am Textrand verloren wirkende Fragezeichen finden sich gelegentlich: Warum gibt es kein Stichwort für „Schlaf“? (Beim Lesen des ‚Homeriden‘ William Shakespeare notiert.)
Bliebe noch die Bitte an die Leser, die wunderbaren Geographika mit besonderer Akribie zu studieren, die Milieu-Beschreibungen, vor allem in der Odyssee zu bedenken und sich an Hand des libellus mit Herrenhäusern, Prunkwagen, Schiffen, Häfen, Männerrüstungen und Frauenschmuck zu beschäftigen: Es ist wahrscheinlich, dass Penelope während Odysseus’ Abwesenheit auf Kosmetika verzichtete.
Schließlich ein Aspekt, über den zu meditieren mir so wichtig ist wie den Autoren: der Kontrapunkt des Leisen und Sanften mitten in Mordszenerien. Der innehaltende Achill! Der „andere“ Hektor, so, wie ihn Helena, ausgerechnet sie, die so oft an den Pranger gestellte Frau, im Zeichen einer großen Tristesse beschreibt: „Hektor, o trautester Freund, […] nimmer entfloh dir ein böses Wort, noch ein Vorwurf, […] immer besänftigtest du und redetest immer zum Guten durch dein freundliches Herz und deine freundlichen Worte. Drum bewein ich mit dir mich Elende, herzlich bekümmert.“
Zum Schluss eine Frage, eine laudatio und ein Résumé. Zunächst die Frage: Wenn die Autoren zu Recht betonen, dass die offenen Schlüsse den Ausschnitt-Charakter der beiden Epen markieren und eine Weiterdichtung auf Kosten der poetischen Abstraktion ginge – jetzt noch Achills Tod, jetzt noch Odysseus’ Ende –, während der wahre Poet, Homer, es bei knappen Vorausdeutungen von Zeus und Teiresias bewenden lässt … wenn dem so ist, hätte dann Goethe nicht gute Gründe gehabt, seine Achilleis aufzugeben und es beim offenen Ende zu belassen? Kein lodernder Scheiterhaufen, kein sich hinschleppendes Untergangs-Finale. Nach Vers 651 ist Schluss.
Die Bedenken, die das chronologische Forterzählen betrafen, waren groß: „Ich fange mit dem Schluss der Ilias an, der Tod Achills ist mein nächster Gegenstand, indessen werde ich wohl noch etwas weiter greifen. Diese Arbeit führt mich auf die wichtigsten Puncte der poetischen Kunst, indem ich über das Epische nachzudenken alle Ursache habe.“
Geheime Zweifel also von Anfang an. Schade, gleichwohl, dieser Abbruch, doppelt schade, weil es einen Schriftsteller gab, der Goethes Fortsetzung seinerseits hätte fortsetzen können, diesmal im Duktus des konsequenten Episierens: Thomas Mann. Ein Jammer, dass Karl Kerényi den auf unermüdliches In-Spuren-Gehen verwiesenen Dichter nicht energisch genug drängte, eine Prosa-Achilleis, bestimmt durch psychologisierendes Raffinement, zu schreiben. Das hätte sich am Ende – vielleicht – machen lassen. Ein Jammer, noch einmal, dass der schlechte Lateinschüler (und überzeugte Humanist) keine Mannsperger-coniuges in seiner Nähe hatte, die dem Romancier neue, produktiv weiter zu entwickelnde Erkenntnisse hätten vortragen können … Erkenntnisse, die unter anderem auch auf einen Odysseus verwiesen, der sich als maître grand parleur und geheimer Zauberer in arte rhetorica präsentierte. Nun, Thomas Mann hörte auf, bevor er richtig begann, und das Ilias-Ende blieb, was es immer war: unüberbietbar.
Womit der erste Leser und Rezensent zum Vorletzten käme: der laudatio auf zwei Wissenschaftler, deren Buch ihn in keiner Minute langweilte. Selbst die Hexameter-Analyse liest sich nahezu unterhaltsam. Mit Hilfe von verlässlich gegliederten Programm-Punkten durchschritten die gelehrten Verfasser das homerische Terrain mitsamt seinen Höhen und Tiefen (Untiefen wurden elegant umschifft) und verloren dabei ihr Hauptanliegen, die Beschreibung einer ureigenen Kunst-Welt samt ihrer technischen Prämissen, nie aus den Augen.
Und schreiben können die beiden ihr Büchlein sorgfältig komponierenden Gelehrten, nehmt alles nur in allem, auch – in welchem Ausmaß, das verdeutlicht exemplarisch die Beschreibung der Leichenspiele zu Patroklos’ Ehren im 23. Gesang der Ilias: ein Text, der den Kreis der Wagenrenner, Boxer, Ringer, der Waffenkämpfer, Kugelstoßer, Bogen- und Speerwerfer beschreibt, als ginge es um ein agonales Ballett. Variatio delectat und Modernität ist erlaubt heißen die Losungen: „Favoritensturz und Sieg des Jung-Heros und Götterlieblings, Tricks und Einsicht des jugendlichen Heißsporns, gelassene Großmut des Königs, Ehrerbietung gegen das verdienstreiche Alter, leidenschaftliches Mitfiebern der Zuschauer: das sind die Elemente im Wettkampf der hervorragenden Pferde-Halter und -Lenker, die noch identisch sind: Besitz und Leistung gehören zusammen.“
Chapeau bas! Die gelehrten Homer-Kenner schreiben hier in einem federnden Rhythmus, der die Aktionen stilistisch nachzeichnet – und das wohlbegründet. Auch der Ilias-Dichter verfuhr, die Kola gleichsam vorantreibend, in parataktischer Weise – immer schneller und verwegener! Und was Goethe betrifft, den Verfasser des Auszugs aus der Ilias, so ist sein Tempo, dank des regierenden Präsens, beinahe noch schneller als im Mannsperger’schen Buch. („Sie fahren ab, sie kommen gegen das Ziel, Eumelos jagt vor, Diomed ihm nach; dieser verliert die Geißel, Pallas gibt sie ihm zurück und zerbricht dem Eumelos den Wagen, Diomed fährt vorbei, ihm folgt Menelaos“: das ist die Prosa eines heranreifenden Genies, das Selbstfindung in Homers Bahnen sucht.)
Schließlich mein Fazit in der Form eines Epilogs: Wer sich mit Homer beschäftigt, sollte nicht nur die Werke der beiden Ur-Meister des ausgehenden 8. Jahrhunderts, eines revolutionären Saeculums, sondern auch ihre evozierende Kraft mitbedenken (Schlaf und Traum als Dichtungs-Konstanten – Shakespeare und kein Ende!), die bis zur Gegenwart reicht.
In Tübingen wurde gezeigt, wie fruchtbar es sich an der Grenze von Wissenschaft und Poesie arbeiten lässt … bedeutenden Gelehrten, zumal im deutschen Sprachraum, verpflichtet (Hölscher, Latacz, Reinhardt, Schadewaldt, Snell), aber auch Schriftstellern auf der Spur, deren Visionen den apollinischen Musen zugeordnet bleiben – wie sehr, das hat, für viele sprechend, der eine James Joyce in seinem Ulysses gezeigt. So betrachtet, denke ich, wird der libellus Homericus dank seiner anspornenden Wegweisung uns Lesern künftig vielfach hilfreich sein. Dafür sei den beiden Autoren, die vor vielen Jahrzehnten einmal zum Kreis meiner Schüler gehörten, herzlich gedankt – im Sinne des solonischen Satzes, wohlgemerkt, der da lautet: gerasko d’aiei polla didaskomenos – ich bin alt geworden und lerne unermüdlich dazu.
Walter Jens