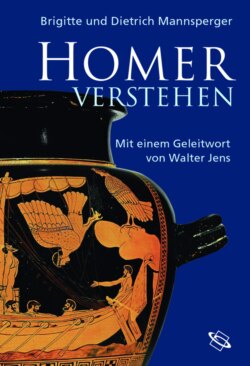Читать книгу Homer verstehen - Dietrich Mannsperger - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VORWORT
ОглавлениеDie Dichtung Homers steht wie ein Wunder am Anfang der europäischen Literatur, ein vollkommenes, in sich differenziertes, jederzeit fesselndes Kunstwerk aus einer scheinbar so fernen, dunklen Epoche. Ob ein Dichter Homer jemals gelebt hat, wird zwar immer wieder in Frage gestellt, das Werk jedoch ist lebendig seit bald dreitausend Jahren. Ob man nun einen oder zwei verschiedene Dichter annimmt, die Texte von Ilias und Odyssee wurden gelesen und immer wieder gelesen, sie wurden zum unerreichten Vorbild für Dichtung überhaupt, und ihre Inhalte versuchte man von jeher historisch und archäologisch auszuwerten.
In der Gegenwart ist dieses Sachinteresse besonders in den Vordergrund getreten, aus der Diskussion der Fachdisziplinen entwickelte sich ein neuer wissenschaftlicher „Kampf um Troja“, an dem auch die weitere Öffentlichkeit lebhaften Anteil nahm. Das Wort des Dichters selbst trat demgegenüber mehr und mehr in den Hintergrund, mochte sich auch der Film seiner Figuren immer wieder aufs Neue bemächtigen. Einige Bildungsreminiszenzen zu Namen und Fakten sind bei Quizsendungen immer noch verwertbar, ein großer Name ist Homer nach wie vor, doch wird ihn jeder lesen? Nein! Seine Lektüre an der Schule findet kaum mehr statt, und an der Universität hat sie sich in die Seminare von immer weniger Spezialisten zurückgezogen. Wer sich dennoch anschickt, ihn zu lesen, der findet zwischen philologischer Analyse, Rezeptionsästhetik und Sacherklärung nur schwer den richtigen Zugang.
Über das eigentliche Wesen des Gegenstands besteht oft Unsicherheit. Zu Recht hat in diesem Zusammenhang ein Historiker die Warnung ausgesprochen „Die Ilias ist kein Geschichtsbuch.“ Diese Grundeinsicht hat sich zwar weithin durchgesetzt, aber was das Epos wirklich ist, sollte man sich immer wieder erneut vor Augen stellen: ein Großepos, das in literaturgeschichtlicher Tradition steht und in einer bestimmten historischen Situation für ein spezifisches Publikum geschaffen wurde. Seine Handlung spielt in einer Idealwelt der Götter und Heroen, in die man sich gerne hineinversetzte, ohne sich voll mit ihr identifizieren zu können.
Zur heroischen Perspektive gehört eine klare historische Distanz, denn eine allzu realistische Wiedergabe der zeitgenössischen Verhältnisse würde die Illusion nur stören. Auf diese Weise entsteht eine eigenartige Kunstwelt, wo sich Erinnerung an die Vergangenheit verbindet mit mythischen Assoziationen, wo märchenhafte Züge neben historischen Reminiszenzen stehen, und gleichsam zur Beglaubigung und als Brückenschlag zur Gegenwart und Nachwelt topographische Schauplätze und sichtbare Relikte der Vergangenheit mit eingebunden werden. Gewisse zeitgenössische Fakten und Ideale mögen trotz aller archaisierenden Tendenz präsent sein, in jedem Fall aber ist grundsätzlich von einer Vielfalt der Elemente auszugehen, mit denen die dichterische Phantasie spielt. Namen und Ereignisse historischer oder mythischer Tradition können dabei transloziert oder anachronistisch transferiert, eingeschmolzen und neu komponiert werden. Deshalb sind Ilias und Odyssee weder ausschließlich auf die Eisenzeit, noch allein auf die Bronzezeit zu beziehen, so wenig wie das Nibelungenlied einschichtig die Welt der Völkerwanderungszeit oder die des Hochmittelalters wiedergibt. Diese Vielfältigkeit homerischer Dichtung ist jedoch nicht als ein Paket von Sedimentschichten oder ein Konglomerat zu verstehen, dessen einzelne Bestandteile sauber zu trennen oder herauszulösen wären. Sachliche Aussagen im Epos erscheinen nicht um ihrer selbst willen, sondern an der Stelle und in der Gewichtung, die die dichterische Absicht verlangt. Es ist also durchaus dem Gegenstand angemessen, wenn man sich einfach dem Gang der Handlung und der Faszination des Lesens überlassen kann.
Dazu muss jedoch die Hemmschwelle überschritten werden, der man sich bei der ersten Begegnung gegenübersieht, bedingt durch den Eindruck des Fremden und Ungewohnten. Schwierigkeiten bereiten dabei die äußere literarische Form, angefangen beim Versmaß des Hexameters, dann die immer wiederkehrende Formelhaftigkeit der Darstellung, Weitschweifigkeit der Komposition und Lang atmigkeit der sprachlichen Gestaltung. Die uns heute geläufigen literarischen Gattungen Roman und Drama, Lyrik und Sachprosa setzen gewisse Vergleichsmaßstäbe, und alltägliche Denkkategorien und Wertvorstellungen können zu Befangenheit führen gegenüber dem Text aus dem Altertum. Themen wie Monotheismus und Polytheismus, Staat und Gesellschaft, Aristokratie und Demokratie, Masse, Familie und Individuum, Mann und Frau, Leben und Tod, Mensch und Gott, Mensch und Natur, Krieg und Frieden, Selbstverantwortung und göttliches Verhängnis sind zwar letztlich zeitlose Kategorien. Dennoch bleibt die Frage, ob man sie an solche frühen Denkmäler einer fernen Welt herantragen darf, auch dann berechtigt, wenn sie wie Homer unsere Kultur in hohem Maße geprägt haben. Eine Antwort darauf kann nur die eigene Begegnung mit dieser Welt geben. Schon eine ausführliche Nachzeichnung der Epen wie in Gustav Schwabs „Sagen des klassischen Altertums“ oder eine knappe Nacherzählung wie „Ilias und Odyssee“ von Walter Jens eröffnen einen legitimen Zugang, zumal wenn sie von ausgewiesenen Sachkennern vorgelegt werden, aber das Original können sie nicht ersetzen. Zur Auseinandersetzung damit, sei es im Urtext, in zweisprachigen Ausgaben oder auch, wie wohl in den meisten Fällen, anhand einer Übersetzung, will das vorliegende Buch ermutigen und helfen.
Diese Absicht soll durch eine Dreiteilung erreicht werden, die vom Allgemeinen zum Speziellen voranschreitet. Zuerst wird das Epos als Ganzes mit den den Gesamteindruck bestimmenden Elementen ins Auge gefasst. Dann erfolgt eine nähere Observation der im Text eingesetzten dichterischen Kunstmittel und schließlich eine Beurteilung der sachlichen Inhalte in ihrer dichterischen Verwandlung.
Innerhalb dieser Gliederung wird durchweg dieselbe Methode verfolgt. Dazu gehört zunächst ein exemplarisches Vorgehen; es wird keine Systematik angestrebt und keine Handbuch-Vollständigkeit, deshalb gibt es keine Tabellen oder Schemata, Pläne oder Karten. Beabsichtigt ist auch kein fortlaufender Kommentar, sondern es werden Einzelaspekte herausgegriffen, die für die jeweiligen Themen wichtig sind. Daraus ergibt sich eine gewollte Mehrfachbehandlung derselben Textstellen, die dadurch in ihrer Vielschichtigkeit deutlicher werden; zur Orientierung dient ein Stellenregister.
Alle Aussagen und Hinweise bemühen sich dabei um eine ständige Textnähe, die durch Paraphrasen und eigene neue Übersetzungen gewährleistet wird. Zur Erleichterung des Verständnisses wird auch eine gelegentlich raffende, erläuternde oder sogar interpretierende Modifikation nicht gescheut, und wenn es nur um die Entlastung der Textaussage von der typischen Attributhäufung geht. Auch eine konstante Wiedergabe der griechischen durch immer dieselben deutschen Begriffe wird absichtlich vermieden, um ihr abweichendes Bedeutungsspektrum nicht zu verdunkeln. Wichtige Schlüsselwörter werden des Öfteren auch griechisch in lateinischer Umschrift gegeben, vor allem dann, wenn sie durch Fremdwörter im Deutschen schon etwas vertraut sind.
Das Buch profitiert allenthalben von den Ergebnissen einer generationenalten Forschungsarbeit, aber es enthält keine Diskussion wissenschaftlicher Thesen, und deshalb keine modernen Autorennamen oder Literaturzitate, und auch keinen Anmerkungsapparat. Dennoch führen die Methode des reflektierenden Lesens und das Bemühen um eine Zusammenschau der Phänomene oft zu neuen Beobachtungen und Interpretationsansätzen, sowohl in formaler wie inhaltlicher Hinsicht. Gerade an besonders kritischen Punkten, wo die Forschung immer wieder eingehakt hat, kann der Blick auf Parallelstellen und Typenvariation weiterhelfen. Formeln und epische Beiwörter können in ihrem Gebrauch Tradition und Innovation durchaus vereinigen. Das Temperament des „fußschnellen Achill“ kann sich auch im raschen Wortwechsel äußern, Odysseus und Achill sind „Städteeroberer“ auf ganz unterschiedliche Weise. Verstummen und Schweigen handelnder Personen müssen nicht unbedingt Anzeichen kompositorischer oder genetischer Bruchstellen sein, scheinbare Dubletten und Wiederholungen von sprachlichen Wendungen oder ganzen Szenen dienen bei genauerem Hinsehen oft der Intensivierung oder Differenzierung, und ein stimmungsvoller Märchen- oder Romanausklang eignet sich nicht unbedingt auch als Schlusspunkt im Spannungsbogen eines frühgriechischen Epos. Bei der Einführung von Göttern und Menschen, wie auch in der Schilderung von Befestigungsanlagen und Bestattungsbräuchen, Waffen und Gerätschaften können sich mythische Vorgabe, dichterischer Zweck und reale Gegebenheiten so eng verbinden, dass die Analyse sich auf Hypothesen beschränken muss. Ein ausdrücklicher Hinweis wird dabei in der Regel vermieden, denn der Kenner wird in solchen Fällen die Neuansätze unschwer erkennen, den unbefangenen Leser könnte das Argumentieren eher stören. Seiner weiterführenden Information dient ein wie die einzelnen Kapitel selbst exemplarisch angelegtes Literaturverzeichnis, das vor allem rasch zugängliche Hilfsmittel, aber auch ältere und entlegenere Arbeiten aufführt, insoweit sie für unseren Ansatz von Wichtigkeit sind, informierende Hinweise können dazu weiteren Aufschluss geben. Im Anhang erleichtern neben dem Stellenregister ein Verzeichnis der antiken Eigennamen sowie eine Stichwortliste die Orientierung im Buch, wozu auch die Marginalien dienen sollen. Die Abbildungen fungieren als Zeugnisse der phantasiefördernden Wirkkraft Homers. Dem Vasenbild von Achill und Patroklos entspricht in der Ilias nur eine ähnliche Szene zwischen Patroklos und Eurypylos (Il. 11,844–848), Hermes und Athene sind neben Sarpedon und Nausikaa zusätzlich eingefügt, und das Idealbildnis des blinden Homer führte bei Goethe zu einer Vision: „Dies ist der Schädel, in dem die ungeheuren Götter und Helden so viel Raum haben, als im weiten Himmel und der grenzenlosen Erde …“
Pro captu lectoris habent sua fata libelli – je nachdem, wie der Leser sie aufnimmt, haben die Büchlein so ihre Schicksale. Der Satz des Terentianus Maurus (v. 258) wird meist nur in seiner zweiten Hälfte zitiert und vor allem auf die Entstehungsgeschichte eines Buches bezogen. Ilias und Odyssee zeigen, dass gerade auch die Wirkungsgeschichte wichtig ist für das Schicksal eines Werks. Beides gehört zusammen, das Verhältnis des Autors zu seinem Publikum bestimmt von Anfang an die Gestalt des Textes, und sein Nachleben hängt ab vom Interesse der Leser.
Zur Beförderung dieser Anteilnahme will vorliegendes Büchlein einen bescheidenen Beitrag leisten, und auch sein Entstehen kennt ein gewisses Auf und Ab. Am Anfang standen unzählige Gespräche mit Menschen von ganz unterschiedlichen Interessen und ungleichen Vorkenntnissen, aber immer gleicher Aufgeschlossenheit und Neugierde. Ihre Fragen und Anregungen, auch gelegentliche Erfahrungen und Enttäuschungen ermutigten zu einem Versuch, vorhandene Motivationen zu befördern.
Die Zusammenarbeit zweier Autoren brachte Vorteile und Nachteile mit sich. Im beständigen Zwiegespräch wurden immer wieder neue Aspekte zur Geltung gebracht, bedingt durch die unterschiedlichen wissenschaftlichen Erfahrungen. Neben den methodischen traten auch stilistische Differenzen hervor, die zu mehrfachen Umarbeitungen der Texte führten, bis schließlich so viel Übereinstimmung erzielt war, dass sich der Anteil der Autorin oder des Autors nicht mehr herausfiltern ließ. Von Anfang an war klar, dass man in jeder Hinsicht exemplarisch vorgehen musste, doch das brachte die Problematik der Auswahl, die Qual des Zwangs zum ständigen Weglassen, und das Bedauern wegen des Übersehenen mit sich. Auch das imaginäre Zwiegespräch mit dem Publikum konnte zu Zweifeln führen: War man zu leicht oder zu schwer im Ansatz, zu seicht oder zu tief im Gedanken, zu einseitig, zu tendenziös, zu aktualistisch bei der Interpretation? Die Antworten des Lesers werden wohl unterschiedlich ausfallen, je nach seiner Herangehensweise.
Die überwiegend positiven Reaktionen der Leser und Kritiker rechtfertigen nun nach zehn Jahren eine neue und korrigierte Sonderausgabe. Wenn den „Deutschen Lehrern im Ausland“ gesagt wurde, das Buch könne rundum empfohlen werden, so mag es nun auch im Inland wieder neue Leser finden. Maßgeblich konzipiert im Grabungshaus von Troja, stellte es die grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit. Erste Voraussetzung dafür ist das Verständnis des Werks als solches, seiner Kunstmittel und seines Kunstwollens. Die dazu neu eingeführten Begriffe von „Hyperrealismus“ und „Hyperhistorizität“ beschreiben das artifizielle Verhältnis des Epos zur Archäologie und Geschichtswissenschaft. Sie nehmen Stellung zu den im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts im sog. „Troiastreit“ wieder aufgeworfenen Fragen, ob es überhaupt einen trojanischen Krieg gab, und ob die Befunde von Hissarlik seinen Schauplatz adäquat widerspiegeln.
Inzwischen ist die Hitze der Diskussionen etwas abgekühlt, das Feuilleton und die Wissenschaft haben sich wieder dem eigentlich literaturwissenschaftlichen Interesse zugewendet. Insofern ist unser ursprüngliches „Hauptanliegen, die Beschreibung einer ureigenen Kunstwelt“, wie es Walter Jens erkannt hat, von unveränderter Relevanz: Dem modernen Leser der homerischen Texte soll der Zugang zu dieser faszinierenden Kunstwelt ein wenig erleichtert werden, sei es durch eine Übersetzung oder auch im Original.