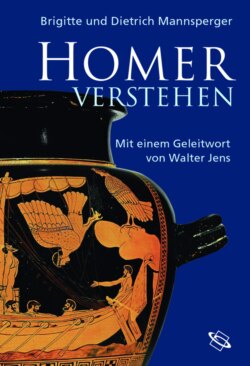Читать книгу Homer verstehen - Dietrich Mannsperger - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Versmaß, Sprachform und Wortwahl
ОглавлениеEine wichtige Aufgabe für den Leser ist es von Anfang an, sich mit der spezifischen Vers- und Sprachform des Epos anzufreunden. Dies gilt für die unterschiedliche Umformung in den Übersetzungen, vor allem aber natürlich für die Sprache des Originaltextes, von der auch der des Griechischen nicht Mächtige sich wenigstens eine gewisse Vorstellung verschaffen sollte.
„Ándra moi énnepe Moúsa polytropon hós mala pólla“.
Versmaß und Übersetzung
Der Eingangsvers der Odyssee bringt das Versmaß des Hexameters, der sechsmaligen regelmäßigen Folge von langen und kurzen Silben, in der Grundform: Fünfmal nacheinander erklingt der Daktylos (d.h. „Finger“, wohl nach dessen Proportionierung in ein längeres und zwei kürzere Glieder) in der Abfolge „lang – kurz – kurz“, das abschließende sechste Metron („Maß“) ist zweisilbig „lang – kurz“ oder „lang lang“. Diesen gleichmäßig rollenden Rhythmus haben die deutschen Übersetzer gewöhnlich nicht genau nachgebildet; vorhanden ist er bei Anton Weiher:
„Muse! Erzähl mir vom wendigen Mann, der die heilige Feste …“
Bei Johann Heinrich Voß: „Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes …“ und Thassilo von Scheffer: „Nenne mir, Muse, den Mann, den vielgewandten, der vielfach …“ hingegen, um nur zwei Beispiele zu nennen, werden im vierten bzw. dritten und vierten Metron die zwei Kürzen durch eine Länge ersetzt. Dies ist – auch im Griechischen selbst – nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht, weil dadurch die klappernde Monotonie variiert und die Möglichkeit zu besonderen Akzentuierungen, aber auch zur Unterbringung sperriger Wörter eröffnet wird. Schon der Anfang der Ilias kann dies belegen:
Die drei Langsilben im dritten und vierten Metron sind bedingt durch die zwei langen E-Laute in der Namensform „Pēlēiade“, dem Vatersnamen des Achill („Sohn des Peleus“), der dadurch auch metrisch besonders hervorgehoben und als Hauptperson des Epos gekennzeichnet wird. Die Übersetzer können die eindringliche Wirkung des verlangsamten Rhythmus entsprechend durch Ersetzung von zwei unbetonten durch eine betonte Silbe erzielen:
Im Deutschen, wo Silbenlänge durch Silbenakzent ersetzt wird, ist das zweite lange E in „Peleïade“ vernachlässigbar; die zwei hart aneinander gesetzten betonten Silben im zweiten (Voß, „Zorn o“) bzw. dritten Metron (Scheffer, „Groll des“) heben statt des Helden selbst das Hauptmotiv des Epos, seinen Zorn oder Groll (mēnis) hervor. Damit ist die besondere Betonung der mēnis – im Original dem Eingangswort des Verses mitgegeben, in den Übersetzungen jedoch auf „Singe …“ verlagert auf andere Weise wiedergewonnen.
Schadewaldts rhythmische Prosaübersetzung konnte, da nicht an das Versschema gebunden, näher an der ursprünglichen Wortstellung und Akzentuierung bleiben:
Verseinschnitte
Zusätzliche rhythmische Stilmittel des Hexameters bestehen in der Gliederung des Verses durch bestimmte Einschnitte (Caesuren, Dihairesen) an charakteristischen Gelenkstellen, wobei jeweils ein Wortende das Atemholen für den Rezitator oder Sänger ermöglicht. Drei der am häufigsten vorkommenden Pausen finden wir gleich in den Eingangsversen beider Epen:
Im Iliasvers liegt die Pause hinter der dritten Langsilbe bzw. dem fünften Halb-Metron. Der Metriker nennt diese Zäsur daher Penthemimeres. Die Odyssee zeigt den stärkeren, klingenden Einschnitt nach der ersten Kurzsilbe des dritten Metrons, die sog. Zäsur kata triton trochaion, und zugleich die besonders häufige, in nahezu zwei Dritteln aller Homerverse vorkommende Trennungspause nach dem vierten Metron, die Bukolische Dihärese, sogenannt nach ihrer Vorherrschaft in den Hirtengedichten der bukolischen Poesie.
Die Atempausen ermöglichen zugleich einen markant hervorhebenden Neueinsatz, der ähnlich wie die Stellung am Versanfang bestimmte Begriffe betont. In der Ilias fällt somit mēnis und Pēlēiade, in der Odyssee andra und, zwischen Zäsur und Dihärese herausgehoben, polytropon besonders ins Ohr: „Der Zorn des Peliden“ und „Der Mann, der vielgewandte“ – also die Leitthemen beider Epen.
Grundform und Variation
Neben der Möglichkeit, zwei Kurzsilben durch eine Länge zu ersetzen, und der Variation durch unterschiedliche Zäsuren wirkt auch das Herüberziehen der Satzkonstruktion über das Versende (das sog. Enjambement) der Monotonie entgegen, wobei sich zugleich weitere Möglichkeiten der Hervorhebung ergeben: „Mēnin aeide …“, „den Zorn singe“, beginnt der erste Vers der Ilias, oulomenēn, „den Verderblichen“, nimmt der Anfang des zweiten Verses mit erneuter Betonung wieder auf, um dann in einem Relativsatz weitere Informationen anzuknüpfen: „… der den Archaiern unzählige Leiden brachte“. In der Odyssee beginnt der erläuternde Relativsatz bereits im ersten Vers „Den Mann, der vielerorts …“, der Eingang des zweiten Verses bringt dann betont das markante Verbum planchthē, „umherirrte“.
Die Spannung zwischen fester regelhafter Form und vielfältig möglicher Variation verleiht dem Hexameter seine Lebendigkeit und Anpassungsfähigkeit. Die sechs Langsilben jeden Verses, die nicht in Kürzen aufgelöst werden dürfen, wirken als tragende Pfeiler des Grundrhythmus, um die sich die dem Inhalt angepasste Sprache rankt:
Der Gesang der Musen klingt wider in drei gleichmäßig perlenden Daktylen eines Hexameters, der zusätzlich durch den vollen Klang eines Binnenreims vor Zäsur und Versende Musikalität gewinnt:
Lautmalerei
Keine der vorliegenden Übersetzungen kann den Reim Mousai – echousai ohne Gewaltsamkeit wiedergeben, andere Freiheiten, wie die Apostrophierung von Schluss vokalen (dōmat’), Verschmelzung zweier Vokale, unterschiedliche Messung von Diphthongen je nach Folgelaut (oi – ai), epische Kürzung oder Dehnung spielen in den modernen akzentuierenden Sprachen nicht die gleiche Rolle.
Das Getümmel und Geklapper der Holzfällerbrigaden wird in einem Iliasvers gegenwärtig, überwiegend akustisch:
Der Gleichklang von Daktylenfolge, Reimanklängen und inhaltlicher Aussage ist nur im Originaltext nachvollziehbar. Auch eine metrisch getreue Übersetzung geht nicht so unmittelbar ins Ohr:
Wo es vorwiegend der Rhythmus ist, der die Lautmalerei hervorbringt, kann man dem Original schon näher kommen: Der Stein des Sisyphos poltert hörbar in einem rein daktylischen Vers,
Der griechische Hexameter ist so in der Lage, poetische Schilderungen in epischer Dramatische Breite zu entfalten, wie die Entfesselung eines Seesturms durch den Meergott Posei-Schilderung don (Od. 5,291–296):
„So sprach er, versammelte die Wolken und rührte das Meer auf,
den Dreizack in Händen haltend. Alle Wirbel erregte er
der vielfältigen Winde, mit Wolken verhüllte er
Erde zugleich und Meer. Es erhob sich vom Himmel her Nacht,
und in eins zusammen fielen Ostwind und Südwind und Westwind, der Übelwehende
und der Nordwind, der Äthergeborene, eine mächtige Woge wälzend“.
Das Tosen der drei widrigen Mittelmeerwinde aus Osten, Süden und Westen fällt zusammen im Wirbel der vier Daktylen von Vers 295, der stetig wehende Nordwind, der aus heiterer Himmelshöhe kommt mit großem Wogenschwall, wird in drei Langsilben damit kontrastiert.
Sammel- und Merkverse
Neben seiner Fähigkeit zur Stimmungs- und Lautmalerei zeigt diese Passage zugleich die Eignung des Hexameters als mnemotechnisch eingängiger Merkvers für Namenskataloge: Die vier Winde Euros, Notos, Zephyros, Boreas sind hier in knapps ter Form gebündelt und charakterisiert, ähnlich wie in der Ilias die Flüsse des Ida gebirges,
oder in der Odyssee die Inseln im Reich des Odysseus bei Ithaka:
Sentenz und Lakonismus
Dabei werden jeweils der „göttliche Skamander“ und die „waldreiche Zakynthos“ besonders hervorgehoben. Die geschmeidige Vielfalt des Hexameters eignet sich nicht nur für behäbige, episch breite Ausmalung und schematische Wiederholung von Versen, Versgruppen und stehenden, sog. „schmückenden“ Beiwörtern, wie vielfach angenommen wird. In gleicher Weise ist er fähig zu äußerster Knappheit, sowohl für programmatisch zugespitzte Lehrsätze:
wie auch für eine lakonisch knappe Mitteilung in direkter Rede: „keitai Patroklos,
Doch die Waffen hat der helmschimmernde Hektor“ (Il. 18,20f.).
Form und Inhalt
Wer sich in den Klang der epischen Metrik eingehört hat, dem wird deutlich, dass Versform und Inhalte dieser Literaturgattung in enger Verbindung gemeinsam erwachsen und zur Vollendung geführt sind. Eine Überbetonung der Formelhaftigkeit der Sprache und der Regelhaftigkeit der Metrik verführt jedoch dazu, eine über Jahrhunderte reichende handwerklich starre Tradition zu postulieren, in der der Hexameter zum mechanischen Vehikel für vorgeformte Inhalte wird. Man hat versucht, für einzelne Iliasverse, wie etwa den mit getrennt zu sprechendem Diphthong o-ū,
„vor Ilion zuvorderst und dem Skäischen Tore“ (Il. 22,6),
eine vorhomerische Sprachform zu rekonstruieren, die sich besser dem Hexameter einfüge als die „zu Homers Zeit gesprochene Sprache“.
Vehikel der Tradition? — Verkehrs- und Literatursprache — Rückübersetzung in frühere Sprachformen — Älteste Hexameter
Gerade bei diesem Vers wäre eine so frühe Datierung von besonderer Relevanz, da er inhaltlich aufs engste verbunden ist mit dem Endkampf zwischen Hektor und Achill vor dem Skäischen Tor. Damit hätte man einen Beweis dafür, dass die zentrale Handlung der Ilias, und auch die von manchen Interpreten für eine späte Erfindung gehaltene Figur des Stadtverteidigers Hektor, schon einer „alten Troia-Geschichte“ angehört und in hexametrischer Form aus der Bronzezeit überliefert ist. Als problematisch erweist sich bei dieser Hypothese die äußerst unsichere Überlieferung; einerseits beruht unser überlieferter Homertext und seine metrische und orthographische Form auf der Fixierung und Normierung durch die hellenistischen Philologen, andererseits wissen wir über das Griechisch des 8. oder 13. Jahrhunderts nur wenig durch Schriftzeugnisse, über die gesprochene oder gesungene Sprache so gut wie überhaupt nichts. Formelhafte Wendungen und wörtliche Wiederholungen haben zur Annahme einer langen mündlichen, spontan improvisierenden Tradition geführt. Die oft zum Vergleich herangezogene südslawische Sängerdichtung zeigt jedoch bei näherer Betrachtung eine handwerkliche Schlichtheit, die der hochdifferenzierten Literatur des Epos sehr fern steht: Hier ist es gerade die Spannung zwischen Formelhaftigkeit und Variation, die überraschende Abwandlung des Vertrauten, die Anpassung an individuelle Aussagen, die an die Kennerschaft eines bestimmten Publikums appellieren. Dieses Publikum gehört dem Zeitalter der großen griechischen Kolonisationsbewegungen des 8. vorchristlichen Jahrhunderts an, als man die Enge der heimischen Polis und ihres angestammten Dialektes verließ. Man traf sich in den Hafenstädten und überregionalen Heiligtümern, man musste sich sprachlich verständigen, die Dichter griffen die Verkehrssprache auf und verfeinerten sie zu einer allgemein gültigen Literatur-Sprache. Die Hauptträger der Kolonisation waren Städte des ionischen Stammes, Chalkis und Eretria auf der Insel Euböa, später Athen im Mutterland, Milet und Phokaia im zentralen Kleinasien sowie deren Tochterstädte in Ost und West. Im Bereich des Seewegs durch die Meerengen von Dardanellen und Bosporus, nicht zuletzt auch in der Troas und Ilion, hatten sich jedoch schon seit alters Griechen des äolischen Stammes angesiedelt. Ihr Dialekt wurde daher neben dem ionischen zum zweiten Hauptelement der Dichtersprache Homers, und es ist auch kein Zufall, dass man die Heimat des Dichters immer, auch schon in der Antike selbst, im äolisch-ionischen Grenzbereich zwischen Smyrna und Kyme angenommen hat. Eine klare Trennung nach Sprachschichten sowie die Rückübersetzung Homers in eine eventuelle äolische Urfassung erweisen sich als ebenso fraglich wie die ins „Mykenische“. Selbst scheinbar eindeutige Äolismen, wie z.B. ptolis (Il. 2,130) oder ptoliethron (Od. 1,2) für polis, die „Stadt“ Troja, könnten sich als bloß altertümliche oder metrisch bedingte Formen erweisen. Eindeutig ist nur die überregionale Verbindlichkeit und Verständlichkeit dieser Einheits-Sprache, vergleichbar mit ähnlichen Erscheinungen in mittelalterlichen Literatursprachen, etwa den nordfranzösischen Elementen im südfranzösischen Epos oder der stark südwestdeutsch geprägten mittelhochdeutschen Dichtersprache bis hin zu Luthers Bibelübersetzung. Einzelne besonders altertüm liche Vokabeln, wie etwa anax (der anax andrōn, „Herrscher der Menschen“, Agamemnon, Il. 1,7), können zwar in die Bronzezeit zurückreichen, wie die Funde von Texten in „Linear B-Schrift“ zeigen. Ein sprachlich und metrisch fixierter Transport von Literaturform und Inhalt über Jahrhunderte hinweg ist damit jedoch nicht bewiesen, so wenig wie durch die Erwähnung von mykenezeitlichen Waffen, wie etwa des Eberzahnhelms (Il. 10,261–271). Vorläufig bleiben zwei Hexameter auf einem spät geometrischen Becher (Skyphos) aus dem letzten Viertel des 8. Jahrhunderts v. Chr. die früheste literarische Überlieferung aus dem Umkreis des homerischen Epos. Der Becher stammt von der Insel Ischia, der Text ist im ionischen Dialekt und im Alphabet der euböischen Kolonien Mittelitaliens geschrieben. Er zeigt metrisch korrekt gegliederte und abgesetzte Hexameter, die sich auf den „Nestor-Becher“ und damit auf eine berühmte Stelle der Ilias (11,632–637) beziehen. Weder metrische noch sprachliche, noch auch stilistische oder literarhistorische Beobachtungen hindern uns also, Entstehung und Blütezeit dieser Heldenepik mit der Neuorganisation der griechischen Welt in Verbindung zu bringen. Das Epos liefert jedoch kein Abbild dieser Welt, sondern es folgt literarischen Gesetzen und moralischen Motivationen. Der Zugang zu seinem Verständnis eröffnet sich daher aus dem Wissen um die poetischen Kunstmittel in Komposition und Einzelausführung sowie um die sachlichen und ethischen Inhalte.
Pompöses Übermaß?
Die vorgegebene äußere Gestalt wie Metrik und alteingeführte feste Wendungen beeinflussen auch den Sprachstil im engeren Sinn bis hin zur Wortwahl im Einzelnen. Eine der ersten Empfindungen bei der Begegnung mit dieser Sprache ist die von überquellender Fülle, von pompöser Wörterhäufung bis hin zum Übermaß, zu bloßem Prunk und Gestelztheit des Ausdrucks oder gar zum hohlen Bombast. Die Übersetzungen haben diesen Eindruck oft noch verstärkt, gerade auch dann, wenn sie sich besonders eng an das Original halten wollten. Der Blick auf eine Verspartie mit durchschnittlicher Sprachhöhe aus dem 1. Buch der Ilias kann das Phänomen verdeutlichen. Bei der klassischen Übersetzung von Johann Heinrich Voß aus dem Jahr 1793, die noch immer die allgemeine Vorstellung von Homer bestimmt, kommt der antiquierte deutsche Sprachstil noch dazu:
Übersetzerdeutsch
„Finster schaut’ und begann der mutige Renner Achilleus: Ha, du in Unverschämtheit Gehülleter, sinnend auf Vorteil! Wie doch gehorcht dir willig noch einer im Heer der Achaier, einen Gang dir zu gehn und kühn mit dem Feinde zu kämpfen? Nicht ja wegen der Troer, der lanzenkundigen, kam ich mit hierher in den Streit; sie haben’s an mir nicht verschuldet. Denn nie haben sie mir die Rosse geraubt, noch die Rinder; nie auch haben in Phthia, dem scholligen Männergefilde, meine Frucht sie verletzt, indem viel Raumes uns sondert, waldbeschattete Berg’ und des Meers weitrauschende Wogen. Dir, schamlosester Mann, dir folgten wir, daß du dich freutest, nur Menelaos zu rächen, und dich, du Ehrevergeßner, an den Troern! Das achtest du nichts, noch kümmert dich solches!“ (Il. 1,148–160).
Abundanz und Prägnanz des Ausdrucks — Episches Beiwort — Synonymhäufung — Schimpfwörter
Zu dem sperrigen Gesamteindruck dieser Zeilen trägt zweifellos auch der Verszwang bei. Aber ein Vergleich mit Wolfgang Schadewadts rhythmischer Prosa von 1975 und der neueren Prosaübersetzung von Joachim Latacz aus dem Jahr 2000 zeigt, dass es vor allem der Sprachstil des Originals selbst ist, der dem Übersetzer und dem modernen Leser Schwierigkeiten bereitet. Bei Schadewaldt lauten die beiden ersten Zeilen „Da sah ihn von unten herauf an und sagte zu ihm der fußschnelle Achilleus: O mir! in Unverschämtheit Gehüllter! Auf Vorteil Bedachter!“, und bei Latacz: „Den sprach darauf von unten blickend an der mit den Füßen hurtige Achilleus: Ach nein! Du ganz in Unverschämtheit Eingehüllter du! Profitverseßner!“ Dabei ist es nicht immer die Abundanz des epischen Ausdrucks, sondern bisweilen gerade die anschauliche Prägnanz der Sprache, die das Verständnis erschwert. Homer kennt nämlich eine ganze Reihe knapper Vokabeln, die sich auch durch einen ganzen Satz kaum erklären lassen. In unserem Beispiel sieht Achill den Agamemnon „hypodra“ an, „untenblickend“, das heißt unter gerunzelter Stirn und herabgezogenen Augenbrauen. Vergleichbare adverbiale Kurzwörter von höchster Konzentration sind die Einsilbler pyx (mit der Faust) und lax (mit dem Fuß), sowie Bildungen wie odax (mit den Zähnen) oder angkas (im Arm). Will man Derartiges in gleicher Knappheit wiedergeben, so bleibt meist nur die Umsetzung, also beim Blick des Achill „finster“ wie bei Voß, für das sich auch andere Übersetzer entschieden haben. Auf der anderen Seite sind es vor allem die reichlich gesetzten epischen Beiwörter, die den Text umständlich erscheinen lassen, und ganz besonders dann, wenn sie konventionell, unnötig oder gar unpassend erscheinen. Achill ist in der Streitszene eigentlich wütend, aber „schnell“ höchstens mit Worten, und „schnell im Hinblick auf die Füße“, wie das originale podas ōkys besagt, nur im Wettlauf und Kampf. Das epische Beiwort ist hier tatsächlich mehr wesenhaft mit dem Träger verbunden, unabhängig von der spezifischen Situation, die Formel füllt den Versschluss in bequemer Weise aus. Ähnlich verhält es sich mit den Attributen von Berg und Meer, „schattig“ und „tosend“; bei Voß werden sie zu „Waldgebirge voller Schatten“ und „Meer in tosendem Gewoge“, bei Schadewaldt bleibt es bei „schattige Berge und das Meer, das brausende“, Latacz übernimmt von Voß das „Meer in tosendem Gewoge“ und erweitert noch zu „Waldgebirge voller dunkler Schatten“. Der Kontext in der Rede Achills besagt, dass er eigentlich keinen Kriegsgrund gegen die Troer hatte, die so weit von seiner Heimat entfernt wohnen, durch Berge und Meer getrennt, die dunkel und tosend, also unbequem zu überwinden sind: Die Adjektive scheinen also doch nicht ganz zufällig ausgewählt zu sein. Passend sind offensichtlich diejenigen für Achills Heimatland Phthia, das „tiefschollig“ und „menschenernährend“ genannt wird; man könnte allenfalls sagen, dass sie etwa dasselbe bedeuten, nämlich „fruchtbar“ und deshalb tautologisch zum übertriebenen Pomp beitragen. Aber gerade durch ihre leichten Nuancen leisten sie einen zusätzlichen Beitrag zum Preis einer reichen Gegend, wo es Pferde und Rinder zu rauben und Kornfelder zu verwüsten gibt: Tiefe Ackerkrume nährt viele Männer, und diese bedeuten militärische Macht. Auf den zweiten Blick zeigt sich also auch hier die überraschende Stimmigkeit des Ausdrucks, was für viele der „Synonymhäufungen“ gilt. Genau genommen gibt es eben gar keine echten Synonyma, und das so häufige Phänomen des „eines durch zwei“ (hen dia dyoin) ist ein probates Mittel, um einen differenzierten Sachverhalt begrifflich zu umtasten. Dies gilt auch da, wo zwei inhaltlich verwandte Verba nebeneinander gesetzt werden, in unserem Text „du kehrst dich nicht daran, und du kümmerst dich nicht darum“; zumindest erhöhen sie die Emotionalität der Situation und der Rede. Denselben Effekt erzielt die Anaphernserie von fünf Negationen nacheinander, „nicht – nicht – nicht, und auch nicht, und auch nicht“, eine Spezialität, die das aufbrausende Temperament des Peliden auch in anderen seiner Redeausbrüche bezeichnet. Von der unerschöpflichen Erfindungsgabe bei der Bildung von Schimpfwörtern geben die zitierten 13 Verse ebenfalls einen guten Eindruck, von „mit Schamlosigkeit bekleideter“, „profitgesonnener“ und „großschamloser“ bis zu „hundsgesichtiger“– bei Schrott wird kerdaleophŕon zu „hemdausziehend“. Das letztgenannte Adjektiv kynōpēs ist zusammengesetzt aus „Hund“ und ops, das Gesicht, wobei der eigentliche Ausdruck des „Blicks“ betont wird. Mit diesem Schimpfwort bedenkt gelegentlich Helena sich selbst, Hephaistos seine Mutter Hera und seine ungetreue Gattin Aphrodite (Il. 3,180; Od. 4,145; Il. 18,396; Od. 8,319). Nach demselben Muster gebildet sind die kultischen Beinamen von Hera und Athene, „kuhgesichtig“ und „eulengesichtig“ (boōpis, glaukopis), wobei auch hier die Menschengestalt der Götter den Akzent auf die Art ihres Blickes verschoben hat: Dem Schimpfwort „profitgesonnen“ für Agamemnon setzt Achill sogleich das positive „wohlgesonnen“ für die anderen Kampfgenossen entgegen, prophrōn gegen kerdaleophrōn, und spielt so mit der Wortbildung, wie es in anderen Fällen mit der Konjugation geschieht oder der Etymologie, z.B. „wollend die wollende“ (ethélōn ethélousan, Od 3,272) oder „Gäste gastlich bewirten“ (xeinous xeinizein, Od. 3,355).
Zu nuancenreicher Abundanz und treffender Prägnanz der Wortwahl kommt noch die Fülle einsilbiger Partikel, über die das Griechische verfügt. Auch sie bietet dem Epiker zugleich inhaltliche wie technische Möglichkeiten, durch die er Aussagen fein modifizieren und zugleich die Daktylen des Hexameters korrekt auffüllen kann. Beispiele dafür bietet wiederum die Rede des Achill, wie „nicht etwas mir“ (ou ti moi) oder „denn noch nicht jemals“ (ou gar pō pot’).
Schon die wenigen Hinweise mögen genügen, um den hoch entwickelten Kunstcharakter dieser Literatursprache anzudeuten. Sie ist offensichtlich geschaffen für ein Publikum, das den tönenden Prunk genoss und die Feinheiten nachvollziehen konnte, während der moderne Leser oft seine Schwierigkeiten damit hat. Aus diesem Grund werden unsere Textparaphrasen und Übersetzungen gelegentlich bewusst verschlankt und im Ausdruck entlastet oder auch leicht interpretierend modifiziert, um den besseren Durchblick zu gewährleisten. Das mag ein bedauerlicher Eingriff sein, der aber doch der Hinführung zum Werk als Ganzem dienen kann.