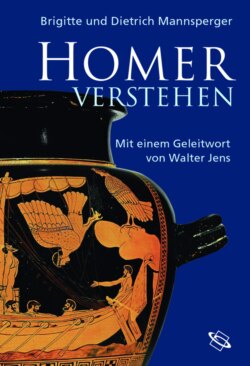Читать книгу Homer verstehen - Dietrich Mannsperger - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Raum und Zeit: Schauplätze und Zeitdimension
ОглавлениеSchauplätze und Abläufe — Verwandlung von Daten und Fakten
In literarischen Zusammenhängen sind „Raum“ und „Zeit“ keine abstrakten, vorgegebenen Begriffe. Vielmehr ist es die Dichtung selbst, die auch hier ihre eigenen Relationen und Dimensionen hervorbringt und dabei eine beträchtliche Suggestionskraft entwickelt. Die in den Epen geschilderten Ereignisse entwickeln sich so anschaulich auf bestimmten Schauplätzen und in so nachvollziehbaren Zeitabläufen, dass man schon immer versucht war, sie in einer geographischen und historischen Realität zu fixieren. Die scheinbar so präzisen Angaben provozieren geradezu den Wunsch, jedes Detail in der Wirklichkeit zu suchen und zu finden, führen dabei aber oft in die Irre, liefern sie doch weder reine Geländebeschreibungen noch Geschichtsberichte. Gerade auch an der Gestaltung von Geographie und Topographie sowie der Behandlung der Zeitangaben lassen sich gemeinsame künstlerische Tendenzen der homerischen Realitätswiedergabe erkennen. Dabei kommt es durchaus zu gattungseigenen Strukturen, hervorgerufen durch ganz bestimmte Kunstgriffe und Absichten, mit denen die scheinbar vertrauten Erscheinungen immer wieder verfremdet werden. Alle Daten und Fakten unterliegen grundsätzlich den Erfordernissen der Handlung und Darbietung, sie erfahren irreale Verwandlungen und Verbiegungen wie etwa Pauschalisierung von Zahlenangaben, Raffung oder Dehnung von Entfernungen und Zeiträumen, oder auch mythische Überhöhung und Distanzierung.
Epen-Chronologie
In Ilias und Odyssee liegt der Beginn der Handlung erst im zehnten bzw. zwanzigsten Jahr nach der Ausfahrt der Achäer zum Kriegszug, und damit jeweils im letzten Jahr vor der Eroberung Trojas und der Heimkehr des Odysseus nach Ithaka. Das schließt von vorne herein eine lineare Erzählung der Ereignisse aus, soll sie vielmehr gerade vermeiden. In beiden Epen wird in markanter und weitgehend identischer Weise auf die zeitliche Dimension hingewiesen, nahezu an der gleichen Stelle des Textes. Kaum ist im 2. Buch die Handlung so richtig in Gang gekommen, da erfahren wir aus dem Mund eines Sehers den exakten Zeitpunkt, den vom Schicksal vorgegebenen Wendepunkt, den der Dichter zum Einstieg benützt.
In der Ilias wird an das Vogelzeichen der neun Sperlinge erinnert, das von Kalchas so gedeutet worden war, dass nach neun vergeblichen Jahren im zehnten die Eroberung Trojas erfolgen müsse, und in der Odyssee beruft sich Halitherses auf seinen alten Seherspruch, dass jetzt, im zwanzigsten Jahr nach dem Aufbruch, Odysseus zurückkehren werde (Il. 2,308–332; Od. 2,170–176).
Geraffte Zeiten
Aus diesem letzten, entscheidenden Jahr werden dann rund 50 bzw. 40 Tage he raus gegriffen, auf die sich die Ereignisse konzentrieren, und auch davon werden größere Zeitspannen nur referiert: neun Tage wütet die Pest im Lager der Achäer, elf Tage weilen die Götter bei den Äthiopen am Okeanos, elf Tage schleift Achill den Leichnam Hektors um den Grabhügel des Patroklos, neun Tage holen die Troer Holz für den Scheiterhaufen Hektors (Il. 1,53; 425 und 493; 24,31; 784).
Odysseus baut während vier Tagen an seinem Floß, 17 Tage gleitet er mit günstigem Wind dahin, zwei Nächte und zwei Tage treibt er schiffbrüchig im Meer (Od. 5,262; 278; 388). Auch die Spannen von sechs oder neun Tagen, die er von einer Station zur anderen auf seinen Irrfahrten braucht, sind geraffte Daten. Kürzere Zeitangaben über Reisestrecken sind durchaus plausibel abgewogen, so dass man ver suchen konnte, sie experimentell nachzuvollziehen: Das Schiff mit den Sühnegaben für Apollon gelangt in wenigen Stunden vom Schiffslager nach Chryse und ebenso wieder zurück, Telemachos braucht mit dem Wagen von Pylos nach Sparta, und genauso für die Rückreise, zwei Tage (Il. 1,430–435; 477–487; Od. 3,485–497; 4,2f.; 15,182–193). In beiden Fällen wird gewissenhaft auch die Übernachtung angegeben, dennoch bleibt für eine archäologisch zuverlässige Lokalisierung von Schiffslager, Chryse und Pylos immer noch allzu viel Spielraum, wenn auch die raum-zeitlichen Proportionen als solche stimmen mögen.
Tagesabläufe
In ihrem gesamten Verlauf vom Morgen über den Mittag bis zum Abend und in die Nacht hinein werden nur wenige Tage anschaulich und nachvollziehbar mit erzählter Handlung erfüllt. Dazu gehören der zweite und vor allem der dritte Kampftag in der Ilias sowie der Aufenthalt des Odysseus bei den Phäaken mit zwei Nächten und einem ganzen Tag, bei Eumaios mit zwei Tagen und einer Nacht, und schließlich wieder im eigenen Haus mit zwei Tagen und zwei Nächten, wobei die letzte von Athene künstlich verlängert wird (Il. Buch 8–10 und 11–18; Od. Buch 5–12, 13–16, 17–23).
Relativität der Zeitangaben
Diese vom Dichter ausdrücklich erwähnte Manipulation der Zeitdauer im In teresse der Handlung beweist die grundsätzliche Unterordnung oder auch Relativität der Zeitangaben: Das wiedervereinigte Paar Odysseus und Penelope muss genügend Gelegenheit zur Liebe und zum Erzählen erhalten, deshalb wird die Nacht verlängert. Schon bei den Phäaken hatte sich die Erzählung der Irrfahrten fast bis zum Morgen erstreckt, und jetzt muss ja auch Penelope noch ihre Leiden erzählen, da konnte eine normale Nacht unmöglich hinreichen. „Und nun wäre ihnen über all dem Klagen schon das Morgenrot erschienen, hätte die Göttin Athene nicht anderes erdacht: Fest hielt sie an ihrer Grenze die lange Nacht, die goldthronende Eos hemmte sie am Okeanos, und auch die Pferde ließ sie nicht anschirren, die den Menschen das Tageslicht bringen …“ (Od. 23,241–246, vgl. 344–348). Dieser eine Fall von übernatürlicher Zeitdehnung beweist jedoch zugleich, dass die realen Verhältnisse als der eigent liche, maßgebliche Bezugsmaßstab vorausgesetzt werden. Was für die erzählte Handlung in der Zeit zu beachten ist, das gilt auch für die Handlung im Raum.
Großraum mit unscharfer Peripherie
Die Ereignisse von Ilias und Odyssee sind in einen Großraum hineinprojiziert, der von unscharfen Rändern ausgehend immer mehr an Präzision zunimmt, bis sich schließlich geographische und topographische Wegmarken zu durchaus realistisch anmutenden Schauplätzen zusammenfinden. Während die Komposition der Odyssee dabei mehr von der Peripherie her ins Zentrum führt, dominiert in der Ilias von Anfang an der engere Schauplatz, der von Fall zu Fall geographisch und kosmisch erweitert wird.
Das Zentrum ist die Skamanderebene, die nach dem dominierenden Fluss benannt wird und sich von der auf steiler Anhöhe gelegenen Stadt Ilios bis zum Schiffslager am Meeresstrand, oder genauer am flachen Hellespont, hinstreckt. In dieses Heerlager der Achäer führt uns sogleich das erste Buch der Ilias mit dem Auftritt des Apollonpriesters Chryses, dem Ausbruch der Pest und dem Streit der Anführer, während der zweite Fixpunkt, die Stadt der Trojaner, erst im dritten Buch mit der Mauerschau am Skäischen Tor voll ins Bild rückt.
Luftaufnahme der nördlichen Ägäis
Um diesen Kernbereich herum erstreckt sich ein weiterer Kreis. Das Idagebirge, der Berg auf der Insel Samothrake, der Athos und das Massiv des Olymp, wo sich die Götter aufhalten, sowie die übrigen Inseln wie Tenedos, Imbros, Lesbos und Lemnos oder weitere Städte der Troas wie Theben im Süden, Zeleia im Osten, Abydos im Norden. Hinzukommen noch die übrigen Flüsse der Landschaft, Simoeis, Rhodios, Granikos, Aisepos und andere, deren Namen bekannt, deren Lokalisierung für Zeitgenossen und Nachwelt leicht nachvollziehbar war. Diese Landkarte der nördlichen Ägäis entfaltet sich wie eine Luftaufnahme anlässlich der Flugreisen der Götter: Posei don erblickt im 13. Buch von Samothrake aus den Ida, Ilios und das Schiffslager, geht nach Aigai und fährt von dort im Wagen übers Meer bis zu einer Unterwasserhöhle zwischen den Inseln Tenedos und Imbros, wo er die Pferde abstellt und zum Achäerlager aufsteigt. Hera schwingt sich im 14. Buch herab vom Horn des Olymp, über Pierien, Emathia und die beschneiten Gipfel der thrakischen Berge, beim Athos erreicht sie das Meer und kommt nach Lemnos. Dort trifft sie Hypnos, den Schlaf, beide lassen Lemnos und Imbros hinter sich und erreichen die quellenreiche Ida, die Mutter der Tiere, beim Kap Lekton, wo sie das Meer verlassen und über die Waldeswipfel dahinschreiten, der Schlaf versteckt sich auf der Spitze der höchsten Kiefer des Gebirges, und Hera trifft Zeus auf dem Gargaron, dem Idagipfel (Il. 13,10–38; 14,225–232 und 280–293).
Götterschritt und Götterblick — Manipulation der Geographie
Unter den Schritten der Götter schrumpfen die Entfernungen, und die Reise geschwindigkeit erreicht Gedankenschnelle, so bei Hera auf ihrem Rückweg vom Ida zum Olymp (Il. 15,78–83). Auch der Götterblick reicht weiter und ist schärfer als Menschensicht, wenn auch noch immer im Rahmen einer vorstellbaren Realität. Von Troja aus kann man tatsächlich den Berg von Samothrake und den Ida erblicken, gelegentlich sogar den Athos, aber das Erkennen von Einzelheiten auf solche Entfernung ist dem Götterauge vorbehalten, vor allem des Zeus, der sich auf den Gipfel höhen des Gargaron hinsetzt, im freudigen Bewusstsein seiner Überlegenheit, und niederblickt auf die Stadt der Troer und die Schiffe der Achäer (Il. 8,51f.). Wie der natürliche Ablauf der Zeit, so kann jedoch auch die geographische Wirklichkeit gelegentlich im Interesse einer dichterischen Wirkung gewaltsam verändert werden. Das Schiffslager gewinnt in der Ilias zentrale Bedeutung als der eigentlich belagerte und erstürmte Ort. Die Errichtung seines Befestigungssystems hat offensichtlich erst der Dichter dem Mythos eingefügt, und deshalb kann oder muss er es auch wieder beseitigen. Zu diesem Zweck erregen Poseidon und Apollon eine Flut, und der Landesgott Apollon zwingt alle Flüsse des Idagebirges mit Skamander und Simoeis zusammen zum Hellespont, auch wenn sie in ganz andere Meere münden, und lässt sie – wiederum runde neun Tage – zerstörend gegen die Mauer stürmen, bis er sie wieder in ihr natürliches Bett zurückführt (Il. 12,9–33). Bei dieser Gelegenheit manifestiert sich erneut das mythische Zeit- und Geschichtsdenken des Epos, wenn die Jahrhundertflut in die Epoche nach der zehnjährigen Belagerung und Zerstörung Trojas verlegt und damit die Brücke geschlagen wird zu dem Zustand, in dem sich die Gegend den Zeitgenossen des Dichters darbot. Überhaupt gilt für den Kernbereich der Iliastopographie, dass er so realistisch in die Handlung eingebaut ist, dass für die Nachwelt der Eindruck entstanden ist, man könne jederzeit die zurückgelegten Wege nachgehen oder sogar nachrechnen. So sah Schliemann bei seinem ersten Besuch in der Troas 1868 „die Märsche und Gegenmärsche und die Kämpfe der Truppen in der Ebene“ vor seinem geistigen Auge, und für seine Identifikation von Troja auf dem Hügel von Hisarlik spielten die im Epos angegebenen Zeiten und Wegstrecken die wichtigste Rolle.
Ausweitung der Raumperspektive
Noch mehr ausgedehnt wird der engere Schauplatz des trojanischen Krieges dadurch, dass dieser in der Ilias zu einem panhellenischen Ereignis, ja geradezu einem europäisch-asiatischen Konflikt angewachsen ist. Achill stammt aus Nordgriechenland, und er weiß die reale Entfernung von Troja und die Reisezeit für ein Schiff zutreffend einzuschätzen: „Wenn mir der Meeresgott gute Fahrt gibt, könnte ich am dritten Tag in Phthia ankommen“ (Il. 9,362f.). Ein Vergleich mit der modernen Deutschlandkarte zeigt, dass die Strecke von Troja nach Thessalien etwa der von Berlin nach Kassel entspricht (ca. 300 km Luftlinie), dass auch hier also durchaus menschliches Entfernungs- und Zeitmaß angewendet wird. Die Nennung der Heimatorte zahlreicher anderer Helden auf beiden Seiten, vor allem in den Katalogen des 2. Buchs, aber auch anlässlich der einzelnen Kämpfe, erweitert den mit einbezogenen Raum nach Westen um das ganze griechische Festland, die Peloponnes und die umliegenden Inseln, im Osten weit nach Kleinasien hinein, im Süden bis Kreta und Lykien, die Herkunft kostbarer Importstücke und Geschenke lässt auch Zypern, Phönikien und Ägypten am Horizont auftauchen. In der Anordnung des Katalogs der Bundesgenossen der Troer hat man sogar vier auf Troja konzentrierte Handelsachsen erkennen wollen, mit entfernten Außenposten im Nordwesten, Nordosten, Südosten und Süden (Il. 2,844–877).
Homerische Geographie — Randzonen der Oikumene in der Odyssee — Ortskenntnis des Dichters?
Dieser ganze, für Homer und sein Jahrhundert offensichtlich sehr vertraute Lebensraum des östlichen Mittelmeers wurde schon für die Geographen der späteren Antike zum Gegenstand unendlicher Diskussionen um Ortsnamen und Lokalisierungen, nicht zuletzt deshalb, weil das Epos einerseits noch viele ältere Traditionen konserviert, und andererseits das bewegte Zeitalter der griechischen Wanderungen und Kolonisation allenthalben neue Verhältnisse geschaffen hatte. Am äußersten Rande der bewohnten Welt werden die Kenntnisse immer ungewisser, hier scheinen sich nur die Götter noch einigermaßen auszukennen. Rundum fließt der Okeanos, der Vater aller Gewässer, an seinem Ufer im Süden und Osten wohnen die Äthiopen, wo die Unsterblichen an den reichen Opfermählern teilnehmen, und deshalb für das übrige Weltgeschehen abgemeldet sind (Il. 1,423f.; 23,205–207; Od. 1,22–26). Der Erzählraum der Odyssee ist auf den Westen des Mittelmeeres ausgeweitet, der Osten – „jenseits von Euböa“ aus der Sicht der Phäaken (Od. 7,321) – ist ferner gerückt, aber der Grundcharakter des Weltbildes ist derselbe. Anders als in der Ilias setzt die Handlung ein von jener entlegenen Peripherie aus, Poseidon ist bei den Äthiopen und Odysseus auf Ogygia, dem Nabel des Meeres, wo Kalypso wohnt, die Tochter des Atlas. Dorthin kommen selbst die Götter selten zu Besuch, und auch Hermes erst nach langem Flug über die Salzflut (Od. 1,19–26; 48–54; 5,44–58). Diese ins Mythische und Märchenhafte übergehenden Randzonen der Oikumene erhalten in dem Heimkehrer- und Irrfahrten-Epos einen sehr viel größeren Anteil; was in der Ilias nur in Andeutungen berührt wird, erscheint in der Odyssee erweitert und fortgeführt, sowohl im Hinblick auf die historisch-zeitlichen wie die geographisch-räumlichen Verhältnisse. Hier erhalten wir Antworten auf die Frage nach dem weiteren Schicksal der Helden, sei es im Leben oder im Tod, und das führt automatisch in die Ferne und die Unterwelt. Der ganz im diesseitigen Leben angesiedelte zentrale Schauplatz auf Ithaka wird vorbereitend eingeführt in den Büchern 1–4, und dann mit aller Eindringlichkeit in den Büchern 13–24 vorgeführt. Ähnlich wie in der troischen Ebene haben bereits die antiken Fremdenführer damit begonnen, auch auf Ithaka alle Details dingfest zu machen. Man zeigte jeden Baum und jede Bucht, die Nymphenhöhle, den Koraxfelsen, die Arethusaquelle und selbst die Schweineställe des Eumaios, und in der Neuzeit bis in die unmittelbare Gegenwart ist man ihnen vielfach gefolgt, wieder mit Schliemann als dem begeisterten Archegeten. Nicht zuletzt dieser Eindruck der intimsten Ortskenntnis des Dichters hat schon früh dazu geführt, dass auch die Insel des Odysseus Anspruch darauf erheben konnte, Geburtsort Homers zu sein, neben östlichen Städten wie Smyrna oder Chios, die dem Schauplatz der Ilias näher lagen. Allerdings bleiben auch in diesem Bereich immer noch viele Unklarheiten; unumstößliche Fakten stehen neben bloßen Wahrscheinlichkeiten und offensichtlichen Widersprüchen, die zur Vorsicht bei Identifikationen raten. Odysseus höchst persönlich entwirft bei seiner Selbstvorstellung im Phäakenland Scheria – es scheint eine Insel zu sein, aber Zweifel bleiben – geradezu die Seekarte seines Inselreichs: „Ithaka bewohne ich, das weithin sichtbare. Dort ist ein stattlicher Berg, der Neritos, mit Laubwald bewachsen, und rundum gibt es viele Inseln sehr nahe beieinander, Dulichion, Same und das waldige Zakynthos. Ithaka selbst, rau aber gesund, liegt niedrig als äußerste im Meer, nach Westen, die anderen aber daneben nach Osten und Süden“ (Od. 9,19–27). Beim Vergleich dieser Beschreibung mit der Gruppe der ionischen Inseln und ihren modernen Namen zeigen sich erhebliche Unstimmigkeiten, die Wilhelm Dörpfeld einst dazu veranlasst haben, das heutige Leukas zum wahren Ithaka zu erklären. Münzprägungen des 4. Jahrhunderts v. Chr. und ihre Fundorte bestätigen jedoch eher die jetzige Namensträgerin in ihrem Anspruch. Auch in der Odyssee gibt es zwischen der fernen Außenwelt und dem zentralen Schauplatz einen noch einigermaßen vertrauten Mittelbereich. Den erschließen die Reise des Telemachos von Ithaka nach Pylos und Sparta mit ihren genauen Zeitangaben sowie die Erzählungen von Nestor und Menelaos über ihre Heimkehr aus Troja.
Nautische Routenbeschreibung
Nestor gibt dabei eine seemännisch exakte Routenbeschreibung: Von Ilios aus rasch nach Tenedos und Lesbos, dort Beratung über die weitere Fahrt, entweder oberhalb von Chios, dieses zur Linken lassend, bei dem Inselchen Psyria oder am windigen Vorgebirge Mimas vorbei unterhalb von Chios. Ein gottgesandter günstiger Wind bringt die Entscheidung zur direkten Fahrt über das offene Meer nach Euböa, wo man nachts an der Südspitze bei Geraistos landet, und von dort gelangt Diomedes am vierten Tag nach Argos, während Nestor selbst bei anhaltend gutem Wind nach Pylos weiterfährt.
Tatsachenbericht und Seemannsgarn
Menelaos andererseits hat eine achtjährige verzögerte Heimreise hinter sich, die ihn in entfernte exotische Gegenden geführt hat, von denen kostbare Erinnerungsstücke in seinem Palast Zeugnis ablegen. So kam er nach Zypern, Phönizien und Ägypten, ja sogar zu den Äthiopen und dem unbekannten Volk der Eremben, bis sich ihm schließlich in Libyen ein fabelhaftes Schlaraffenland auftat, wo schon den Lämmern die Hörner wachsen, wo die Schafe dreimal im Jahr werfen, wo Herr und Knecht einen Überfluss an Käse, Fleisch und süßer Milch das ganze Jahr hindurch haben. Wenn sich hier schon Tatsachenbericht und Seemannnsgarn vermischen mögen, so gewinnt bei dem Abenteuer mit dem vielgestaltigen Meeresgott Proteus das Märchenhafte die Oberhand. Die Insel Pharos wird zwar korrekt als dem ägyptischen Festland vorgelagert eingeführt, aber eine ganze Tagesreise ins Meer hinaus verlegt, und der Name Aigyptos bezeichnet zugleich Fluss und Land (Od. 3,159–183; 4,81–89; 354–357).
Das Auge des Betrachters
Es wird also deutlich, dass mit größerer Entfernung die Vorstellungen von Raum und Zeit immer unschärfer werden. Dieser periphere Bereich wird mit den phantastischen Abenteuern des Odysseus bis an seine Grenzen durchmessen, doch im Munde des Erzählers der Objektivität ferner gerückt und gegenüber der eigentlichen Handlung relativiert. Allerdings gewinnt auch diese erst in der allmählichen Annäherung von Ogygia über die immer noch mit märchenhaften Zügen ausgestattete Welt der Phäaken bis ins heimische Ithaka ihren suggestiven Wirklichkeitsbezug. Dieser gipfelt in förmlichen Landschaftsbeschreibungen, so wenn Athene dem verwirrten Spätheimkehrer Odysseus den Schleier von den Augen nimmt, damit er die Heimat wieder erkennt: „Hier ist die Bucht des Phorkys, und dies am Ende des Hafenbeckens der feinblättrige Ölbaum, nahe dabei die liebliche luftige Grotte, das Heiligtum der Quellnymphen, wo du so viele Opfer darzubringen pflegtest, und dort der waldbedeckte Neritos-Berg“ (Od. 13,345–352). Die allmähliche Entfaltung der Szenerie vor dem Auge eines Betrachters ist ein Kunstmittel, das der Dichter mehrfach einsetzt. Der Götterbote Hermes steht staunend und entzückt beim Anblick der idyllischen Naturlandschaft rings um die Grotte der Kalypso, und, mit demselben fast identischen Verspaar charakterisiert, bewundert Odysseus den detailreich ausgemalten Palast und Garten des Alkinoos (Od. 5,63–77; 7,84–135; zu vergleichen sind die Verse 75f. und 133f.).
Derartige Schilderungen haben besonders die antike Malerei angeregt, auf dem Esquilin in Rom und in Pompeji sind uns schöne Beispiele dieser sogenannten „Odysseelandschaften“ erhalten. Wenn man darin allerdings eine von der Ilias grundsätzlich verschiedene Sichtweise erkennen will, so ist zu bedenken, dass eine Reiseerzählung die Situation des staunenden Ankömmlings in friedlicher Szenerie viel eher im Repertoire hat als ein Kriegsepos, wo die blumige Aue zum Aufmarschgebiet des Heeres, die neblige Flussniederung zum Abstellplatz des Göttergespanns, die reich bewachsenen Ufer des Skamander zum Kampfplatz werden, und die stimmungsvollen Naturbilder fast ausschließlich der Kontrastebene der Gleichniswelt vorbehalten bleiben (Il 2,459–468; 5,773–777; 21,349–355).
Wie sehr das homerische Epos im griechischen Bewusstsein als die dichterische Zusammenschau aller erfahrbaren Aspekte von Raum und Zeit, von Weltkenntnis und Überlieferung empfunden wurde, zeigt die Darstellung auf einem Relief des Archelaos von Priene im Britischen Museum: Die Personifikationen der Oikumene, des bewohnten Erdkreises mit der Mauerkrone, und des Chronos, der geflügelten Zeit mit der Buchrolle, bekränzen den Dichter von Ilias und Odyssee.