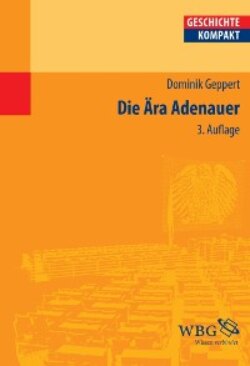Читать книгу Die Ära Adenauer - Dominik Geppert - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Bonn ist nicht Weimar
ОглавлениеNationen, deren Geschichte durch Umbrüche, Verfassungswechsel und den Sturz politischer Regimes gekennzeichnet ist, stehen vor der Notwendigkeit, mit Namen und Begriffen Ordnung zu schaffen. In Frankreich, wo man die Republiken nummeriert, begann 1958 die fünfte. In Deutschland setzte sich die Verbindung mit Städtenamen durch. Das thüringische Weimar, von Februar bis September 1919 Tagungsort der verfassunggebenden Nationalversammlung, verschaffte der ersten deutschen Republik ihren Namen. Das Universitätsstädtchen Bonn, wo der Parlamentarische Rat zusammenkam und später Regierung und Parlament des westdeutschen Teilstaates ihren Sitz nahmen, avancierte zum Synonym für die Bundesrepublik zwischen 1949 und 1990. Die Bezeichnung „Bonner Republik“ wurde zwar erst im Rückblick populär – nach der Wiedervereinigung, dem Umzug der Bundesregierung an die Spree und dem Beginn der „Berliner Republik“. Der Begriff ist jedoch mehr als ein bloßes Konstrukt von Historikern. Bereits Zeitgenossen sprachen von „Bonn“, wenn sie das westdeutsche Staatswesen insgesamt meinten. „Bonn ist nicht Weimar“, lautete zum Beispiel der Titel eines 1956 erschienen Buches des Schweizer Publizisten Fritz René Allemann (1910–96). Darin behauptete dieser, die Entwicklung der zweiten deutschen Demokratie unterscheide sich in wesentlichen Punkten positiv von der 1933 untergegangenen ersten.
Allemanns These überzeugte nicht alle Leser. Fielen nicht auf den ersten Blick wichtige Gemeinsamkeiten ins Auge? Beide Male wurde die Republik aus Krieg und Niederlage geboren. Beide Male markierte sie das Ende eines deutschen Reiches – im einen Fall des Kaiserreichs der Hohenzollernmonarchie, im anderen Fall des angeblich tausendjährigen „Dritten Reichs“ der Nationalsozialisten. Im Hinblick auf die privatkapitalistische Wirtschaftsverfassung und die politische Grundordnung einer repräsentativen parlamentarischen Demokratie ähnelten sich Bonn und Weimar ebenfalls. Zudem fiel auf, dass große Teile der politischen Elite Nachkriegsdeutschlands jener Generation angehörten, die bereits in der Weimarer Republik aktiv gewesen war. Der CDU-Politiker Konrad Adenauer (1876–1967), der Sozialdemokrat Kurt Schumacher (1895–1952) und der Liberale Theodor Heuss (1884–1963), um nur drei prominente Beispiele zu nennen, hatten allesamt zum politischen Establishment der ersten deutschen Republik gehört – der erste als Kölner Oberbürgermeister und Präsident des preußischen Staatsrats, die beiden anderen als Reichstagsabgeordnete der SPD bzw. der Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Angesichts derartiger personeller Verbindungslinien verwundert es kaum, wenn sozialistische und linksliberale Intellektuelle den konservativen Geist der Epoche kritisierten. „Unser Traum von einer Erneuerung Deutschlands ist zu Ende“, schrieb im Oktober 1949 der damals noch in Ost-Berlin lebende Schriftsteller Alfred Kantorowicz (1899–1979). „Die Politiker von gestern haben das Heft nun wieder fest in der Hand, drüben und hüben.“ Der Publizist Walter Dirks (1901–91) sprach ein Jahr später in einem Aufsatz in den „Frankfurter Heften“ von einer regelrechten „Restauration“, die Formen, Symbole und Mächte der Vergangenheit heraufbeschwöre. Männern wie Kantorowicz und Dirks schien der Gedanke abwegig, in Bonn könne gelingen, was in Weimar gescheitert war.
Tatsächlich sprach manches dafür, dass die Ausgangslage nach dem Zweiten Weltkrieg schlechter war als nach dem Ersten. Zwischen 1914 und 1918 hatten deutsche Soldaten bis zum Schluss auf fremdem Boden gekämpft. Seit 1942 kam der Krieg nach Deutschland. Zuerst durch die Luftangriffe, später mit den Soldaten der Alliierten. Allein in den letzten vier Monaten des Krieges wurden 7 Mio. Deutsche durch Bombardements obdachlos. Rund die Hälfte des Wohnraums lag in Trümmern, 20 % der Industrieanlagen, 40 % der Straßen und Eisenbahnlinien waren zerstört. Entsprechend groß war die Not – besonders in den Städten. Das Durchschnittsgewicht von männlichen Erwachsenen lag Mitte 1946 in der amerikanischen Besatzungszone bei 51 Kilogramm. In Köln erreichten Ende 1945 nur 12 % der Kinder das ihrem Alter entsprechende Normalgewicht.
Besonders schlecht ging es den Vertriebenen, die aus den Ostgebieten des untergegangenen Deutschen Reiches, aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn flohen und in langen Trecks nach Westen strömten. Ende 1946 waren es 5,6 Mio., bis 1950 stieg ihre Zahl im Gebiet der Bundesrepublik auf mehr als 8 Mio. Ihre auch nur notdürftige Unterbringung und Versorgung stellte die Verwaltungen vor enorme Probleme. „Rein praktisch“, hieß es im August 1945 pessimistisch in einer britischen Sonntagszeitung, „kann Deutschland, zur Zeit eher ein Land von Höhlenbewohnern, nicht sieben Millionen Neuankömmlinge aufnehmen. Ökonomisch kann es sie auf keinen Fall integrieren – schon gar nicht in eine Wirtschaft, die durch die Demontage von Industrieanlagen, Reparationszahlungen und den Verlust einiger ihrer reichsten Provinzen drastisch reduziert ist. Die Zuwanderer würden für immer arbeitslos, für immer Not leidend und – für immer politischer Sprengstoff sein. Die Ankunft dieser sieben Millionen könnte für ein schwer ausgeblutetes, schwaches, auf dem Weg der Erholung befindliches Land tödlich sein.
Ähnliche Sorgen lösten die gewaltigen Gebietsverluste aus, die Deutschland nach 1945 hinnehmen musste. Pommern, Schlesien und das südliche Ostpreußen fielen an Polen. Der nördliche Teil Ostpreußens mit Königsberg wurde in die Sowjetunion eingegliedert. Auch nach dem Ersten Weltkrieg hatte Deutschland Provinzen verloren, war jedoch ein einheitlicher Staat geblieben. 1949 hingegen war es bereits vor der Gründung der Bundesrepublik und der DDR de facto zweigeteilt. Vorpommern, Mecklenburg, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Sachsen bildeten einen separaten, von der kommunistischen SED dominierten Staat unter sowjetischer Oberhoheit. Alles in allem bedeckte das Territorium der Bundesrepublik nicht mehr als die Hälfte des früheren Deutschen Reiches – 53 % des Staatsgebietes von 1937, 46 % des Territoriums von 1871. Der verbliebene Rest umfasste im Verhältnis deutlich weniger landwirtschaftliche Nutzfläche als die Weimarer Republik. Nicht wenige Ökonomen sorgten sich, wie die westdeutsche Bevölkerung, geschweige denn die Flüchtlinge aus dem Osten ernährt werden könnten.
Auch im Hinblick auf den völkerrechtlichen Status war Bonns Ausgangssituation ungünstiger als diejenige Weimars. Als die Nationalversammlung im Februar 1919 erstmals zusammentrat, war nur das Rheinland von französischen und britischen Einheiten besetzt. Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Mai 1945 hingegen standen Truppen der Alliierten im ganzen Land und herrschten dort mit der uneingeschränkten Macht der Sieger. Diese Situation änderte sich erst, als der amerikanische, britische und französische Militärgouverneur im Mai 1949 ein Besatzungsstatut verkündeten, das mit der Konstituierung der ersten Bundesregierung im September wirksam wurde. In diesem Statut, das Vorrang vor dem Grundgesetz hatte, definierten und begrenzten die Westmächte ihre Befugnisse, behielten sich aber wichtige Zuständigkeiten und Vetorechte vor: für Abrüstungsfragen und wirtschaftliche Entflechtung, für Restitutionen und Reparationen, für Auswärtige Angelegenheiten im Allgemeinen, für die Überwachung des Außenhandels und der Devisenwirtschaft im besonderen. In erster Linie aber sicherten sie sich in der sog. Notfallklausel das Recht, „die Ausübung der vollen Gewalt ganz oder teilweise wieder zu übernehmen, wenn sie zu der Auffassung gelangen, dass dies für die Sicherheit, zur Bewahrung einer demokratischen Regierung in Deutschland und in der Verfolgung der internationalen Verpflichtungen ihrer Regierungen nötig ist“. Rechtlich betrachtet, war die Bundesrepublik zunächst nicht viel mehr als ein gemeinsames Protektorat der drei Westmächte.