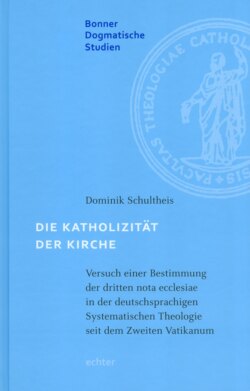Читать книгу Die Katholizität der Kirche - Dominik Schultheis - Страница 20
3.5Verwendung in der mittelalterlichen Theologie
ОглавлениеDie von Augustinus und Vinzenz von Lérins betonte geographische und offenbarungstheologische Dimension der Katholizität wird für das Mittelalter bestimmend.64 Damit geht ein neues Kirchenverständnis einher, dem von Papst Leo dem Großen (440–461 n.Chr.) der Weg geebnet wird und die römische Kirche neben den anderen sich herausbildenden Patriarchaten zunehmend zu einer ordnenden Leitungsgewalt werden lässt. Leo baut nicht nur die Idee der Petrus-Nachfolge des römischen Bischofs weiter aus, dem fortan der Titel „Papst“ zukommt, sondern er verbindet die Idee der Petrusnachfolge mit der Leitungsvollmacht über die ganze Kirche: Der Bischof von Rom erhält neben Synode und Konzil Anteil an der Legislative der universalen (katholischen) Kirche.65
In Folge des Boethius (475/480–525 n.Chr.), der in seinem Werk „De trinitate“66 erstmals von der „fides catholica“ spricht, verbindet man die Idee der Katholizität immer mehr mit der des rechten Glaubens. Dabei kommt der Katholizität sowohl das qualitative Moment der Orthodoxie als auch der quantitative Aspekt der universalen Verbreitung zu.
Die wichtigsten Vertreter der Hochscholastik wie Albert der Große (1193–1280) und Thomas von Aquin (1225–1274) folgen diesem Verständnis. Sie messen der „ecclesia“ die gleichen Eigenschaften wie der „fides“ bei und verstehen die Katholizität im qualitativen Sinne als die „Fülle des Heils“, die der Kirche durch Christus als ihrem Haupt immer schon, d.h. wesentlich (essentiell) zu eigen ist und ihr universale Geltung verleiht.67 Insofern der Glaube aber – weil er sich an alle Menschen aller Orten und aller Zeiten richtet sowie auf letzte Fragen verbindliche Aussagen zu treffen vermag – immer schon universell ausgerichtet ist, kommt der Katholizität neben ihrer qualitativen Dimension zugleich das quantitative Moment der Kontinuität hinzu.68
Diese qualitativ wie quantitativ geprägte Idee der „ecclesia universalis“ bleibt im gesamten Mittelalter bestimmend. Zugleich kristallisiert sich in Folge der von Humbert von Silva Candida herausgegebenen Ekklesiologie „De sancta romana ecclesia“ (1053) und der von Papst Gregor VII. (1073-1085) initiierten Gregorianischen Reform die Kirche von Rom als jene – bei Vinzenz von Lérins noch unbestimmt gebliebene – normative Instanz heraus, welche die offenbarungstheologische Dimension der Katholizität garantiert. Die Kirche von Rom und mit ihr deren Bischof garantieren zunehmend die „Authentizität des universellen katholischen Glaubens […] etwa im Sinne ‚Römisch‘ garantiert ‚katholisch‘ […][und beanspruchten] die Entscheidungskompetenz im Blick auf Einheit und Katholizität der ganzen Kirche“69. Galt die Kirche von Rom seit dem vierten Jahrhundert lediglich als Appellations- und Schiedsinstanz, die in Streitfragen zwischen anderen Ortskirchen vermittelnd eingriff70, vertritt man nunmehr die Auffassung, „mater omnium catholicorum“ zu sein. Da Christus nach Mt 16,18f die Kirche auf Petrus gegründet habe, dieser aber in der römischen Kirche samt ihren Bischöfen fortlebe, sei die römische Kirche als Ursprung und Quelle aller anderen Kirchen anzuerkennen.71 Dies hat zur Folge, dass als „katholisch“ zunehmend das gilt, was „römisch“ ist, d.h. was vom römischen Lehramt (Papst und Bischofskollegium) als verbindlich zu glauben verkündet wird.72 Zwar ist die römische Kirche genauso Ortskirche der Universalkirche wie alle anderen Ortskirchen auch; dennoch gereicht die Kirche von Rom mit ihrem besonderen Bischofssitz über den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus zur Spitze der anderen Ortskirchen. „‘Römischer‘ Glaube ist der durch Petrus geprüfte und entschiedene ‚katholische‘ Glaube. […] Sie [umfasst] in ihrer Romanitas und durch ihren Bischof […] all das authentisch, was die anderen Kirchen zu heiligen, apostolischen und katholischen Kirchen macht“73. Die ursprünglich der Abwehr von Häretikern, der Authentizität des wahren katholischen Glaubens und der Vermittlung in Auseinandersetzungen dienende Vorrangstellung Roms verselbständigt sich immer mehr zum späteren „una sola catholica“-Denken, welches die Herausbildung der „ecclesia Romana“ begünstigt. Durch das „Dictatus papae“ Gregors VII. (1075) und späteren Bestimmungen des IV. Laterankonzils (1215) wird der Primat des Papstes zum einzigen Prinzip der kirchlichen Einheit. Innozenz III. (1198–1216) verbindet die „Katholizität“ mit der „plenitudo potestatis“ des römischen Bischofs, um die Vorrangstellung des Papstes als kirchliche und weltliche Macht zu begründen.74 Weil fortan allein dem Papst die „plenitudo potestatis“ zukommt, hat er ein uneingeschränktes und unmittelbares Eingriffsrecht in alle Angelegenheiten der Ortskirchen. „Damit wird die altkirchliche Idee und Wirklichkeit einer Communio der Bischöfe, deren Kollegialität und Vollmacht einen eigenständigen apostolischen Ursprung besaßen, […] praktisch aufgegeben“75. Mit der römischen Ortskirche an der Spitze der anderen Ortskirchen zeichnet sich nicht mehr nur eine Hierarchie innerhalb der einen katholischen Kirche ab; vielmehr „ist die weltweite Kirche erst durch den Vorsitz der ‚Römischen Kirche‘ katholisch, sozusagen ‚römisch-katholisch‘“76.
Der spanische Dominikaner Johannes de Torquemada (1388–1468) ist es schließlich, der in seiner „Summa de Ecclesia“ die „ecclesia universalis“ mit der „ecclesia Romana“ gleichsetzt und sie mit dem Inhaber des Stuhles Petri identifiziert.77 Er sieht die Katholizität der „ecclesia universalis“ im Papst verwirklicht: Als Haupt der Kirche kommt ihm von Christus her – vor allen anderen und für die anderen – die Fülle der kirchlichen Gewalt zu. So ist der Bischof von Rom als Ursprung und Quelle aller kirchlichen Gewalt das Ganze der Kirche. Damit wird die Kirche von Rom „zum Inbegriff und zur Vollendung der katholischen Kirche und ihrer Teilkirchen, damit auch des katholischen und des mit ihm verbundenen teilkirchlichen Glaubens. Die ‚Römische Kirche‘ wird zur eigentlichen allgemeinen katholische[n] Kirche“78. Mit der Bulle „Unam sanctam“ Papst Bonifatius VIII. (1302) war zudem die Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom als heilsnotwendig bestimmt worden (vgl. DH 870–872). „Damit erfüllt nur die römische Kirche den gesamt-kirchlich-katholischen Heilsauftrag. ‚Katholisch‘ ist nur in ‚römischer‘ Gestalt heilbedeutsam. […] Weil es nur noch eine einzige universell-katholische Kirche, eben die universell-römische gibt, gibt es als den einen katholisch rechtgläubigen Glauben nur den ‚römischen‘“79. Diese Sichtweise der Römischen Kirche und die damit zusammenhängende Identifizierung von „katholisch“ und „römisch“ bestimmte die katholische Ekklesiologie bis zum Konzil von Trient und darüber hinaus.80