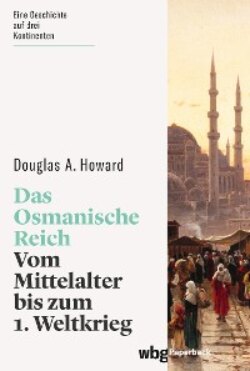Читать книгу Das Osmanische Reich - Douglas Dozier Howard - Страница 10
Elemente einer osmanischen Weltsicht
ОглавлениеDieses Buch erzählt die osmanische Geschichte als Geschichte dieser Weltsicht. Es sucht zu erklären, worin die osmanische Weltsicht bestand, wie sie zustande kam und wie sie sich auflöste. Sie blieb nicht unangefochten, und auch an Widerspruch fehlte es nicht. Doch die Grundbestandteile dieser Weltsicht wurden von allen Gemeinschaften der osmanischen Welt, gleich ob muslimischen, christlichen oder jüdischen, geteilt, auch wenn jede Gemeinschaft und die zu ihr gehörenden Gruppen ihre Elemente entsprechend den Traditonen der jeweiligen Gemeinschaft anders artikulierten. In diesem Buch beschreibe ich die osmanische Weltsicht als ein dreischichtiges Phänomen.
Die erste Schicht bildet die osmanische Dynastie, die Familie der Osmanensultane, ohne die es kein Osmanisches Reich gegeben hätte und keine osmanische Geschichte geben kann. Die Einwohner des Reiches teilten die Auffassung, dass an der osmanischen Dynastie etwas Besonderes war, und dies bestand nicht allein darin, dass die Familie der Osmanen die längste Zeitspanne ununterbrochener dynastischer Herrschaft in der Weltgeschichte für sich beanspruchen kann. Vielmehr besaßen die Sultane osmanischen Autoren zufolge Din ü Devlet. Din war spirituelle Energie, die Fähigkeit, die Bedingungen für die Begegnung zwischen der Menschenseele und dem Göttlichen zu regeln und festzulegen. Devlet bedeutete charismatische Herrschaft, die magische Gabe zu führen, Sieg und Wohlstand zu bringen. Verliehen wurden diese Gaben, um das materielle und geistige Wohlergehen der Völker unter der Obhut der Dynastie sicherzustellen. Osmanische ‚Politik‘ läuft größtenteils auf eine Beschreibung der Beziehungen der osmanischen Völker zu den Osmanensultanen und deren ausgedehntem Haushalt hinaus. Deren praktische Ausgestaltung variierte im Lauf der Zeit, je nachdem, wie sich das Bild der Osmanenfamilie nach außen hin wandelte, und damit veränderte sich auch die Definition von Identität, Loyalität und Zugehörigkeit.
Eine zweite Schicht der osmanischen Weltsicht ist ihr Verständnis von Wohlstand und Erfolg sowie der geeigneten Strategien, um beides zu erreichen. Das fiskalische Modell eines Imperiums ist wichtig, wie wir alle in den vergangenen zwei Jahrzehnten gelernt haben. Doch als die osmanische Dynastie ihr Reich errichtete, betrachtete sie die „Wirtschaft“ nicht als unpersönliche oder unabhängige Kategorie, sondern als Ausdruck materiellen Erfolgs, der sich aus dynastischer Macht und geistigen Bindungen gleichermaßen speiste. Instinktiv wollten die Osmanen die Leute in Ruhe ihre eigenen Entscheidungen in Wohlstandsfragen treffen lassen. Die Bedingungen des ausgehenden Agrarzeitalters, in das die Blütezeit des Osmanischen Reiches fällt, seine bestehenden Transportkapazitäten und seine Kommunikationstechnologie erzwangen eine solche „Laissez-faire“-Haltung, aber sie war auch vernünftig. Von der imperialen Rhetorik einmal abgesehen, war „Absolutismus“ nicht etwas, das die Imperien des Agrarzeitalters leicht praktizieren konnten. Die osmanische Regierung brachte durchaus hochfliegende Ideen hervor und stellte manchmal unter Strafandrohung weitreichende Forderungen. Für Sultane und Staatsmänner im Siegesrausch war es eine große Versuchung, sich zu übernehmen. Je entlegener die Provinz, desto wahrscheinlicher war es, dass Geduld und Verhandlungsbereitschaft sich auszahlten. Es waren alte Länder, wo die Menschen wussten, wie man Dinge regelte.
Die dritte Schicht der osmanischen Weltsicht ist das schon umrissene Geflecht aus spirituellen Überzeugungen. Die osmanische Literatur ist ein Mittel, um diese Überzeugungen zu verorten, und sie erhält in diesem Buch breiten Raum. Wie schon beim Betrachten der Fotografien Ara Gülers dauert es auch bei der Lektüre osmanischer Literatur nicht lange, bis man die alles durchdringende Melancholie spürt, die mit dem Verlust einhergeht, aber auch die verwunderte und heitere Hinnahme der Natürlichkeit dieses Verlusts. Hier auf diesem Erdenrund, unter den Himmelslichtern und Planeten, die über ihm im Gewölbe der sieben Himmel umliefen, bestand die Erfahrung des Menschseins in der Erfahrung von Wandel und des mit ihm einhergehenden Leids. Dieses Leid war teils das Ergebnis unerbittlicher Handlungen Gottes – Erdbeben, Seuchen, Dürre und Hungersnot, Stürme und Brandkatastrophen. Teils erwuchs es aus selbst zugefügten Wunden wie Krieg und Sklaverei, teils aus unergründlichen existenziellen Herausforderungen, unter denen die Erfahrung der Zeit zweifellos die rätselhafteste war. Und dennoch enthüllte die vergängliche Realität in all ihrer scheinbar willkürlichen Zufälligkeit für osmanische Autoren und ihre Leser letzten Endes eine vollständige Beschreibung des Göttlichen. Dinge, Erfahrungen und Ereignisse und vor allem jede Liebe und jeder Verlust – überwältigten in letzter Konsequenz die Sinne und trieben einen Menschen ins Dunkel, in die „Ruinenschänke“, wo er seine Lebensumstände bedenken und feststellen konnte, dass auch andere schon dort gelandet waren. Menschen fühlen sich in ihrem Schmerz oft getröstet, wenn ihr Leben dabei offensichtlich archetypischen Mustern folgt.