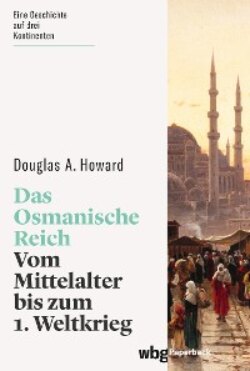Читать книгу Das Osmanische Reich - Douglas Dozier Howard - Страница 11
Zum Aufbau dieses Buches
ОглавлениеDas Zeitempfinden einer Gesellschaft ist ein geeigneter Ausgangspunkt für den Einstieg in ihre Weltsicht. Daher erzählt dieses Buch die Geschichte der Osmanen in sieben chronologischen Kapiteln, entsprechend den Jahrhunderten des islamischen Kalenders, jener Zeitrechnung, die mit der Hidschra des Propheten Mohammed begann (622 n. Chr.). Zwar waren in den Ländern der osmanischen Dynastie und den von ihr beherrschten Gemeinschaften auch andere Kalender gebräuchlich, aber die Osmanen hielten sich an diesen islamischen Kalender und verwendeten ihn im gesamten Reich als Standard. Kapitel 1 beginnt mit dem Auftreten Osmans zu Beginn des achten islamischen Jahrhunderts, und Kapitel 7 endet mit dem Abgang der osmanischen Dynastie in der Mitte des vierzehnten. Somit vertritt das Buch zwei Thesen. Die eine lautet, dass das Dramatische an der Geschichte gerade in ihrer Chronologie besteht. Die Menschen wissen nie, was als Nächstes geschehen wird, sie wissen bloß, was gerade passiert ist, und auch das nur verschwommen. Da es der Historiker ist, der am Ende die Geschichte erzählt, ist die geschehende Geschichte von Natur aus anachronistisch. Dieses Paradox ist Teil des Vergnügens. Die andere These, die in der chronologischen Anordnung des Buches steckt, besagt, dass das Erleben von Zeit selbst eine Dimension der erzählten Geschichte ist. Keine Epoche ist wichtiger oder unwichtiger als eine andere. Ein kulturelles Konstrukt des Menschen, das ihm kosmologische Orientierung bietet und eine Struktur an die Hand gibt, innerhalb derer er den Sinn des Lebens begreifen kann, ist der Kalender.
Der Aufbau des Buches ist der osmanischen Weltsicht noch auf zwei weitere Arten verpflichtet, nämlich durch den Gebrauch einheimischer Ortsnamen und den Gebrauch von Eigennamen. Ortsnamen benennen das Terrain, das die osmanischen Völker ständig durchquerten, geben den Schauplatz der Handlung vor und liefern zum Teil den Kontext der Ereignisse. Mehr noch, sie lassen die Gestalt der osmanischen Gedankenwelt erkennen; es kann gar nicht genug betont werden, dass die Osmanen die regionale Vielfalt als gegeben annahmen. Sie hatten ihre Freude daran. Sie hüteten sich davor, Pauschalurteile auf der Grundlage von Verallgemeinerungen zu fällen, wie etwa „der osmanische Balkan“ – so etwas gab es nicht – oder „Anatolien“, dessen heutige Definition ebenfalls ziemlich jungen Datums ist und nach dem Ende des Imperiums entstand. Osmanische Autoren sprachen von „diesen wohlbeschützten Herrschaftsbereichen“, über die sie mit eigentümlicher Betonung des Lokalen berichteten.
Was die Eigennamen angeht, so sind viele von ihnen vielleicht nicht vertraut, doch sie sind trotzdem unverzichtbar. Dieses Buch handelt von Menschen und von den Entscheidungen, die sie trafen, von dem, was sie schrieben und sagten, wie sie mit Leid fertig wurden, welche Überraschungen sie erlebten und was sie glücklich machte. Die Osmanen liebten es, alles zu dokumentieren, weshalb die Quellen, auf denen das Buch beruht, tatsächlich Namen nennen. Natürlich kannten viele Angehörige der vergleichsweise kleinen osmanischen Herrschaftsschicht einander, besonders jene, die gemeinsam im Palast aufgewachsen waren, aber das reicht als Erklärung nicht aus, da es nicht nur die Herrschaftsschicht ist, deren Namen in den Dokumenten auftauchen. Auch einfache Leute erscheinen namentlich, Männer wie Frauen, Christen, Juden, Muslime und Fremde, in Beschwerden und Gesuchen, Gerichtsfällen, Verträgen, Tagebüchern, Geschichtswerken und ähnlichem. Vielleicht stellen diese Namen die Geduld des Uneingeweihten auf die Probe, aber wer gut vorbereitet ist, dem offenbaren osmanische Namen häufig wichtige Informationen – Geschlecht, soziale Identität, Herkunftsort –, ganz abgesehen davon, dass sie manchmal schillernd und kurzweilig sind. Wenn in diesem Buch viele dieser Namen enthalten sind, so ist das der Versuch zu wiederholen, was die historischen Aufzeichnungen der Osmanen überdeutlich machen: dass die osmanische Weltsicht am klarsten in der Achtung vor dem Einzelnen und vor den bedeutsamen wie den banalen Details seines Lebens zum Ausdruck kam.