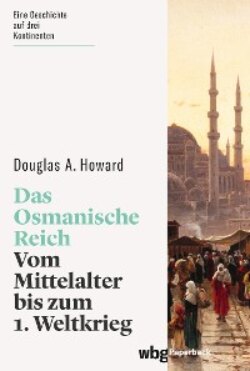Читать книгу Das Osmanische Reich - Douglas Dozier Howard - Страница 20
Eine neue Gesellschaft
ОглавлениеAus den Kriegen, Katastrophen, Seuchen und Wanderungen dieses bemerkenswerten Jahrhunderts entstand in den Grenzregionen allmählich eine neue Gesellschaft. Ihre verschiedenen Gemeinschaften, die Seite an Seite lebten – Griechen und Türken, Slawen und Lateiner –, verstanden oder mochten einander nicht immer. Doch wie im Fall der Legenden um das Kosovo konnten ihre wechselweise Unwissenheit und ihre manchmal bestürzende gegenseitige Bosheit nicht verhindern, dass es unweigerlich zu einer Gemeinsamkeit der Mittel und Wege kam, einer Überlappung der Identitäten, die – wenn auch uneingestanden, ja unbewusst – binnen einer Generation aus dem Unheil erwuchs.
Es ist zwar nicht falsch, solche Gemeinschaften als „christlich“ und „muslimisch“ zu bezeichnen, aber an den verschwommenen Grenzen zwischen den beiden öffnete sich eine Zwischenregion, in der christliche wie muslimische Ritter zu den plündernden Armeen zählten, Christen wie Muslimen die Gefahr der Versklavung drohte, Christen wie Muslime Krankheiten und Seuchen zum Opfer fielen und Christen wie Muslime sich ineinander verliebten, intime Beziehungen eingingen und Mischehen schlossen. Kantakuzenos rügte seine griechischen Rivalen in Konstantinopel, denn ihre Heere seien voller „Halbbarbaren“, mixobarbaroi, und am Ende des Jahrhunderts sagte Timur dasselbe über die Osmanen.35 Die beiden berühmtesten Zeitzeugen für diese verknüpften Gesellschaften, Ibn Battuta und Palamas, der eine Muslim, der andere Christ, fühlten sich jeder in der Küstenregion Kleinasiens als Außenseiter. Ibn Battuta verbrachte den Großteil seines Lebens mit Reisen von einem Ende der islamischen Welt zum anderen, und in Gesellschaft gleichgesinnter muslimischer Gelehrter fühlte er sich wohl, aber an der kleinasiatischen Küste stieß er auf überraschende Barrieren, denn er konnte kein Türkisch. Und als Erzbischof Palamas unter die griechischen Christen in Kleinasien kam, die er als sein eigenes Volk betrachten durfte, bemerkte er mit einem gewissen Kummer, aber auch mit einiger Bewunderung, dass „die Christen und die Türken sich miteinander vermischen, ihren Geschäften nachgehen, einander führen und voneinander geführt werden …“36
Es ist nicht leicht, ein vollständiges demographisches Bild dieser entstehenden Gesellschaft zu zeichnen. Beispielsweise ist es unmöglich, die Zahl der Gesamtbevölkerung in der Region zur Zeit der türkischen Eroberung oder die Größe der verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen zu ermitteln, aus denen sich die Gesamtheit zusammensetzte. Unbekannt bleiben die Zahlen der Invasoren und Einwanderer, die der Menschen, die vor den Katastrophen vorübergehend oder dauerhaft auf die Inseln der Ägäis, nach Konstantinopel oder in die slawischen Länder flüchteten, wie viele von ihnen starben, wie viele in die Sklaverei verkauft wurden, zuhause blieben oder heimkehrten, als die Gewalt abebbte.
Anfangs war der Großteil der Bevölkerung in den Ländern, über welche die osmanischen Emire herrschten, orthodoxe Christen. Es ist nicht leicht, die Lebensumstände dieser „großen Zahl von Christen unter muslimischer Herrschaft“, wie Ibn Battuta schrieb, einzuschätzen. Die orthodoxe Kirche, deren Struktur erst durch die Slaweneinfälle und dann durch die türkischen Einfälle dezimiert worden war, stand vor gewaltigen Schwierigkeiten.37 Der Klerus erlitt beträchtliche materielle Verluste und verarmte durch die Angriffe der Türken, die Flucht von Ordensgemeinschaften und deren Anführern, die Gefangennahme und Versklavung zumindest eines Teils der Bevölkerung, die Aufgabe und Beschlagnahmung von Liegenschaften und den Aderlass durch ansteckende Krankheiten. Disziplin, Moral und Reinheit der Lehre litten gleichermaßen.38 Dennoch zeigen Ausgrabungen in Sardes, einer Stadt an der viel befahrenen Flussroute über den Hermos (Gediz) von der Küste Kleinasiens ins Landesinnere, wenig Brüche in den Siedlungsspuren, vielmehr deuten sie auf eine Kontinuität zwischen der byzantinischen und der frühtürkischen Zeit, etwa in Produktion und Gebrauch glasierter Keramik.39 Zwar fand Erzbischof Palamas Nikaia während seines dortigen Zwangsaufenthaltes zum Großteil verlassen vor und stellte fest, dass der Handel nach Bursa ausgewichen war, aber trotz aller Not ging das geistliche Leben weiter. Auch in Biga „brachten sie uns zur Kirche Christi, die selbst jetzt dank seiner Macht noch besteht und ihn freimütig preist“. Außerdem traf Palamas Christen in wichtigen Positionen an, darunter Orhans Leibarzt, ein griechischer Mediziner namens Taronites.40
Ein weiteres Problem für die Kirche war der Übertritt zum Islam. Zwei Patriarchenbriefe an die Christen in Nikaia, geschrieben in den Jahren 1338–40, luden Konvertiten zur Rückkehr ein und versprachen Vergebung. Die Briefe setzten voraus, dass einige unter Zwang Muslime geworden seien, und stellten in Aussicht, sobald der Druck wegfalle, würden jene, die sich wieder der Kirche anschließen wollten, Aufnahme finden. Doch wiederholt verurteilten die Schreiben Konvertiten, weil sie ihrem christlichen Glauben nicht treu blieben. Sie behandelten die Konversion als Sünde, die Reue und Vergebung erfordere – womit sie indirekt einräumten, dass es sich in Wirklichkeit nicht um Zwangsbekehrungen gehandelt hatte.41
Es überrascht nicht, dass zu den Faktoren, die einen Glaubenswechsel begünstigten, Mischehen zählten. Herrscherliche Vorbilder für Eheschließungen zwischen Christen und Muslimen, die aus Gründen der dynastischen Politik erfolgten, waren zur Hand, wenn man wollte, doch handelte es sich nicht allein um eine Praxis im Adel. Die Kinder dieser wahrscheinlich in die Hunderte gehenden Verbindungen waren es, von denen Kantakuzenos als von mixobarbaroi sprach.42 Alle Ehefrauen Sultan Orhans waren Griechinnen – außer Theodora (der Tochter von Kantakuzenos) hatte Orhan zuvor bereits Nilüfer geheiratet, die Tochter des byzantinischen Statthalters von Yarhisar.43 Theodora blieb Christin, Nil üfer wurde Muslima.44 Aber das war nichts Neues. Seit 200 Jahren hatten die byzantinischen Kaiser Eheverbindungen mit den seldschukischen Türken geschlossen.45 Dutzendweise hatten Prinzessinnen aus den Königsfamilien des christlichen Konstantinopel, Trapezunt und Serbien mongolische und türkische Herrscher geheiratet.46 Orhans Nachfolger Murad und Bayezid heirateten muslimische wie christliche Frauen. Murad war mit Töchtern des christlichen Fürsten von Tarnovo und der muslimischen Fürsten von Kastamonu und Sinop vermählt. Murads Sohn Bayezid heiratete die römisch-katholische Tochter der Herzogin von Salona, die orthodoxe Schwester des serbischen Fürsten Stefan Lazarević und die muslimische Tochter des Fürsten von Germiyan.