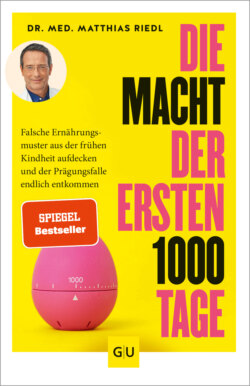Читать книгу Die Macht der ersten 1000 Tage - Dr. med. Matthias Riedl - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE FÄHIGKEIT ZU FASTEN – EVOLUTIONÄRES ERBE 6
ОглавлениеDürren, ausbleibender Jagderfolg, Missernten, Kriege: Seit es den Homo sapiens gibt, ist Nahrungsmangel einer der Faktoren, die sein Leben am stärksten bedrohen – für viele Menschen bis heute. Deshalb hat die Evolution uns ein Programm eingeprägt, mit dessen Hilfe wir – zumindest für eine gewisse Zeit – auch ohne etwas Nahrhaftes in der Hand weiterleben können: die Fähigkeit zu fasten. Sie bildet quasi das Gegenstück zum Heißhunger. Bekommt der Körper über längere Zeit nichts zu essen, aktiviert er aufgrund dieser Stresssituation ein Programm, das in der Folge viele Stoffwechselprozesse herunterfährt – und anstelle von schlechter Stimmung wie beim Heißhunger Botenstoffe bereitstellt, die für gute Laune sorgen.
Dank dieses Programms kommt kaum eine andere Spezies besser mit Nahrungsausfall zurecht als wir Menschen – abgesehen vom Pinguin, der bis zu sechs Monate ohne Futter übersteht. Ist sein Fettvorrat erschöpft, drängt es den Vogel Richtung Meer – und sein Körper nutzt nun Eiweiße aus den Muskeln für einen letzten Energieschub. So schafft es der Pinguin mit letzter Kraft zu den Fischgründen – und nach ein paar Tagen sind seine Speicher wieder voll. Wir Menschen schaffen es, je nach Ausgangsgewicht und der individuellen Fähigkeit des Stoffwechsels, uns auf den Mangel einzustellen und im Extremfall bis zu drei Monate ohne Nahrung zu überleben. Das zeigen Fälle von Hungerstreikenden, wie etwa der des Terence MacSwiney: Der Bürgermeister von Cork gehörte zur Unabhängigkeitsbewegung der »Irish Volunteers«, wurde 1920 von einem Militärgericht wegen Volksverhetzung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt und ging sofort in den Hungerstreik – zusammen mit knapp einem Dutzend seiner Gefolgsleute. Nach 74 Tagen starb MacSwiney. Einige der Mitstreikenden jedoch überstanden 94 Tage: Dann kamen sie der Bitte eines anderen Freiheitskämpfers nach – und gaben auf.
Längere Hungerperioden waren für unsere Ahnen jedoch kein Mittel, um politischen Druck zu erzeugen – sondern schlicht Normalität. Nicht immer gab es genug Früchte und Körner, nicht immer waren Wurzeln groß genug, um satt zu machen. Und nicht immer lag in Dürrezeiten eine tote Antilope bereit, um die Einbußen bei der pflanzlichen Kost auszugleichen. Die Fähigkeit zu fasten war also die einzige Möglichkeit, die regelmäßigen Hungerphasen zu überstehen.
Dieses System, das uns die Evolution eingeprägt hat, ist einigermaßen beeindruckend. Wenn wir eine Zeit lang nichts zu uns nehmen, greift der Körper zunächst auf seine Zuckerreserven zurück. Sind diese nach etwa 48 Stunden erschöpft, schaltet der Körper um – und verstoffwechselt nun Fett. Dabei produziert er aus Fettzellen in der Leber sogenannte Ketone, spezielle Fettsäure-Moleküle, die sich besonders leicht in Energie umwandeln lassen. Nach einigen Tagen ohne Nahrung hat sich der Stoffwechsel derart umgestellt, dass unser System ganze neun Zehntel seiner Energie aus Fettreserven zieht.
Zusätzlich aktiviert er eine Art körpereigene Müllabfuhr, um aus Zellabfall weitere Energie zu gewinnen. Bei dieser sogenannten Autophagie – was sich grob übersetzen lässt mit »Selbstverspeisung« – verstoffwechselt der Körper beschädigte Eiweiße oder Zellbestandteile, die sich mit der Zeit in der Zelle ansammeln und diese langfristig schädigen können. In den Lysosomen zerteilen dann Verdauungsenzyme den Müll – und verwandeln ihn auf diese Weise in Bauteile für neue Zellen oder aber direkt in Energie. Als Beleg, wie bedeutsam der Prozess der Autophagie für uns Menschen ist, kann die Tatsache gelten, dass ihr Entdecker, der Japaner Yoshinori Ohsumi, dafür 2016 den Medizin-Nobelpreis erhielt. Und sich diesen – anders als die Preisträger in den Jahren zuvor – mit keinem zweiten oder sogar dritten Forscher teilen musste.
Was Wissenschaftler außerdem verblüfft, ist die Euphorie, von der Fastende immer wieder berichten. Studien legen nahe, dass der Körper nach einigen Tagen Nahrungsentzug vermehrt Glückshormone produziert – obwohl er permanent unterzuckert ist.8 Evolutionär gesehen macht dieser Mechanismus Sinn: Schließlich ermöglichte diese Stimmungsaufhellung unseren Vorfahren überhaupt erst, mit der Nahrungssuche weiterzumachen, anstatt sich hungrig und maulend in ihre Höhle zurückzuziehen und auf diese Weise sehr wahrscheinlich elendig zu verhungern. Indem er Glückshormone ausschüttet, steigert der Körper also die Wahrscheinlichkeit, irgendwann wieder von außen Energie zugeführt zu bekommen – und weiterleben zu können.