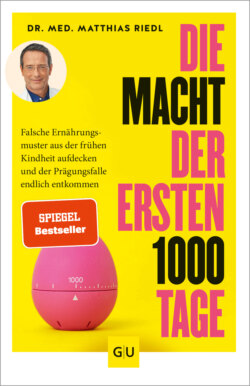Читать книгу Die Macht der ersten 1000 Tage - Dr. med. Matthias Riedl - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE EPIGENETIK – PRÄGUNG IM ZEITRAFFER
ОглавлениеWir Menschen kommen mit einem Erbgut zur Welt, das sich, wie gesehen, zum allergrößten Teil gleicht. Die Bedingungen aber, unter denen wir heranwachsen, sind extrem unterschiedlich. Das beginnt schon mit dem Moment der Zeugung: Beim einen findet die Empfängnis im Winter statt, die ersten Monate der Entwicklung geschehen in einer kalten Umgebung – wohingegen der andere heiße Temperaturen zum Start ins Leben hat. Beim einen muss die Mutter während der Schwangerschaft mit wenig Verpflegung auskommen, der andere entwickelt sich in Zeiten eines reichen Nahrungsangebotes. Der eine Säugling hat Eltern, die bereits Kinder aufgezogen haben, diese Aufgabe entsprechend erfahren und entspannt angehen können, der andere trifft als Erstgeborener auf womöglich ängstliche oder überforderte Eltern. Das eine Kleinkind hat Vater und Mutter, die jeden Tag selbst kochen – das andere solche, die die Bequemlichkeit von Fast Food schätzen. Kurz: Jedes Kind erlebt seine ersten 1000 Tage in teilweise gegenteiligen Umfeldern. Wie aber ist es möglich, dass sich jeder Einzelne von uns unter komplett verschiedenen Bedingungen gut entwickeln kann – obwohl die genetischen Voraussetzungen doch beinahe identisch scheinen?
Die Antwort: Weil unsere genetische Basis nicht nur über einen sehr langen Zeitraum hinweg veränderbar ist. Wäre es so – unser Körper hätte kaum eine Chance, sich an die spezifische Umwelt anzupassen, die jedes Individuum umgibt. Und damit keine Chance auf ein im Idealfall langes und gesundes Leben.
Um eine individuelle Anpassung an die Umgebung möglich zu machen, hat sich die Natur eine Art Zeitraffer-Evolution ausgedacht. Ein Prinzip, dem der Zeitraum einer Generation genügt, um uns als Individuen fit zu machen für die spezielle Umgebung, die uns sehr wahrscheinlich erwartet. Uns ideal zu prägen auf genau jene Lebensumstände, in die wir hineingeboren werden. Wie das geschieht, damit befassen sich Wissenschaftler, die im Fachgebiet der sogenannten Epigenetik forschen – einem jungen und extrem spannenden Feld, in dem sich Biologie und Medizin überlappen und deren Ergebnisse mich jedes Mal aufs Neue verblüffen.
Was wir alle uns unbedingt merken sollten: Die epigenetische Prägung, also jener Teilbereich der Genetik, den unsere Eltern und später wir selbst beeinflussen können, ist deutlich wirkmächtiger als die unveränderliche genetische Hardware. Ein Beispiel, an dem sich das gut illustrieren lässt, ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Wissenschaftler sind inzwischen überzeugt davon, dass dieses – auch – genetisch bestimmt wird. Beispielsweise haben sich Forscher um Heribert Schunkert, Professor am Deutschen Herzzentrum München, jene 74 Genvarianten angeschaut, die mit darüber entscheiden, ob jemand in der Schule großen Erfolg haben kann. Für ihre Studie analysierten sie Daten von 146 000 Personen und fanden heraus: Jenes Fünftel, dessen Genset den geringsten Schulerfolg versprach, wies ein um 30 Prozent höheres Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten auf. Umgekehrt: Verhieß das Genset eine positive Schullaufbahn, war das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten verringert – und zwar unabhängig davon, ob die Menschen am Ende wirklich eine ausgezeichnete Schulbildung hatten, ihre genetisch angelegten Fähigkeiten also auch tatsächlich ausbildeten.
Fatalisten werden nun denken: »Wenn eh die ererbten Gene regieren, dann brauche ich mich um meinen Lebensstil ja nicht aktiv zu kümmern!« Das wäre ein enormer Trugschluss. Denn gerade am Beispiel von Herzkrankheiten zeigt sich deutlich, dass einige von uns in der Genlotterie zwar mehr Glück haben als andere – dass unser persönlicher Lebensstil mögliche Nachteile aber positiv beeinflussen kann. Genau das konnten etwa Wissenschaftler des Massachusetts General Hospital in Boston zeigen. Sie analysierten die Daten von mehr als 50 000 Menschen zunächst im Hinblick auf 50 sogenannte Einzelnukleotid-Polymorphismen – Genvarianten, die unter anderem mitbestimmen, wie wahrscheinlich Menschen einen Herzinfarkt erleiden.12 Anschließend untersuchten sie, inwieweit die Lebensweise beeinflusste, ob sie tatsächlich kardiovaskuläre Probleme bekamen. Als herzgesund definierten die Forscher dabei folgenden Lebensstil: nicht rauchen, einen Body-Mass-Index von unter 30 halten, sich mindestens einmal pro Woche körperlich auspowern – und sich gesund ernähren. Ein Ergebnis der Studie: Menschen, die ein genetisches Risiko für einen Herzinfarkt aufwiesen, konnten dieses nahezu halbieren – wenn sie mindestens drei der vier herzschonenden Faktoren erfüllten. Umgekehrt macht ein ungesunder Lebensstil genetische Vorteile zunichte: Menschen, die mit ihrer Lebensweise ihr Herz belasteten, erhöhten ihr Risiko, innerhalb von zehn Jahren einen Herzinfarkt zu erleiden, um zwei Drittel, allen guten Genen zum Trotz.
Allein dieses Beispiel zeigt also, wie stark die Art, wie wir leben und was wir essen, unsere Gesundheit über die Epigenetik beeinflusst. Forscher gehen heute davon aus, dass die unveränderliche Genstruktur nur etwa zu etwa 20 bis 30 Prozent über Krankheiten entscheidet – wir dagegen zu 70 bis 80 Prozent beeinflussen können, ob ein Gen angeschaltet wird oder nicht.
Grund genug also, einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie epigenetische Prägung funktioniert. Wie also Eltern die Genaktivität ihrer Kinder bestimmen – und inwieweit wir dies noch als Erwachsene tun können. Um schließlich zu verstehen, wie diese Evolution im Zeitraffer funktioniert und warum sie noch bedeutsamer ist als die Evolution in Zeitlupe …