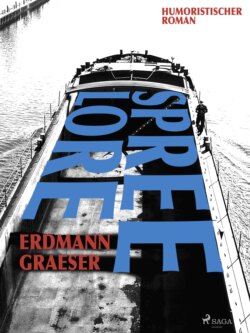Читать книгу Spreelore - Erdmann Graeser - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеDie große Stadt singt ihr lautes Lied vom Morgen bis tief in die Nacht hinein. Über viele Brücken tost das Leben Berlins. Unten aber, auf der Spree und auf den Kanälen, gleiten lautlos große Frachtkähne dahin, bringen Holz und Ziegelsteine, Sand und Mörtel, Kohlen und Torf. Etlichen dient ein kleiner Dampfer als Vorspann, aber die meisten werden mühselig vorwärtsgestakt. Die Frau des Schiffers, den Strickstrumpf in der Hand, steht am Steuer, einige Kinder spielen bei der Kombüse; aus dem Schornstein steigt dünner Rauch, ein kläffender Spitz jagt ruhelos auf den Planken hin und her.
Die Menschen oben auf der Brücke, die eben hinuntergeblickt hatten, als der große Kahn mit dem grünen Vordersteven unter der dunklen Wölbung verschwand, diese Menschen, deren Stadt, „ihr“ Berlin, sich von Jahr zu Jahr wandelt, haben vor sich ein Bild, das seit alten Zeiten unverändert ist. Was Berlin auch durchzumachen hatte und was es noch erleben wird, die Schiffer mit ihren Kähnen kamen und werden nach wie vor kommen. Immer werden sie zu dem steinernen Ungeheuer hinüber starren. Sie bringen ihm das, was es braucht, und dann ziehen sie wieder davon, langsam, gemächlich, bis sie draußen, auf den großen Seeflächen oder der Elbe, den Mast wieder aufrichten und die Segel setzen können.
Aber zuweilen geschieht es, daß jemand von solch einem Frachtkahn in der Stadt zurückbleibt und vielleicht sogar auch seßhaft wird. Dann sucht er sicherlich die auf, die schon vor ihm heimisch wurden, und nicht zuletzt in den Gäßchen nahe dem Spreeufer, und dort findet er wohl meistens ebenfalls Unterschlupf.
So kommt es, daß hier am Wasser Menschen zusammenwohnen, die sich mitunter schon von ihrer Jugendzeit her kennen und nun ebenso zu der großen Stadt gehören, wie alles andere, was in ihr lebt.
In solch einer Straße nahe am Wasser – der Friedrichsgracht – die mit ihren kleinen, schmalen Häusern in den siebziger Jahren noch ganz unberührt von baulichen Veränderungen war, hatte auch die Witwe Anna Lorenzen mit ihrem Töchterchen Zuflucht gefunden. Nach dem spurlosen Verschwinden ihres Mannes, der vom Kahn unbemerkt ins Wasser gestürzt und wohl ertrunken war, hatte sie damals den „Spreewinkel“ aufgesucht. Zumal nicht weit davon – in der Breiten Straße – der steinreiche Ziegeleibesitzer Semper wohnte, in dessen Haus sie früher in Stellung gewesen war. Für Herrn Semper hatte ihr Mann in den letzten Jahren Steine nach Berlin gebracht, und zwar auf seinem eigenen Kahn, den er schon vom Vater her besaß.
Nun wusch und plättete Frau Lorenzen für Sempers und andere wohlhabende Leute. Auch heute, an diesem schönen Frühlingstag, war sie damit beschäftigt. Die kleine Küche, die beinahe der auf einem Frachtkahn glich, war von feuchtem, warmem Dunst erfüllt. Ihr Mädelchen, Lore, ein blondes Ding mit schmalem, feinem Gesichtchen, saß in der Nebenstube, in der das Bemerkenswerteste das Bild des Vaters war, das über dem Bett hing. Freilich nur eine allmählich verblaßte Photographie, die noch aus der Bräutigamszeit stammte. Lorenzen, der ebenso blondes, aber krauses Haar gehabt hatte wie seine Lore jetzt, stand breitbeinig vor dem Beschauer, eine Ziehharmonika in der Hand und lachte über das ganze Gesicht, er schien zu singen ... „Juvivallera!“ hatte er unter das Bild geschrieben und es seiner Braut geschenkt – damals, als er noch Matrose gewesen war auf Käpten Gundermanns Vollripper. „Juvivallera!“ war sein Leitspruch gewesen, bis sich – ja, bis sich das Kind gemeldet hatte ... Damals, da mußte er schleunigst das hübsche Dienstmädchen von Sempers heiraten, und mit dem lustigen Matrosenleben in Hamburg war es ziemlich plötzlich zu Ende; er wurde Spree- und Elbschiffer. Doch sein ungestümes Blut war damit nicht zur Ruhe gekommen, und wenn er zur Feierabendzeit auf Deck saß und seine Harmonika spielte, ging ihm so manche prickelnde Erinnerung durch den Kopf: Wie ihn der Vater damals aus Schönfließ zur Tante nach Berlin in Pflege gegeben hatte, damit er endlich eine ordentliche Schule besuchte, und wie er dann eines schönen Abends auf einem Frachtkahn nach Hamburg durchgebrannt und Schiffsjunge geworden war ... Wie ihn später Käpten Gundermann geheuert, der Schwiegervater des reichen Semper, der ihn schließlich auch zur Heirat zwang, als sich die Geschichte mit der Anna nicht länger verheimlichen ließ. Ja – natürlich – der Abend in Stralau war schuld gewesen, sonst wäre er – Lorenz Lorenzen – doch noch, wie er so gern gewollt, nach Südamerika, nach dem Äquator, gekommen. Aber solch ein Tanzvergnügen am Tage des „Fischzuges“ hatte schon so manchem lustigen Burschen Fesseln fürs ganze Leben angelegt, doch daß es nun gerade auch ihm so gehen mußte, ihm – dem „Juvivallera-Lorenz“, wie man ihn nannte, das war ihm eigentlich immer noch unfaßbar. Dem alten Vater Lorenzen war es wie ein großes Glück erschienen, daß der wilde Junge nun doch gebändigt war – eine ebenso tüchtige wie hübsche Frau bekam und – das war ihm die Hauptsache gewesen – Schiffer wurde, wie es alle Lorenzen gewesen waren, so weit man zurückdenken konnte. –
Von der Küche her kam der Geruch der feuchten Wäsche, durch das Schlafstubenfenster aber wehte von draußen herein der Dunst, der dem Spreewinkel so eigentümlich ist: ein Gemisch von Holz- und Torffeuerrauch. Und wer eine so empfindliche Nase wie die kleine Lore Lorenzen hatte, der spürte auch noch, daß es nach Teer, nach Fischbottichen und nach den vielen Katzen roch, die überall vor den dunklen Kellerluken hockten.
Auf der Straße spielten die Kinder die uralten Frühlingsspiele, mit Murmeln und Trieseln oder das geliebte „Himmel und Hölle“. Unter den Spreewinkelkindern hier waren auch ein paar fremde von den Zillen, die an der Fischerbrücke jetzt vor Anker lagen. Auch der große Junge mit den roten gestopften Wollstrümpfen war wieder da, Gustav Holzer hieß er, der Kahn seines Vaters war aus dem Schifferdorf Marienwerder.
Lore mochte den Gustav nicht, er starrte sie immer so an; und dann diese häßlichen, roten, dicken Strümpfe, die ihm so locker um die Beine saßen, so „Wasser zogen“. Als er heute auf die Gasse kam, war sie sofort ins Haus gegangen, mit ihm wollte sie nicht weiterspielen ... Nun saß sie mit einer dicken Schmalzstulle in der Hand an ihrem Bett, starrte die verblaßte Photographie ihres verschwundenen Vaters an und dachte angestrengt nach. Kaum, daß sie den Sonnenstrahl bemerkte, der in der Glasscheibe aufblitzte.
Ja – wenn sie fünf Groschen hätte ... Da könnte man zu Lili Sempers Geburtstagsfeier gehen ... Die fünf Groschen brauchte man dazu, denn man mußte doch ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Der gleichen Meinung war auch Mutter Lorenzen. Sie hatte, als sie vor acht Tagen die frischgewaschene und glänzendgebügelte Wäsche ablieferte und Frau Semper dabei die Lore eingeladen hatte, sofort an das Geburtstagsgeschenk gedacht. Freilich hatte sie zu Lore gesagt, eine kleine Stickerei oder Näherei werde es auch tun – das Mädel hatte ja so geschickte Finger – aber sie war sehr nachdrücklich belehrt worden, daß es eine Blume sein müsse.
Ja freilich – eine Blume! Vielleicht so eine schöne rote Tulpe, wie sie der Gärtner im Schaufenster hatte. Aber solch ein Tulpentopf kostete fünf Groschen – hatte der Gärtner gesagt – und das sei noch billig; denn in der vorigen Woche hätte er zehn Silbergroschen dafür bekommen. Aber weil es Frau Lorenzen sei und die Tulpenzeit beinahe vorüber, so wollte er nur fünf Groschen haben.
„Selbstkostenpreis, für den Topf allein und die schöne bunte Seidenpapiermanschette – die Tulpenzwiebel gar nicht gerechnet!“ Seitdem spielte die Möglichkeit des Tulpenankaufs eine große Rolle bei den beiden. Bei Lore bestand die Überlegung darin, daß sie sich „bestimmt“ vornahm, ihre Pfennigausgaben einzuschränken. Wenn sie die Wäsche fortschaffte, dann bekam sie von Frau Drogist Bertram jedesmal einen Sechser und von Fräulein Lohr, der Modistin, einen Groschen. Die Groschen waren bisher regelmäßig in die Sparbüchse gewandert, die Sechser oder Pfennige aber hatte Lore ebenso regelmäßig in Johannisbrot, Süßholz oder Naute angelegt. Nun war der Geburtstag aber nahe herangekommen. Beim Konditor sprach man schon davon, daß er von Frau Semper Auftrag erhalten habe, eine Schokoladentorte – man bedenke: eine „Schokoladentorte!“ zu liefern. Lore erfuhr es, als sie gestern die von Fräulein Lohr geschenkten Pfennige in Zuckererbsen verwandelte. Sie hatte zwar etwas gezögert, aber na – nun war es mit dem Sparen ja doch einmal zu spät!
In den letzten Tagen war sie mit einer wahren Gier in den Straßen umhergelaufen. Konnte es denn nicht leicht sein, daß sie etwas fand ...? So viele Leute verloren täglich Geld, nicht nur Pfennige und Groschen, sondern sogar Goldstücke, ganze Geldtaschen – konnte sie also nicht noch im letzten Augenblick zu Reichtum kommen? – Aber Lore fand nichts. Nun saß sie also wieder hier und überlegte und überlegte. Plötzlich stand sie auf, schlich in einen Winkel und begann laut zu heulen.
„Ja – heul man zu!“ rief die Mutter aus der Küche herüber und rieb die Wäsche, daß ihr der weiße Seifenschaum nur so um den Kopf flog. Als das Mädel gar nicht wieder aufhörte, ja offenbar absichtlich mehrmals mit der Stirn gegen die Bettkante stieß und sogar mit den Nägeln auf der Diele kratzte, da wischte Frau Lorenzen den Seifenschaum an der blauen Schürze ab und ging hinüber. Gleich darauf hörte man es klatschen ...
„Nu biste aber stille, verstehste!“ sagte die Mutter. Es hatte geholfen; das Heulen verstummte, nur ab und zu gab Lore noch einen hohen, langgezogenen Ton von sich, dem Jaulen eines Hundes nicht unähnlich. Frau Lorenzens Nerven waren ziemlich robust – man konnte sogar mit einem harten Griffel auf einer Schiefertafel quietschen, sie vertrug alles, aber dieser Ton da aus der Stube war ihr doch zuviel. Sie wischte sich deshalb nochmals die Hände an der blauen Schürze ab, ging wieder hinüber, nahm kurzerhand den großen Kamm, der seinen Platz unter der Kommodendecke hatte, zog die entsetzte Lore mit einem Ruck aus ihrem Winkel und begann, ihr das blonde Haar zu strählen. Dann wurde ebenso energisch der braune alte Kattunfetzen heruntergezogen und das weiße Sonntagskleidchen übergeworfen. Mit einem feuchten Lappen fuhr die Mutter dem Kinde über das verheulte Gesicht, schließlich ging sie zum Schrank, schloß die Sparbüchse auf, nahm fünf Groschen heraus und sagte: „Nu lauf man zu – aber wehe dir, wenn du mir Schande machst!“
Lore wußte eigentlich nicht, wie ihr geschah. Wie verstört ging sie in den Laden des Gärtners, zeigte wortlos auf die Tulpe und legte das Geld hin.
Der Mann strich erst mal die Groschen ein, dann holte er die Tulpe her, befestigte eine feine Manschette aus rosa Kreppapier an dem Topf und schlug zum Schluß noch einen Bogen Seidenpapier darum, den er oben mit einer Stecknadel verschloß.
Aber trotz all dieser Herrlichkeit war es der Lore, als sie nun das Geschenk wie eine zarte Seifenblase vor sich hertrug, doch nicht so ganz wohl, und als sie dann in Sempers feinem Haus auf der Treppe war, konnte sie es vor innerer Unruhe nicht mehr aushalten und mußte doch erst einmal die Tulpe ansehen, denn es war ihr vorgekommen, als ob sie nicht mehr so ganz frisch wäre ... Sie öffnete behutsam das Seidenpapier und sah etwas Entsetzliches: Eins der sechs roten Blütenblätter war abgefallen und hing an der rosa Papiermanschette ... Und die Tulpe zeigte an jener Stelle eine Lücke, so – als wenn jemand einen Zahn verloren hatte ... Was machen ... Vielleicht, wenn man das Blatt vorsichtig wieder dazwischen schiebt? Aber mit den zitternden Fingern konnte das nichts Richtiges werden. Man versuchte es zwar trotzdem, aber – es wurde nur noch schlimmer. Denn nun lösten sich rechts und links die nächsten beiden Blätter auch ab, und Lore hatte plötzlich nur noch eine halbe Tulpenblume ...
Wenn man jetzt die Stecknadel nahm und alle drei zusammen mit einem geschickten Stich an dem dicken, grünen Stiel befestigte ...? Das war sicherlich ein sehr guter Gedanke, nur durfte man eben nicht wie das Mädel so aufgeregt sein. Denn als nun diese drei Blätter glücklich festsaßen, gingen, wie auf Kommando, die anderen drei ab... Das Ganze sah wieder nur aus wie eine halbe Tulpe!
Lore suchte an sich herum. – Ja, wenn sie in ihrem alten, braunen Kattunkleid gewesen wäre, hätte sie wohl noch eine Stecknadel gefunden. Das aber, was jetzt notgedrungen gemacht werden mußte: sechs Blätter mit einer einzigen Stecknadel zu befestigen, das wäre eines Hexenmeisters würdig gewesen. Ein Wunder nur, daß der Stiel nicht ganz und gar entzweiging, zerstochen sah er nun nachgerade genug aus – und die roten Blütenblätter wurden schon etwas schwärzlich ...
Da überkam Lore dasselbe merkwürdige Gefühl wie damals, als sie den kleinen Sperling gefunden hatte, der durchaus nicht mehr hatte fliegen wollen, so oft und so hoch sie ihn auch in die Luft geworfen hatte, weil er – tot war. Den hatte sie schließlich auf einen Zweig gesetzt, daß es aussah, als wenn er etwas pickte ... Sie bog die rosa Papiermanschette herunter, bis man die Erde sah, und legte die sechs roten Blumenblätter wie die Strahlen eines Sterns rund um den grünen Stengel. Eigentlich sah es nun beinahe noch schöner aus, als wenn die Blätter oben am Stengel saßen, so fand es wenigstens Lore. Dann stellte sie den Topf vor Herrn Sempers Tür, zog an der Messingklingel und wollte die Treppe hinunter – und davonlaufen ... Aber das Mädel hatte in seiner Aufregung gar nicht bemerkt, daß hinter dem Fenster des Wintergartens jemand gewesen war, der alle Bemühungen mit den Tulpenblättern beobachtet hatte, und in demselben Augenblick, da Lore klingelte, wurde die Tür aufgemacht, und Herr Semper selbst hielt sie fest, ehe sie entwischen konnte. „Nein – was ist das für eine schöne Tulpe!“ sagte er. „So eine habe ich noch nie gesehen – da wird sich Lili aber freuen!“ Ehe Lore etwas erwidern konnte, hatte Herr Semper sie in sein Arbeitszimmer geführt und redete weiter: „Warte, ich bringe dich gleich zu den anderen.“ Er ließ sie allein und nahm die Tulpe mit. Doch es dauerte keinen Augenblick, daß er wieder da war. Er trug den Tulpentopf im Arm, aber das Seidenpapier hatte er wieder hoch darum geschlagen: „Denn es soll eine Überraschung geben“, erklärte er.
Als Lore gleich darauf unter all den anderen geputzten kleinen Mädchen stand und Herr Semper das Seidenpapier auseinanderschlug, saßen alle sechs Blütenblätter wieder oben am Stengel und sahen frisch und rot aus ... Lili war ganz entzückt – gerade über diese Tulpe, die sie für die schönste erklärte von allen, die sie erhalten, weil es genau solch eine war, wie sie ihr Papa in seinem Wintergarten hatte ...
Seitdem glaubte Lore an höhere Mächte, die sie sich dienstbar machen könnte.
Das wurde ihr erst recht zur Gewißheit, als sie auf dem Heimwege, statt des Blumentopfes nun ein großes Stück Schokoladentorte für die Mutter in der Hand, erstaunlicherweise in ihrer Kleidertasche etwas klimpern hörte und beim Hineinfassen einen ganzen Taler und zwei blanke Groschen fand ...
Aufgeregt erklärte sie ihr Erlebnis der Mutter, die so fassungslos über den unerwarteten Reichtum war, daß sie gar nicht näher fragte, wer denn alles an Gästen dagewesen wäre.
Lore drängte sich mit solcher Berichterstattung auch nicht weiter auf – sie wußte ja, daß die Mutter über manches merkwürdig andere – verkehrte? – Ansichten hatte als sie selbst, die „Lore Lorenzen, geboren auf einem Spreekahn an der Fischerbrücke“, wie auf dem großen, steifen Papier stand, das die Mutter in der Bibel aufbewahrte.
„Gottes Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte“, so hatte sie bei Lehrer Klaus in der Religionsstunde gelernt – nun, sie war wohl eine Ungerechte, so kam es Lore auch jetzt wieder in den Sinn. Denn, warum durfte sie nicht auch in die „Schule für höhere Töchter“ gehen, wie die feinen, kleinen Mädchen, die als Geburtstagsgäste bei Lili Semper gewesen waren ...?
Es war kein Trost für sie, daß Agnes Bertram, die Tochter des Drogisten, auch zu Lehrer Klaus in die Gemeindeschule ging. Das sollte nur „so was heißen“, so hatte selbst die Mutter gemeint, denn Herr Bertram wollte damit beweisen, daß er, wie er stets betonte, „ein strammer Mittelständler“ sei. Auch Mutter Lorenzen wußte nicht genau, was dies bedeutete, die Lore aber erklärte es sich damit, daß Herrn Bertram die Weste immer so furchtbar stramm auf dem runden Bäuchlein saß ...