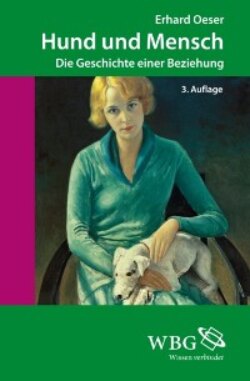Читать книгу Hund und Mensch - Erhard Oeser - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die sprechenden Hunde: Leibniz und seine Nachfolger
ОглавлениеEin auf die große Autorität des berühmten Universalgelehrten Leibniz gestütztes Beispiel eines sprechenden Hundes kann man in den Berichten der französischen Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1706 lesen: „Ohne einen solchen Gewährsmann, wie Monsieur Leibniz es ist – der Augenzeuge war –, würden wir es gar nicht wagen, davon Mitteilung zu machen, dass es in der Nähe von Zeitz in der Region von Meißen einen Hund gibt, der spricht. Es ist der Hund eines Bauern – von ganz gewöhnlicher Gestalt und mittlerer Größe. Ein kleines Kind hörte, wie er einige Laute ausstieß, von denen es glaubte, dass sie deutschen Worten ähnlich seien. Auf Grund dessen setzte es sich in den Kopf, ihm das Sprechen beizubringen. Der ‚Meister’, der wohl nichts Besseres zu tun hatte, sparte weder Zeit noch Mühe, und der ‚Schüler’ hatte glücklicherweise eine derartige Veranlagung, wie man sie wohl schwerlich in einem anderen findet. Nach Ablauf einiger Jahre konnte der Hund schließlich ungefähr 30 Worte aussprechen – wie etwa ‚Tee‘, ‚Kaffee‘, ‚Schokolade‘, ‚Assemblée‘ –, französische Worte also, die – so wie sie sind – ins Deutsche übergegangen sind. Es ist zu bemerken, dass der Hund ungefähr drei Jahre alt war, als seine Schulung begann. Er spricht nur gleichsam als Echo, d. h. nachdem sein Herr ein Wort ausgesprochen hat, und es scheint, als wiederhole er es nur gezwungenermaßen und beinahe gegen seinen Willen, obwohl man ihn überhaupt nicht malträtiert“ (Leibniz 1768, S. 180).
Der von Leibniz mit so großem Interesse beachtete sprechende Hund gab in den darauf folgenden Jahren den Anstoß zu weiteren Versuchen, Hunden das Sprechen beizubringen. Dass dieses ein schwieriges Unterfangen ist und nicht ohne „Beihilfe“ der Menschenhand zustande kommen kann, hat man schon sehr früh erkannt. Denn der Hund kann keinen Lippenlaut hervorbringen, da er die Lippen nicht aufeinander drücken kann, weil die Oberlippe als ziemlich schlaffer Vorhang über die Unterlippe herabhängt. Der Kreismuskel des Mundes fehlt und die Zunge ist viel zu lang und schlaff, um das für die Erzeugung der Zungenlaute notwendige Anpressen der Zunge gegen den Gaumen ausführen zu können.
All die in diesem Zeitraum der ersten beiden Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts gelieferten Berichte über sprechende Hunde weisen auf diese anatomisch begründeten Schwierigkeiten hin, die nur durch unsinnige Tierquälerei überwunden werden konnten. So soll sich im Jahre 1718 in Holland ein Österreicher eingefunden haben, der einen „redenden Hund“ mit sich geführt haben soll. Dieser Hund konnte angeblich alle Buchstaben des Alphabetes nachahmen, ausgenommen die Buchstaben B, M und N. Einem grauen Mops wurde in Augsburg „durch Gurgelrühren“ beigebracht „viele jüdische Worte deutlich auszudrücken“. Noch deutlicher zeigt die Beschreibung eines redenden Hundes in Regensburg, der ebenso wie der Leibniz’sche Hund deutsche und französische Wörter wie Tee, Kaffee, Schokolade und „oui monsieur“ aussprechen konnte, dass es sich um eine ziemlich grobe Manipulation an dem armen Tier handelte. Denn der Meister nahm den Hund auf seinen Schoß und „zerrte ihm bald den Kopf, bald den Hals, bald das Maul auf verschiedene Arten, dass man es ohne Lachen nicht ansehen konnte“ (Flößel 1906, S. 485).
Das gleiche Schicksal hatte der redende Hund in Berlin, der nach einem Bericht in der „Bibliothèque Germanique“ vom Jahre 1720 durch folgende Prozedur zum „Reden“ gebracht wurde: „Sein Herr setzte sich nämlich auf die Erde und nahm den Hund zwischen die Beine, so dass er mit ihm machen konnte, was er wollte. Mit der einen Hand hielt er ihm den oberen, mit der anderen den unteren Kinnbacken. Solange nun das Tier seiner Gewohnheit nach murrte, drückte der Herr auf verschiedene Art bald den einen, bald den anderen Kinnbacken und bisweilen beide zugleich. Hierdurch wurde der Rachen des Hundes auf verschiedene Art verdreht, wodurch verursacht ward, dass er einige Worte aussprechen konnte“ (vgl. Flößel 1906, S. 485). Die Wörter „Tee, Kaffee, Schokolade“ gehörten natürlich ebenfalls zum Repertoire der Sprache dieses Hundes. Noch weniger überzeugend, wenn auch frei von Tierquälerei, waren die Versuche, Hunden beizubringen, ganze Sätze auszusprechen. Ein Hofrat in Helmstedt gelang es zwar, dass zwei seiner Hunde Sätze wie z. B. „Marie, bring Kaffee!“ riefen, doch konnte man diese erst dann verstehen, wenn man sich einmal die Bedeutung dieses artikulierten Gebells hatte erklären lassen. Denn mit der menschlichen Stimme hatte diese Sprache keine Ähnlichkeit.
Schließlich nahmen sich dann auch Bauchredner der sprechenden Hunde an, die in Kostümen gekleidet um ihren Meister gruppiert wurden und sich auf diese Weise an der Täuschung der Zuschauer mitbeteiligten. Anerkennenswert war bei diesen Vorstellungen lediglich die sorgfältige Abrichtung der Hunde, die den leisesten Wink ihres Lehrmeisters verstehen mussten, um die beabsichtigte Täuschung in vollendeter Weise zu ermöglichen.
Das Gegenstück zu den sprechenden Hunden waren die lesenden Hunde, die nicht nur lesen konnten, sondern auch durch Hinlegen von beweglichen Buchstaben Fragen beantworteten. So zeigte man auf der Messe zu Danzig im Jahre 1754 einen kleinen Hund, dem eine Frage vorgelegt wurde, die er dadurch beantwortete, dass er die entsprechenden Buchstaben suchte, die er nacheinander hinlegte, bis die Wörter vollständig waren. Wenn ihn z. B. jemand fragte, wer Rom erbaut hat, so legte er die Buchstaben, die zu dem Wort „Romulus“ erforderlich sind, nacheinander in eine Reihe hin. Auf die Frage, wer der erste römische Kaiser gewesen sei, legte er die Buchstaben zu „Julius Caesar“ zusammen.
Noch größeres Aufsehen erregte ein Pudel namens Munito im Jahre 1818 in Paris, der sowohl Buchstaben als auch Ziffern als Antwort auf Fragen oder Rechenaufgaben zusammenstellte. Dieser Hund ging auch in die Weltliteratur ein. Denn er war das Vorbild von Jules Vernes Hund Dingo, der in einem seiner Romane durch die Zusammenstellung zweier Buchstaben den Mörder seines Herrn entlarvte. Allerdings entlarvte auch Jules Verne, der selbst ein Hundebesitzer war, die Künste Munitos durch folgende Erklärung: „Waren die Buchstaben auf dem Tisch aufgestellt, so lief Munito zwischen dem Alphabet auf und ab. Kam er dabei an denjenigen Buchstaben, den er auswählen musste, um das verlangte Wort zu bilden, so blieb er stehen. Aber das geschah nur, weil er ein für jeden anderen nicht wahrnehmbares Geräusch hörte, das von einem Zahnstocher herrührte, den sein Herr in der Tasche etwas umbog und abspringen ließ. Dieses Geräusch war für Munito das Zeichen, den Buchstaben bei dem er sich befand, zu erfassen und in eine Reihe zu legen“ (Verne 1879, S. 54).
Eine Täuschung ähnlicher Art waren auch die berühmten Rechenkünste des „klugen Hans“, eines Pferdes, das sogar bis zum heutigen Tag noch immer das Trauma der Tierpsychologen darstellt und nicht unbedeutend zur behavioristischen Wende beigetragen hat. Der kanadische Psychologe Stanley Coren, der 1994 eine umfangreiche Studie über die Intelligenz der Hunde verfasst hat, sieht in dieser Geschichte vom rechnenden Pferd eine wissenschaftliche Peinlichkeit, die eine Reihe von zum Teil sogar berühmten Psychologen in den Augen anderer Wissenschaftler in Misskredit gebracht hat. Der Betreuer dieses Pferdes, ein Herr von Osten, ein ehemaliger Lehrer, stellte dem klugen Hans eine Rechenaufgabe aus dem Bereich der vier Grundrechnungsarten, Addition, Substraktion, Multiplikation oder Division, entweder mündlich oder indem er die Aufgabe auf eine Karte schrieb. Anschließend „rechnete“ das Pferd und klopfte entsprechend dem Resultat mit dem Huf auf den Boden.
Rechnen war nicht die einzige Leistung dieses Wunderpferdes. Es konnte die Buchstaben des Alphabets und eine große Anzahl von Farben unterscheiden, geometrische Figuren richtig bezeichnen, Töne richtig angeben, Melodien erkennen und nach dem Zeugnis eines Zeitgenossen (Zell 1922, S. 194) auch die Uhrzeit auf einer Taschenuhr ablesen. Übertroffen wurden diese Leistungen des „klugen Hans“ von einem Pferd des Juweliers Krall aus Elberfeld, das sogar Quadrat- und Kubikwurzeln aus großen Zahlen ziehen konnte, und das alles wurde immer nur durch Klopfen mit dem Huf angezeigt.
Die rechnenden Pferde aus dem 20. Jahrhundert hatten aber auch Vorläufer in vergangenen Zeiten. So wurde bereits 1732 in Saint-Germain ein Pferd vorgeführt, das außer anderen Kunststücken durch Aufschlagen mit dem Huf auf die Erde die Anzahl der Augen auf einer Spielkarte oder die Stunde auf einem Uhrenblatt anzeigen konnte. Aber bereits damals wusste man, dass alle diese Kunststücke durch fast unmerkliche Andeutungen, Zeichen und Winke zustande kamen, die das Pferd von seinem Herrn erhalten hatte.
Abb. 2: Der lesende Hund (aus Verne 1879)
Die Dressur zu solchen Leistungen bedarf zwar großer Geduld, ist aber relativ einfach: Schlägt man einem Pferd auf die Krone eines Vorderschenkels, so scharrt es mit dem Fuß. Der Dresseur tritt vor das Pferd, spricht in fragendem Ton zu ihm und gibt ihm solche Schläge. Soll das Pferd nicht mehr scharren oder klopfen, so tritt der Dresseur zurück. Ist diese Übung öfters wiederholt worden, so genügt dann nur die gleiche Stellung und der fragende Ton, um das Pferd so lange scharren zu lassen, bis der Dresseur zurücktritt, sodass also das Pferd die Frage nach bestimmten Zahlen scheinbar richtig durch Scharren oder Klopfen mit dem Huf beantwortet. Das war auch im Prinzip die Lösung der Frage nach der Intelligenz des „klugen Hans“, der auf die unauffälligen Signale nicht nur eines Betreuers, sondern in dessen Abwesenheit auch auf die gar nicht bewusst erfolgten Reaktionen der Zuseher achtete.
Nachdem ein nur wenig bekannter Psychologe namens Oskar Pfungst durch sorgfältig ausgeführte Experimente die Sache mit dem „klugen Hans„ in diesem Sinne aufgeklärt hatte, schlug die Meinung der Tierpsychologen ins Gegenteil um: Sie waren der Meinung, dass jede Annahme, Tiere könnten höhere geistige Fähigkeiten besitzen, nur zu Demütigung und Schande führen muss (Coren 1995, S. 97).