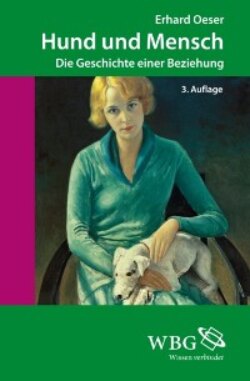Читать книгу Hund und Mensch - Erhard Oeser - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die moderne Theorie der Seelenlosigkeit der Tiere
ОглавлениеDie wissenschaftliche Richtung, die im Grunde genommen die cartesianischen Vorstellungen von der Seelenlosigkeit der Tiere im 20. Jahrhundert fortsetzte, war der sog. Behaviorismus. Ihre Hauptvertreter – die amerikanischen Psychologen John Watson und B. F. Skinner – versuchten eine streng wissenschaftliche Psychologie zu entwickeln, die sich nur auf objektiv beobachtbare Verhaltensweisen stützen sollte. Obwohl sie die Existenz von Gefühlen, Gedanken und anderen geistig-seelischen Regungen weder bei Menschen noch bei Tieren leugnete, behauptete sie, dass diese, weil nicht direkt beobachtbar, auch nicht wissenschaftlich erfassbar seien.
Viele dieser behavioristisch eingestellten Psychologen und Verhaltensforscher meinen mit zwei allgemeinen Erklärungsprinzipien auskommen zu können, um sämtliche auch noch so komplexe Verhaltensweisen von Tieren erklären zu können. Das eine Erklärungsprinzip ist die natürliche Auslese, die im Laufe der Evolution bestimmte arterhaltende Verhaltensweisen hervorbringt, die auf die Nachkommen weitervererbt werden. Heutzutage werden diese als genetisch bedingte Instinkthandlungen angesehen. Das andere Prinzip, das eigentliche behavioristische Erklärungsprinzip, ist das, was Skinner „Verstärkungsmöglichkeit“ (reinforcement) genannt hat. Damit ist jeder Prozess gemeint, bei dem die günstigen Ergebnisse einiger Verhaltensweisen Veränderungen in den Tieren hervorrufen, die sich dahingehend auswirken, dass dieses Verhalten wiederholt wird bzw. an Häufigkeit zunimmt. In dieser Auffassung kann man sehr leicht eine neue Version des alten Arguments von Malebranche erkennen, dass auch Maschinen sich leichter bewegen, wenn man sie bereits öfter gebraucht hat. Konsequenterweise hat Skinner dieses „Verstärkungsprinzip“ auch auf die Evolutionstheorie angewandt, indem er annahm, dass nicht nur das Lernen während des individuellen Lebens als „Verstärkung“ anzusehen ist, sondern auch die Auswirkungen der natürlichen Selektion als eine Art von „Verstärkung“ zu betrachten sind. Denn ein Verhalten kann auch insofern eine „Verstärkung“ erfahren, wenn sich der Reproduktionserfolg der Tiere, bei denen es auftritt, vergrößert (Skinner 1966, 1981).
Doch wurde diese logisch korrekte Ausdehnung des Prinzips der „Verstärkungsmöglichkeiten“ nicht generell akzeptiert, da sich die Psychologen nur für die „Verstärkungsmöglichkeiten“ während der Lebensspanne eines Individuums interessierten, während die Ethologen sich fast ausschließlich mit den Auswirkungen der natürlichen Selektion auf das Verhalten beschäftigten. Beide Gruppen dieser behavioristisch eingestellten Wissenschaftler ließen grundsätzlich geistig-seelische Vorgänge unberücksichtigt. Auch dann, wenn sie komplexes Lernen und Problemlösen bei Tieren untersuchen, erwähnen sie fast nie die Möglichkeit, dass Tiere Gefühle, Erinnerungen, Absichten, Wünsche, Ansichten oder andere seelische Regungen haben könnten.
Viele Behavioristen lehnen auch heute noch jede Art des „Mentalismus“ so heftig ab, als sei er eine tödliche Pest (Griffin 1990, S. 38). Die Ablehnung jeglicher Beschäftigung mit Bewusstsein und subjektiven Gefühlen geht so weit, dass manche Psychologen auch beim Menschen prinzipiell ihre Existenz oder zumindest ihre wissenschaftliche Erforschbarkeit abstreiten. In einer krassen Form solcher Verleugnung argumentierte Harnard (1982), dass erst nachdem unsere Gehirnfunktionen bestimmt haben, was wir tun wollen, eine Illusion von Bewusstsein entstehe im Verein mit dem irrigen Wahn, wir hätten eine Wahl getroffen oder Kontrolle über unser Verhalten gehabt (vgl. Griffin 1990, S. 26).
An der Ablehnung der Erforschbarkeit sowohl des menschlichen als auch tierischen Bewusstseins änderte auch die kognitive Wende der Psychologie nichts, soweit sie sich in Analogie zu Computersystemen auf das Informationsverarbeitungsparadigma in seiner strengen Reduktion auf bloße Zeichenmanipulation stützt, die ohne jedes Bewusstsein ablaufen kann. Lebewesen zu analysieren, als seien sie Computer, ist nur eine neue Art von Maschinentheorie. Sie ist zwar als verobjektivierende Methode nützlich, gerade so wie die Analogie von Herz und Pumpe wichtig war für die Entdeckung des Blutkreislaufes (vgl. Oeser 2002, S. 49 ff.). Sie kommt aber sehr rasch an die Grenzen ihrer Erklärungskraft. Das Ausmaß unbewusster Informationsverarbeitung im menschlichen und vor allem im tierischen Gehirn ist zwar sehr groß, sodass die bewussten Prozesse nur die Spitze eines Eisberges darstellen. Doch ihre Existenz kann nicht geleugnet werden, selbst dann nicht, wenn man dem alten Grundsatz Ockhams huldigt, dass man ohne Notwendigkeit die Entitäten nicht vermehren soll. Das hat auch Lloyd Morgan nicht getan, von dem das dem Ockham’schen Rasiermesser verwandte Morgan’sche Gesetz stammt, das die Forderung enthält, niemals etwas auf einer höheren Ebene zu erklären, wenn eine niedrigere ausreicht (Masson 1997, S. 143).
Nach Griffin (1990, S. 12) ist die Wahrscheinlichkeit, dass bewusstes Denken ein bestimmtes Verhalten begleitet, entweder sehr hoch oder sehr niedrig. Jacques Loeb (1918) und andere Biologen, die das Bewusstsein von Tieren nicht in Betracht ziehen wollten, haben Tiere und Situationen ausgewählt, bei denen das Verhalten relativ konstant war. So kann eine Raupe stunden- und tagelang mit der Ausdauer einer Maschine auf eine Lichtquelle zukriechen. Wenn dann ein Experimentator dieses Verhalten dadurch hervorrufen oder einstellen kann, dass er ein Licht an- oder ausknipst, dann scheint dieses Verhalten in relativ einfacher und direkter Weise durch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Lichts verursacht zu sein.
Will man jedoch diese Methode auf komplexere Verhaltensweisen ausdehnen, vor allem auf diejenigen, die eine Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umstände zeigen, dann lässt sich die entscheidende Rolle des Bewusstseins nicht verleugnen. Es waren vor allem diese komplexen individuellen, in Anekdoten beschriebenen Verhaltensweisen von Tieren, die von Darwin und seinen Zeitgenossen als Belege für das Vorhandensein von Bewusstsein, Denken und Fühlen vorgebracht wurden. Die übertriebene Entwertung dieser anekdotenhaften Angaben hat viele Beobachtungen ausgeschlossen, die Ansatzpunkte für neue Forschungen hätten werden können. Darwin selbst hatte jedenfalls keine Probleme, die Frage nach dem Bewusstsein der Tiere positiv zu beantworten. Denn für ihn war die Annahme, dass nicht nur der Mensch, sondern auch die höheren Tiere Bewusstsein und Gefühle haben, eine logische Konsequenz der Evolutionstheorie.