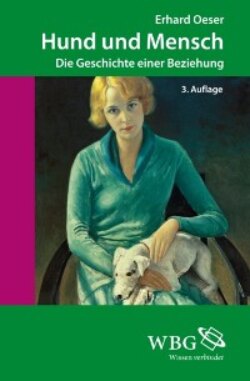Читать книгу Hund und Mensch - Erhard Oeser - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Evolution des Bewusstseins: Darwin und die Folgen
ОглавлениеObwohl Darwin sowohl die Entstehung des Lebens als auch die Entstehung des Bewusstseins oder Geistes als die beiden „hoffnungslosen“ Probleme bezeichnet hat, die, wenn überhaupt jemals, von Menschen erst in ferner Zukunft gelöst werden können (Darwin 1875, S. 86), war er davon überzeugt, dass auch Tiere Bewusstsein und Gefühle haben. Ja, er war sogar der Meinung, dass zwischen den so genannten höheren Säugetieren, wie Hunde und Affen, und dem Menschen „kein fundamentaler Unterschied“ besteht (a. a. O. S. 8), sondern lediglich graduelle Abstufungen. Noch mehr war Darwin davon überzeugt, dass auch die niederen Tiere dieselben Gemütsbewegungen wie wir besitzen, während die höheren Tiere, wie vor allem die Hunde, uns in der Hinsicht sogar übertreffen. Und er zitiert einen alten Schriftsteller, der gesagt haben soll: „Ein Hund ist das einzige Ding auf der Welt, das dich mehr liebt als sich selbst“ (a. a. O. S. 90). Als Beleg dafür führt Darwin den Bericht über einen Hund an, der noch im Todeskampf seinen Herrn liebkost hat, und fügt hinzu: „Und alle haben davon gehört, wie ein Hund, an dem man die Vivisektion ausführte, die Hand seines Operateurs leckte. Wenn nicht dieser Mann ein Herz aus Stein hatte, so muss er, wenn die Operation nicht völlig gerechtfertigt war, bis zur letzten Stunde seines Lebens Gewissensbisse gefühlt haben“ (a. a. O. S. 90).
Hunde sind für Darwin das beliebteste Beispiel für seine Auffassung, dass die meisten komplizierten Gemütsbewegungen den höheren Tieren und uns gemeinsam sind. Denn Hunde haben nicht nur Liebe zum Menschen, sondern auch die Sehnsucht, geliebt zu werden. Sie haben nach Darwins Auffassung Ehrgeiz, lieben Anerkennung und Lob. Ein Hund, der seinem Herren den Korb trägt, zeigt „Selbstgefälligkeit und Stolz in hohem Grade“. Er besitzt Schamgefühl, Großmut und Bescheidenheit. Darwin glaubt sogar, dass Hunde etwas zeigen, was ganz gut „ein Sinn für Humor“ genannt werden kann: „Wenn irgend etwas, ein Stock oder dergl., einem Hund hingeworfen wird, trägt er es oft eine kurze Strecke weit fort; dann kommt er wieder, legt den Gegenstand nahe vor sich auf den Boden und wartet bis sein Herr dicht heran kommt, um jenen aufzuheben. Nun ergreift aber der Hund das Ding schnell und läuft im Triumph damit fort, wiederholt dasselbe Stückchen und erfreut sich offenbar des Scherzes“ (Darwin a. a. O. S. 92).
Was die intellektuellen Fähigkeiten anbelangt, ist Darwin der Meinung, dass Aufmerksamkeit, Lernen durch Nachahmung, Gedächtnis und Einbildungskraft zur mentalen Grundausstattung des Hundes gehören. Wölfe, die mit Hunden aufgezogen wurden, lernten zu bellen, und Hunde, die mit Katzen aufgezogen wurden, lernten von diesen die altbekannte Gewohnheit der Katzen, sich die Füße zu lecken und sich damit das Gesicht und die Ohren zu reinigen. Darwin selbst stellte absichtlich das Gedächtnis eines Hundes auf die Probe, als er ihn nach einer Abwesenheit von fünf Jahren wieder traf und in seiner alten Weise zu sich rief: „Er zeigt keine Freude, aber folgte mir augenblicklich, kam heraus und gehorchte mir so genau, als wenn ich ihn erst vor einer halben Stunde verlassen hätte. Ein Strom alter Ideenverbindungen, welche fünf Jahre geschlummert hatten, war hierdurch in seiner Seele augenblicklich angeregt worden“ (Darwin a. a. O. S. 96).
Hunde, Katzen, Pferde und wahrscheinlich alle höheren Tiere haben nach Darwin lebhafte Träume und deswegen auch eine gewisse Einbildungskraft, was sich durch Bewegungen und Lautäußerungen im Schlaf belegen lässt. Auch die vermeintlich unübersteigbare Schranke zwischen dem Geist des Menschen und den Fähigkeiten der Tiere ist für Darwin nur eine nicht beweisbare Voreingenommenheit. Denn es ist schwer zu verstehen, wie jemand, der nur irgendwann einmal einen Hund gehalten hat, an dem Vermögen eines Tieres zweifeln kann, die wesentlichen Prozesse des Nachdenkens auszuüben (Darwin a. a. O. S. 102).
Alle höheren Tiere besitzen nach Darwins Auffassung „dieselben Kräfte der Nachahmung, Aufmerksamkeit, Überlegung, Wahl, Gedächtnis, Einbildung, Ideenassoziation, Verstand, wenn auch in sehr verschiedenen Graden. Die Individuen einer und derselben Spezies zeigen gradweise Verschiedenheit im Intellekt, von absoluter Schwachsinnigkeit bis zu großer Trefflichkeit. Sie sind auch dem Wahnsinn ausgesetzt, wenn schon sie weit weniger oft daran leiden als der Mensch“ (Darwin a. a. O. S. 102).
Darwin ist sich aber auch im Klaren, dass es außerordentlich schwer ist, zu bestimmen, inwieweit Tiere irgendwelche Spuren hoher geistiger Fähigkeiten wie Abstraktion, allgemeine Ideen, Selbstbewusstsein und geistige Individualität zeigen. Diese Schwierigkeiten rühren von der Unmöglichkeit her, zu beurteilen, was in der Seele eines Tieres vorgeht. Beobachtbar ist nur das Verhalten, das entweder, wie Darwin schon weiß und ausdrücklich feststellt, durch Erfahrung und Verstand oder durch ererbte Gewohnheit, d. h. nach einem Instinkt erfolgt.
Als Beispiel führt Darwin das Verhalten der Schlittenhunde an, die immer auseinander gingen und sich trennten, wenn sie auf dünnes Eis kamen, sodass ihr Gewicht gleichmäßiger verteilt wurde. Dieses Verhalten kann sowohl durch die Erfahrung jedes einzelnen Individuums oder durch Nachahmung nach dem Beispiel der älteren und gescheiteren Hunde erfolgen oder es könnten die arktischen Wölfe, die Urväter der Eskimohunde, diesen Instinkt erlangt haben, der sie zwang, ihre Beute nicht in einer geschlossenen Masse anzugreifen, wenn sie sich auf dünnem Eis befanden. Ist in diesem Fall die Frage, ob es sich um einen vererbten Instinkt oder eine überlegte Entscheidung auf Grund von individueller Erfahrung handelt, nicht eindeutig zu beantworten, so lässt sich doch das Vermögen, abstrakte Ideen zu bilden, dem Hund nicht absprechen. Denn wenn ein Hund einen anderen Hund in weiter Entfernung wahrnimmt, dann ist es für Darwin klar, dass er ihn nur im abstrakten Sinn wahrnimmt, dass es ein Hund ist. Denn erst, wenn dieser Hund näher kommt, wird er als Individuum erkannt, und das Verhalten des wahrnehmenden Hundes ändert sich plötzlich, wenn der andere Hund mit ihm befreundet ist.
Man kann zwar auch nach Darwin keinem Tier Selbstbewusstsein zuschreiben, wenn man unter diesem Begriff versteht, dass es über solche Fragen wie: woher es komme oder wohin es gehe oder was das Leben und was der Tod sei und so fort, nachdenke. Aber, so fragt er „wie können wir sicher sein, dass ein alter Hund mit einem ausgezeichneten Gedächtnis und etwas Einbildungskraft, wie sich durch seine Träume zu erkennen gibt, niemals über die Freuden und Leiden Betrachtungen anstellt, welche er früher auf der Jagd hatte?“ (Darwin a. a. O. S. 108).
Was aber nun die Sprache betrifft, also jene Fähigkeit, die auch nach Darwin mit Recht als einer der Hauptunterschiede zwischen dem Menschen und den Tieren betrachtet wird, so verwendet Darwin das gleiche Argument, das Gassendi gegen Descartes vorgebracht hat: Hunde haben eben ihre eigene Sprache, denn sie haben seit ihrer Domestikation in wenigstens vier oder fünf Tönen zu bellen gelernt: das Bellen des Eifers, wie auf der Jagd, das des Ärgers ebenso wie das Knurren, das heulende Bellen der Verzweiflung, z. B. wenn sie eingeschlossen sind, das Heulen bei Nacht, das der Freude, wenn sie z. B. mit ihrem Herrn spazieren gehen sollen, und das sehr bestimmte Bellen des Verlangens oder der Bitte, z. B. wenn sie wünschen, dass eine Tür oder ein Fenster geöffnet werden soll.
Was den Menschen von den Tieren unterscheidet ist nicht das Verständnis der artikulierten Laute. Denn Hunde, selbst wenn sie nicht wirklich, wie die vergeblichen Versuche gezeigt haben, einer artikulierten Sprache wie der des Menschen fähig sind, verstehen, wie jedermann weiß, viele Worte und Sätze. Der Unterschied zum menschlichen Sprachvermögen besteht nach Darwin allein darin, dass der Mensch eine „unendlich größere Fähigkeit besitzt, die verschiedenartigsten Laute und Ideen zu assoziieren. Aber diese Fähigkeit muss erst im individuellen Leben des Menschen erworben werden. In dieser Beziehung stehen die ausgewachsenen Hunde auf derselben Entwicklungsstufe wie Kinder zwischen zehn und zwölf Monaten, die viele Worte und kurze Sätze verstehen und doch nicht ein einziges Wort hervorbringen können.“
Schon zu Darwins Zeiten identifizierte man Sprache und Denkvermögen. Weil die Sprache als notwendiges Hilfsmittel des Gedankens zur Entwicklung des Bewusstseins und zur Deutlichkeit und Mannigfaltigkeit der Begriffe unentbehrlich ist, wollte man den Gedanken ohne Sprache als unmöglich ansehen. Darwin zitiert in diesem Zusammenhang einen Aphorismus seines Zeitgenossen Max Müller: „Es gibt keine Gedanken ohne Worte, ebenso wenig wie es Worte ohne Gedanken gibt“ (Darwin a. a. O. S. 115). Das schlimmste Paradox, das sich aus dieser Identifikation von Gedanken und Worten ergibt, besteht darin, dass ein Kind (in-fans, nicht sprechend) kein menschliches Wesen ist und dass Taubstumme nicht eher in den Besitz der Vernunft gelangen, bis sie gelernt haben, ihre Finger zur Nachahmung gesprochener Worte zu gebrauchen. Daher ist es für Darwin unmöglich, das gesprochene Wort als das alleinige Kriterium für die Fähigkeit anzusehen, allgemeine Begriffe zu bilden: „Ein Hund bildet einen allgemeinen Begriff von Katze oder Schaf und kennt das entsprechende Wort so gut wie ein Philosoph. Und die Fähigkeit zu verstehen ist ein ebenso guter, wenn auch dem Grade nach niedriger Beweis für vokale Intelligenz, wie die Fähigkeit zu sprechen“ (L. Stephen nach Darwin a. a. O. S. 115).
Darwin scheut sogar nicht davor zurück zu behaupten, dass Hunde zumindest so etwas Ähnliches wie religiöse Gefühle besitzen, die eine komplizierte Verbindung von Liebe, vollständiger Unterordnung, Furcht und Verehrung darstellen. Denn, wie bereits Bacon und der Dichter Burns behaupteten, „ein Hund blickt zu seinem Herrn wie zu einem Gott auf“ (Darwin a. a. O. S. 123). Darwins Evolutionstheorie beseitigte nach der Auffassung seiner Anhänger und Mitstreiter, wie etwa Alfred Brehm, die unnatürliche Vorstellung vom Menschen als eines „Zwitterwesens, zum Gott zu gering, zum Tier zu erhaben“ (Brehm 1876, 1. Bd. S. 2). Für Brehm ist der Mensch nichts anderes als ein Säugetier, das heißt „ein lebendes, fühlendes Wesen mit rotem warmen Blute, welches lebendige Junge gebiert und sie groß säugt“ (Brehm a. a. O. S. 1). Wenn man also dem Menschen Bewusstsein und Gefühle zuspricht, so haben sie die anderen Säugetiere auch.
Für Ludwig Büchner, dem radikalsten Anhänger Darwins, werden in diesem Sinn alle so genannten spezifischen Unterscheidungsmerkmale zwischen Mensch und Tier bei genauerer Betrachtung hinfällig. Beim „Studium der Tierseele“, sagt er, „wird man dann alsbald ganz andere Dinge erfahren als diejenigen, welche die Schreibstubengelehrten in ihrer hohen und hohlen Weisheit uns bisher glauben zu machen bemüht waren, und wird sich alsbald überzeugen, dass das menschliche Wesen in seiner tiefsten Erniedrigung oder auch in seinem rohesten Urzustande so nahe an die Tierwelt streift, dass man sich unwillkürlich fragt, wo denn eigentlich die Grenze zu ziehen ist“.
Scheitlin, ein anderer Anhänger Darwins, sieht im Hund sogar einen „Zweidrittelmenschen“ (Brehm a. a. O. S. 583). Seine Beschreibung der Hundeseele stellt den Höhepunkt der Gegenreaktion auf die Maschinentheorie der Tiere dar, wenn er sagt, dass die Seele des Hundes unleugbar so vollkommen ist, wie die eines Säugetiers nur sein kann: „Von keinem Tier können wir so oft sagen, dass ihm vom Menschen nichts mehr als die Sprache mangelt, von keinem Säugetier haben wir so viele Darstellungen aller Abänderungen, von keinem so eine außerordentliche Menge von Erzählungen, welche uns seinen Verstand, sein Gedächtnis, seine Erinnerungskraft, seine Anhänglichkeit, Dankbarkeit, Wachsamkeit, Liebe zum Herrn, Geduld im Umgang mit Menschenkindern, Wut und Todeshaß gegen die Feinde des Herren etc. kundtun sollen, weswegen kein Tier so oft als er dem Menschen als Muster vorgestellt wird. Wie viel wird uns von seiner Fähigkeit zu lernen erzählt? Er tanzt, er trommelt, er geht auf dem Seil, er steht Wache, er erstürmt und verteidigt Festungen, er schießt Pistolen los; er dreht den Bratspieß, zieht den Wagen; er kennt die Noten, die Zahlen, Karten, Buchstaben; er holt dem Menschen die Mütze vom Kopf, bringt Pantoffeln und versucht Stiefel und Schuhe wie ein Knecht auszuziehen; er versteht die Augen- und Mienensprache“ (Brehm a. a. O. S. 582).
Gerade auf diese letztgenannte Fähigkeit, die, wie bereits gezeigt, die Grundlage für die betrügerischen Täuschungsmanöver über lesende und rechnende Hunde waren, legt Brehm zu Recht besonderen Wert. Der Hund beweist im Umgang mit Menschen ein Erkennungsvermögen, welches oft an Wunder grenzt. Und auch umgekehrt kann man beim Hund sehr gut den wechselnden Ausdruck des Hundegesichts beobachten. Für Brehm spricht sich die hohe geistige Fähigkeit des Hundes ganz unverkennbar in seinem Gesicht aus. Jeder Hund hat seinen durchaus besonderen Ausdruck, sodass man zwei Hundegesichter ebenso wenig verwechseln kann wie zwei Menschengesichter. Es haben daher nicht nur die einzelnen Hunderassen unterschiedliche geistige und emotionale Fähigkeiten, sondern auch jeder einzelne Hund ist ein unverkennbares Individuum mit besonderen Eigenheiten, die sich im Laufe seines Lebens immer mehr ausprägen.