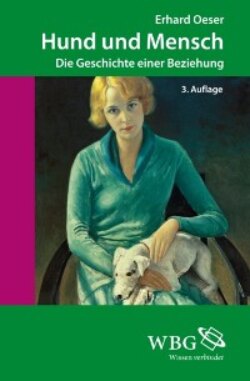Читать книгу Hund und Mensch - Erhard Oeser - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Intelligenz der Hunde
ОглавлениеWährend jedoch Scheitlin im Fahrwasser der Darwin’schen Evolutionstheorie in unkritischer Weise alle wirklichen und scheinbaren Belege für die geistigen Fähigkeiten der Hunde wieder hervorholt, gelingt es dem Begründer der Prähistorie, dem Ethnologen John Lubbock, in vorbildlicher Weise durch genau geplante Experimente die umstrittenen geistigen Fähigkeiten der Hunde, insbesondere das berüchtigte Lesen und Rechnen aufzuklären und auf ein wissenschaftlich begründetes Maß einzuschränken (Lubbock 1889, S. 275 ff.). Er wird damit zu einem Vorläufer der heute üblichen Intelligenztests an Hunden und Hunderassen (Coren 1995). Die Grundidee, von der Lubbock ausgeht, entspricht durchaus den heutigen Vorstellungen wenn er sagt, „dass wir bis jetzt bloß versucht haben, Tiere zu unterrichten, anstatt von ihnen zu lernen, – unseren Gedankengang auf sie zu übertragen, anstatt eine Laut- und Zeichensprache zu ersinnen, mittels der sie sich mit uns verständigen könnten“ (Lubbock 1889, S. 275).
Als Vorbild diente Lubbock der auch von Darwin behandelte Fall der taubstummen Laura Bridgeman, die im Alter von zwei Jahren nach einer schweren Krankheit sowohl taub und blind wurde als auch das Vermögen zu riechen und schmecken fast verlor. Nur der Tastsinn blieb noch erhalten. Unter Anleitung des Arztes Dr. Howe erlangte sie jedoch die Fähigkeit, sich durch Zusammenstellen von erhabenen Buchstaben auszudrücken. In den ersten Versuchen wurden an Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie etwa Löffel oder Schlüssel kleine Täfelchen befestigt, auf denen in erhabenen Buchstaben die Namen der Gegenstände dargestellt waren.
Diese Methode verwendete Lubbock bei seinem Hund, einem schwarzen Pudel namens „Van“. Er nahm zwei Papptäfelchen. Auf dem einen stand in Großbuchstaben geschrieben das Wort „FOOD“. Das andere blieb weiß. Wie sorgfältig Lubbock bei diesem Hundeintelligenztest vorging, zeigt seine eigene Beschreibung des weiteren Verlaufs des Experiments: „Darauf legte ich beide über zwei Näpfchen, in dem einen unter der bedruckten Karte war etwas in Milch eingeweichtes Brot, das Van, nachdem seine Aufmerksamkeit auf das Täfelchen gelenkt war, fressen durfte. Dies wurde immer wiederholt, bis er genug hatte. Nach ungefähr 10 Tagen fing er an, die Täfelchen zu unterscheiden. Darauf legte ich sie auf den Boden und ließ ihn dieselbe apportieren, was er gern und geschickt genug tat. Brachte er das leere Täfelchen, so wies ich es einfach zurück, brachte er aber das bedruckte, so gab ich ihm ein Stückchen Brot und innerhalb eines Monats hatte er den Unterschied prächtig weg. Darauf nahm ich einige andere Täfelchen, bedruckt mit den Worten ‚out‘ (aus), ‚tea‘ (Tee), ‚bone‘ (Knochen), ‚water‘ (Wasser) und eine Anzahl anderer: zwar auch mit Worten versehener, so wie ‚nought‘ (genug), ‚plain‘ (leer), ‚ball‘ (Ball) usw., die aber meiner Absicht nach für ihn keine weitere Bedeutung haben sollten. Van lernte es bald verstehen, dass in dem Bringen eines Täfelchens eine Bitte lag, und bald lernte er auch die bedruckten und leeren Täfelchen unterscheiden. Es kostete ihm längere Zeit, die Verschiedenheit zwischen den einzelnen Worten kennenzulernen, aber nach und nach vermochte er einige wie ‚food‘, ‚out', ‚bone‘, ‚tea‘ u. s. w. zu erkennen. Wenn man ihn fragte, ob er gern mit spazieren gehen möchte, so nahm er freudig das Täfelchen mit ‚out‘ auf, indem er es aus mehreren andern heraussuchte, und brachte es zu mir oder lief damit in hellem Triumph zur Tür“ (Lubbock 1889, S. 280).
Um zu vermeiden, dass sich der Hund nur an eine bestimmte Lage des Täfelchens orientierte, wurden die Täfelchen auf verschiedenste Weise immer wieder neu durcheinander gelegt. Aber damit nicht genug. Denn Lubbock war natürlich auch der besonders ausgeprägte Geruchssinn der Hunde bekannt. Um zu vermeiden, dass der Hund das Täfelchen bloß am Geruch, nicht aber an dem darauf geschriebenen Wort erkannte und auswählte, wurde folgendes höchst aufwendiges Verfahren angewandt: „Brachte Van z. B. ein Täfelchen mit ‚food‘ darauf, so wurde nicht etwa das nämliche Täfelchen wieder hingelegt, sondern ein anderes, aber mit derselben Aufschrift; brachte er dieses, ein drittes, dann ein viertes u. s. f. Für eine einzige Mahlzeit waren daher 18 bis 20 Täfelchen erforderlich, sodass er augenscheinlich nicht durch den Geruch geleitet werden konnte. Niemand, der zugesehen hätte, wie er auf eine Reihe von Täfelchen nieder blickte und das Gewünschte aufhob, konnte meiner Meinung nach darüber im Zweifel sein, dass der Hund fühlte, wie er mit dem Überbringen der Karte eine Bitte tat, und dass er nicht bloß ein Täfelchen vom andern unterscheiden konnte, sondern auch Wort und Gegenstand in Verbindung zu bringen wusste“ (Lubbock 1889, S. 281).
Lubbock war sich jedoch im Klaren, dass mit solchen Experimenten nur „ein schwacher Anfang“ für den Nachweis des bewussten Verstehens und Handelns gemacht worden ist. Er wandte sich daher auch einem weiteren Gebiet der Intelligenz des Hundes zu: ihren rechnerischen Fähigkeiten. Auch hier war die Sachlage nicht so einfach, wie sie auf dem ersten Blick aussah. Lubbock leitet seine Untersuchungen über „die arithmetischen Anlagen des Hundeverstandes“ mit folgenden Worten ein: „Man könnte sich einbilden, dass nicht viel Mühe dazu gehöre, um zu entscheiden, wie weit ein Tier zählen und ob es eine einfache Addition, wie z. B. 2 und 2 macht 4, ausführen kann. Wenn wir uns aber überlegen, wie man es anfangen soll, dies zu entscheiden, dann verliert die Sache ihr einfaches Aussehen“ (Lubbock 1889, S. 287). Dann schildert er den Verlauf dieses Experimentes und dessen enttäuschendes Ergebnis: „Wir machten mit unsern Hunden Versuche, indem wir ein Stückchen Brot vor ihnen hinlegten, sie aber verhinderten, es zu berühren, bis wir bis sieben gezählt hatten. Um zu verhindern, dass wir selbst unwillkürlich irgendein Zeichen gäben, wendeten wir ein Metronom an, und um den Taktschlag vernehmlicher zu machen, wurde ein dünnes Stäbchen an den Pendel desselben befestigt. Es machte wirklich den Eindruck, als ob die Hunde wussten, wann der Augenblick der Erlaubnis zuzulangen gekommen sei, aber ihre Bewegung beim Nehmen des Brotes waren kaum bestimmt genug, um die Sache über jeden Zweifel erhaben erscheinen zu lassen. Außerdem bemerken Hunde ein ihnen auch unwillkürlich gegebenes Zeichen so außerordentlich rasch, dass das Resultat des ganzen Versuches mir ungenügend erschien“ (Lubbock 1889, S. 287).
Noch mehr entmutigt wurde Lubbock, ein derartiges Experiment fortzusetzen, durch eine Mitteilung eines Herrn Huggins, dessen „sehr intelligenter Hund“ bereits alle Charakteristiken des „klugen Hans“ aufwies. Auch er konnte anscheinend rechnen, was durch folgenden Test demonstriert wurde: Zuerst wurde dem Hund befohlen, sich zu setzen, und man zeigte ihm ein Stückchen Kuchen. Eine Anzahl Karten wurden auf den Boden gelegt, einzeln nummeriert mit 1, 2, 3 und so weiter bis 10. Darauf wurde eine Aufgabe gestellt, z. B. die Quadratwurzel aus 9 oder 16 oder eine Summe wie 6 + 5 – 3, und der Hund antwortete mit Bellen. Das Stückchen Kuchen war dann die Belohnung für solche Klugheit. Es wurde zwar dem Hund nicht absichtlich irgendein Zeichen gegeben, aber das Tier war ein so scharfer Beobachter auch der geringsten Andeutung, dass er im Stande war, die richtige Antwort zu finden. Lubbock erklärte sich diese phantastische Leistung durch die einfache Tatsache, „dass der Hund in dem Gesichtsausdrucke seines Herrn liest, wann er richtig gebellt hat, wenigstens wendet er niemals seine Augen von dessen Antlitz“ (Lubbock 1889, S. 288).
Vergleicht man diese frühen Versuche über die Hundeintelligenz mit den Ansichten zu dieser Frage in der gegenwärtigen Psychologie, dann muss man feststellen, dass die Diskussion darüber so kontrovers ist wie nie zuvor. Während die einen, wann immer es um höhere geistige Prozesse geht, energisch der Vorstellung widersprechen, menschliches und tierisches Verhalten würden notwendigerweise durch die gleichen Grundsätze bestimmt, sehen die anderen im Sinne Darwins und seiner Evolutionstheorie nur einen graduellen Unterschied. So überträgt der kanadische Psychologe Stanley Coren das Konzept der „multiplen Intelligenzen“ seines amerikanischen Kollegen Howard Gardner, mit dem dieser versuchte, die menschliche Intelligenz zu beschreiben, auf Hunde und unterscheidet auch bei ihnen räumliche, körperlich-kinästhetische, intra- und interpersonelle Intelligenz. Er billigt den Hunden sogar einige mathematische und logische Fähigkeiten zu und ganz im Gegensatz zu Descartes auch eine gewisse sprachliche Intelligenz. Darüber hinaus schlägt er drei Dimensionen der manifesten Intelligenz des Hundes vor, die sich auch durch geeignete Tests messen lassen: die adaptive, die Arbeits- und die instinktive Intelligenz (Coren 1995).
Eine eigene „Hundepsychologie“ hat sich auch in der deutschsprachigen Literatur als ein Teilbereich der von Lorenz begründeten Vergleichenden Verhaltensforschung (Ethologie) etabliert (vgl. Feddersen-Petersen 1989). In ihr wird jedoch der Hauptfehler der alten Tierpsychologie, die naive Vermenschlichung des Hundes, vermieden, aber trotzdem der unleugbaren Tatsache Rechnung getragen, dass zwischen Mensch und Hund sich eine Vertrautheit entwickeln kann, die es unmöglich macht, diese Tiere rein objektiv zu betrachten (vgl. Hediger 1980).