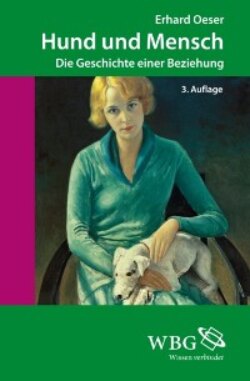Читать книгу Hund und Mensch - Erhard Oeser - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Maschinentheorie der Tiere
ОглавлениеDescartes Ansicht von der Seelen- oder Geistlosigkeit der Tiere beruht auf der Kombination verschiedener ganz unterschiedlicher Argumentationen. Das eine und für ihn wichtigere und grundlegendere Argument ist ein theologisches Argument, das für ihn gleich nach dem Argument gegen die Leugnung der Existenz Gottes kommt. So sagt er am Ende des 5. Kapitels seiner Abhandlung über die Methode: „Denn nach dem Irrtum der Gottesleugnung, den ich oben hinlänglich widerlegt zu haben meine, gibt es keinen der schwache Gemüter mehr vom rechten Wege der Tugend entfernt, als wenn sie sich einbilden, die Seele der Tiere sei mit der unsrigen wesensgleich und wir hätten daher nach diesem eben nichts zu fürchten noch zu hoffen, nicht mehr als die Fliegen und die Ameisen“ (Descartes 1948, S. 139). Die Einzigartigkeit der Menschenseele, die er mit dem unausgedehnten Geist oder der denkenden Substanz (res cogitans) gleichsetzt, besteht aber nach Descartes gerade in ihrer Unabhängigkeit von der Materie oder ausgedehnten Substanz, die für ihn eine Garantie für ihre Unsterblichkeit ist.
Das andere und bis heute wirksame Argument stammt aus seiner mechanistischen Physiologie, die er auch konsequent auf den Menschen angewendet hat. Sie beruht auf den damaligen großen Erfolgen der klassischen Grundlagendisziplin der neuzeitlichen Physik, der Mechanik, die sich bereits in eine Vielzahl von Maschinen umsetzen ließ. Eine beliebte Beschäftigung in dieser Zeit war das Herstellen von menschen- und tierähnlichen Automaten, die oft zu einer täuschenden Ähnlichkeit mit lebendigen Körpern führten. Daher glaubte Descartes zeigen zu können, „dass, wenn es solche Maschinen gäbe, welche die Organe und die äußere Gestalt eines Affen oder irgendeines anderen vernunftlosen Tieres (animal sans raison) hätten, wir nicht im Stande sein würden, sie in irgendetwas von jenen Tieren zu unterscheiden“ (Descartes 1948, S. 131). Dagegen haben wir, wenn es dem Menschen ähnliche Maschinen gäbe, die unsere Handlungen nachahmen könnten, stets ein ganz sicheres Mittel, um zu erkennen, dass diese Automaten nicht wirkliche Menschen sind. Denn selbst dann, wenn die Maschine so eingerichtet ist, dass sie Wörter hervorbringt oder schreit, dass man ihr wehtue, wenn man sie anfasst, so wird sie doch nie imstande sein, „dass sie auf verschiedene Art die Worte ordnet“, um eine sinnvolle, der jeweiligen Situation entsprechende Aussage zu formulieren. Das Gleiche gilt für jene Handlungen, die nicht auf besonderen Dispositionen der Organe beruhen. Während eine Maschine für jede besondere Handlung eine besondere Disposition eines bestimmten Organs benötigt, kann der Mensch mit seinem „Universalinstrument“ der Vernunft in allen Fällen und Lebenslagen die entsprechenden Handlungen durchführen.
Das eigentliche Unterscheidungskriterium zwischen Mensch und Tier ist und bleibt für Descartes daher die Sprache: „Denn es ist sehr bemerkenswert“, sagt er, „dass es keine so stumpfsinnigen und dummen Menschen gibt, sogar die unsinnigen nicht ausgenommen, die nicht fähig wären, verschiedene Worte zusammen zu ordnen und daraus eine Rede zu bilden, wodurch sie ihre Gedanken verständlich machen; wogegen es kein anderes noch so vollkommen und noch so glücklich veranlagtes Tier gibt, das etwas Ähnliches tut“ (Descartes 1948, S. 133 f.). Diese Unfähigkeit, in geordneter Weise zu reden, beruht nicht auf der mangelhaften Beschaffenheit der Sprechorgane, denn man sieht, dass Papageien, nach Descartes übrigens auch die Spechte (les pies), ebenso gut Wörter hervorbringen können wie wir. Und doch können sie nicht ebenso gut wie wir reden, d. h. „zugleich erkennen lassen, dass sie denken, was sie sagen“. Umgekehrt können sich sehr wohl auch taubstumm geborene Menschen durch Zeichen verständlich machen. Das alles beweist nach Descartes nicht nur, „dass die Tiere weniger Vernunft als die Menschen, sondern dass sie gar keine haben“ (Descartes 1948, S. 135). Auch die Tatsache, dass manche Tiere in manchen Handlungen mehr Geschicklichkeit zeigen als wir, beweist nicht, dass sie Geist (l’esprit) haben, sondern nur, „dass es die Natur ist, die in ihnen nach der Disposition ihrer Organe handelt. So sieht man, dass ein Uhrwerk, das bloß aus Rädern unserer Klugheit besteht, die Stunden zählen und die Zeit messen kann“ (Descartes 1948, S. 137).
Diese Maschinentheorie der Tiere wird auch von Malebranche aufgegriffen, der behauptete: „Tiere fressen ohne Vergnügen, weinen ohne Schmerz, handeln ohne es zu wissen; sie ersehnen nichts, fürchten nichts, wissen nichts“ (Zit. nach Coren 1995, S. 94). Sogar die Tatsache, dass sich Tiere an manche Dinge erinnern können und allerlei Fertigkeiten erlangen können, ist für ihn kein Grund an ihrer Seelenlosigkeit zu zweifeln, denn das zeigt nur, dass „eine bloße Maschine sich weit leichter bewegt, wenn man sie einige Zeit bereits gebraucht hat, als wenn sie ganz neu wäre“ (Malebranche 1776, S. 223 f.). Aus dieser Vorstellung von der Maschinennatur der Tiere erklärt sich auch die viel zitierte Grausamkeit dieses frommen Ordensmannes, der seine „Untersuchungen über die Wahrheit“ nicht so sehr zur Ehre des menschlichen Geistes, sondern zur Ehre Gottes verfasste. Nach glaubhaftem Bericht des Sekretärs der Pariser Akademie der Wissenschaften Bernard Le Bovier de Fontenelle soll Malebranche einer trächtigen Hündin einen Fußtritt versetzt und den entsetzten Beobachter, der auf den Schmerzensschrei des Hundes reagierte, mit den Worten „Wissen Sie denn nicht, dass er nichts empfindet?“ zu beruhigen versucht haben.
Malebranche hat sogar eine Theorie bereit, nach der sich auch das Mitleid gegenüber Tieren auch bei jenen erklären lässt, welche die Tiere nur für Maschinen halten. Denn der Anblick von Wunden und Tod eines anderen Lebewesens erweckt in den entsprechenden Körperteilen eine entsprechende Erschütterung. Jedoch gilt dies nicht für „starke und muntere Menschen“, sondern nur für schwache und zart gebaute, die es weder sehen können, dass man ein Tier schlägt, noch hören, wenn es schreit, ohne merklich beunruhigt zu werden“ (Malebranche 1776, S. 231).
Solche „starken und munteren Menschen“ waren es auch, die sich, gerechtfertigt durch diese Maschinentheorie der Tiere, daranmachten, stellvertretend an ihnen durch grausame Experimente die Maschinerie des beseelten Körpers des Menschen zu untersuchen, der für solche Experimente aus moralischen Gründen nicht zugänglich war. Alle bisher rätselhaften Vorgänge im menschlichen Körper wie der Blutkreislauf und die Tätigkeit des Nervensystems wurden durch Vivisektionen an Tieren erforscht. Und es waren vor allem die Artgenossen des von Malebranche malträtierten Tieres, die Hunde, die dazu benützt wurden. Um Harveys umstrittene Theorie des Blutkreislaufes zu beweisen, band der Holländer Jan de Wale im linken Bein eines Hundes die Oberschenkelvene ab, wodurch sich die herznahen, oberhalb der Abschnürung liegenden Teile entleerten. Nur wenige Blutstropfen traten heraus, wenn man dort die Vene verletzte. Dagegen spritzte unterhalb der Abschnürung das Blut, das zum Herzen zurückströmte, in hohem Bogen heraus, wenn man diesen Teil der Vene durch einen Stich verletzte. Schnürte man aber den rechten Oberschenkel mit den Arterien ein, ohne jedoch die Venen mit einzubinden, versiegte in ihnen der Blutstrom gänzlich. Damit war eindeutig bewiesen, dass das Blut einen Kreislauf durchführt, der vom Herzen ausgehend das Blut durch eine stoßende Bewegung durch die Arterien wegführt und durch die Venen wieder zum Herzen zurückführt.
Abb. 1: Jan de Wales Experiment an einem Hund zur Demonstration des Blutkreislaufes (aus Bartholinus 1660)
Sogar der große Hirnanatom Thomas Willis (1621–1675), der ja selbst im Unterschied zu Descartes den Tieren eine sensitive Seele und damit auch Leidensfähigkeit zubilligte (vgl. Oeser 2002, S. 66), scheute nicht davor zurück, Vivisektionen durchzuführen. Und wiederum waren die Hunde die bevorzugten Versuchstiere. So unterband er bei der experimentellen Erforschung des vegetativen Nervensystems einem Hund beide Vagusnerven, um herauszufinden, ob der Herzschlag so sehr von der Tätigkeit dieser Nerven abhänge, dass er ohne diese überhaupt aufhöre. Tatsächlich wurde der Hund sofort stumm und starr, erlitt Krämpfe und starkes Herzzittern und lebte nur noch wenige Tage, ohne sich bewegen oder fressen zu können (Cerebri Anatome 24. Kap., S. 324 f.).
Es waren aber gerade solche oft wiederholten grausamen Vivisektionen an einem Hund, die den bedeutendsten Kopf der französischen Aufklärung, Voltaire (1694–1778), ein bis heute gültiges Argument dafür lieferten, dass auch Tiere ähnlich wie Menschen Gefühle haben müssen: „Sie nageln ihn auf einen Tisch und öffnen bei lebendigem Leibe seine Bauchhöhle, um Euch einen Blick auf die Innereien zu bieten. Ihr entdeckt in ihm die gleichen, zum Fühlen befähigenden Organe, die auch Ihr besitzt. Antwortet mir, Ihr Maschinentheoretiker, hat die Natur dieses Tier mit allen Quellen des Fühlens ausgestattet, damit es nicht zu fühlen vermag? Besitzt es Nerven, um ohne jede Erregung zu sein?“ (Voltaire 1786, S. 258 f.).
Einer der ersten, der Einwände gegen diese Maschinentheorie der Tiere erhob, war jedoch Descartes’ Zeitgenosse Pierre Gassendi (1592–1655). Für ihn ist es nicht einzusehen, warum Sinneswahrnehmung und das, was man „Leidenschaften der Seele“ (passiones animae) nennt, bei den Tieren anders zustande kommt als bei uns. Denn auch in den Tieren gibt es Nerven und ein Gehirn und im Gehirn ein erkennendes Prinzip, das wie beim Menschen die Empfindung zustande bringt. Und wenn für Descartes das Wesen menschlicher Erkenntnis darin besteht, dass es hinter den stets wechselnden äußeren Erscheinungen den eigentlichen Erkenntnisgegenstand erfassen kann, so urteilt auch der Hund nach Gassendis Meinung auf ähnliche Weise: Mag sein Herr stehen, sitzen, liegen, sich zurücklehnen, zusammenkauern oder ausstrecken, er erkennt doch immer den Herrn, der hinter all diesen Erscheinungsformen steckt (vgl. Oeser 2002, S. 57).
Es ist nicht nur Gegenstandserkenntnis als solche, die Gassendi dem Hund damit zubilligt, sondern auch das, was heutzutage als Objektkonstanz bezeichnet wird. Denn er fragt Descartes: „Und so oft ein Hund einen laufenden Hasen jagt und ihn zuerst unversehrt, dann tot und hernach abgezogen und in Stücke zerlegt sieht, glaubst Du, er meint nicht, dass es immer derselbe Hase sei?“ (Gassendi in Descartes 1965, S. 248). Gibt man das zu, dann liegt der Schluss nahe, dass auch in den Tieren, vor allem in den so genannten höheren Tieren, die ein Gehirn besitzen, auch ein den Menschen „nicht unähnlicher Geist“ wohnt. Daher gibt es auch beim Hund so etwas wie eine freie Wahlentscheidung zwischen Ausüben oder Unterlassen einer Handlung. Denn es kommt doch vor, dass ein Hund bisweilen ohne alle Furcht vor Drohungen und Schlägen auf den Bissen, den er sieht, losspringt, wie der Mensch oft Ähnliches tut.
Wenn aber Descartes sagt, dass ein Hund nur bellt und nicht spricht und sogar ein Irrer mehrere Worte verbinden kann, um etwas auszudrücken, was auch das klügste Tier nicht kann, so antwortet Gassendi darauf, dass Hunde zwar keine menschlichen Laute hervorbringen, weil sie eben keine Menschen sind, aber doch ihre eigenen besonderen Laute hervorbringen und sich ihrer genauso bedienen wie wir uns der unsrigen. Daher ist es auch nicht recht und billig, von den Tieren menschliche Stimmen zu verlangen, ohne auf ihre eigenen zu achten. Ungeachtet dieses berechtigten Einwandes hat man jedoch immer wieder versucht, Hunden die menschliche Sprache beizubringen.