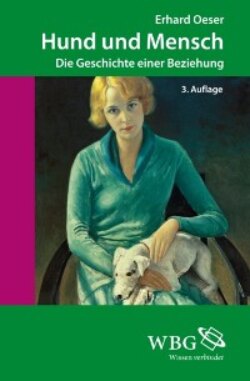Читать книгу Hund und Mensch - Erhard Oeser - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Dilemma der modernen Verhaltensforschung
ОглавлениеDie Entlarvung der lesenden und rechnenden Hunde und Pferde hat sich ohne Zweifel auch hemmend auf die Entwicklung der evolutionär begründeten Verhaltensforschung ausgewirkt. Denn fast alle ihre Vertreter hatten unter der für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts typischen Auffassung gearbeitet, wonach die Fragen nach dem subjektiven oder geistig-seelischen Erleben in die Rumpelkammer des Nichtwissenschaftlichen verwiesen waren (Griffin 1990, S. 76). Und auch heute spukt noch immer der „kalte und modrige Geist von Jacques Loeb“ herum, wenn tierisches Verhalten einzig und allein in den Begriffen von Reizen, Reaktionen und Anpassungsvorteilen beschrieben wird.
Auch dann, wenn Verhaltensforscher Begriffe wie „Wählen“ oder „Entscheiden“ verwenden, dementieren sie, dass mit dieser Sprechweise auch bewusstes Denken gemeint ist. So leitete J. R. Krebs seine Arbeit über „Entscheidungsregeln für Raubtiere“ (1978, S. 23) für optimale Futterbeschaffung mit folgenden Worten ein: „Es ist zu beachten, dass ich nicht beabsichtige, mit den Wörtern ‚Entscheidung‘ und ‚Wahl‘ in irgendeiner Weise auf bewusste Gedanken hinzuweisen. Sie stehen vielmehr als Abkürzungen für die Aussage, dass das Tier darauf angelegt ist, gewisse Regeln zu befolgen“ (Krebs 1978, S. 23). Solche einschränkenden Widerrufe werden von Griffin nicht zu Unrecht als „Schutzmäntelchen für die wissenschaftliche Respektabilität“ eines Autors bezeichnet.
Die Erklärung, dass das spontane „Pfötchengeben“ als Milchtritt zu verstehen ist, oder die Unterordnung gegenüber dem „Alphatier“ des Rudels sind wissenschaftlich begründete Ansichten, die bereits in fast alle populärwissenschaftlichen Hundebücher eingegangen sind. Auf diese Weise wurden zwar auch viele unberechtigte Vermenschlichungen und sentimentale Gefühlsduseleien über das Verhalten der Hunde beseitigt. Doch es bedeutet eine auch wissenschaftlich nicht zu rechtfertigende Simplifikation, wenn man auch das komplexeste und differenzierteste Verhalten und jede Art von Gefühlsäußerungen der Hunde auf einfache genetisch bedingte „Instinkthandlungen“ reduziert: Zum Beispiel, wenn man das Schwanzwedeln nicht als Ausdruck der Freude oder Erwartung, sondern nur als das vom Wolf übernommene Zufächeln der analen Eigendüfte an den Rudelführer betrachtet. Manche behavioristisch gesinnte Verhaltensforscher gehen so weit zu behaupten, dass kein Hund seinen Herrn liebe, sondern dieser nur Ersatz für den „Alpharüden“ in der Wolfsmeute sei (vgl. Gebhart 1978, S. 59). Neuere Untersuchungen (Mech 1999) zeigen vielmehr, dass die Verwendung des Ausdruckes „Alpha“ für die höchste Rangposition in einem frei lebenden Wolfsrudel keine zusätzliche Information liefert, sondern fälschlicherweise auf eine starre, auf Zwang basierende Dominanzhierarchie hinweist, die man eigentlich nur bei Wölfen in Gefangenschaft beobachtet hat. Die sozialen Interaktionen zwischen den Mitgliedern natürlicher Wolfsrudel sind dagegen viel ruhiger und friedlicher. Das typische frei lebende Wolfsrudel ist eine Familie, in der die erwachsenen Elterntiere die Aktivitäten der Gruppe über ein System der Arbeitsteilung anführen, wobei das Weibchen für die Betreuung und Verteidigung der Welpen sorgt, während das Männchen das Futter auftreibt. Überhaupt sind die differenzierten Leistungen einzelner Individuen bekannter Hunderassen keineswegs nur als das Verhalten von neotänen, d. h. ewig jugendlich gebliebenen Wolfswelpen zu verstehen. Der Hund ist eben nicht nur ein wild lebender Canide, den die natürliche Auslese hervorgebracht hat, sondern auch ein Kulturwesen sozusagen zweiter Art, das auch seine eigenen Geschichte hat.
Sogar Konrad Lorenz, der weder das Bewusstsein und noch weniger die Gefühle von Tieren geleugnet, sondern beide in seinem populären Hundebuch in unübertrefflicher Weise dargestellt hat, ist in seinen wissenschaftlichen Abhandlungen äußerst zurückhaltend. In seiner Abhandlung aus dem Jahre 1963 gab er auf die Frage „Haben Tiere ein subjektives Erleben?“ die Antwort: „Wenn ich darauf antworten könnte, hätte ich das Leib-Seele-Problem gelöst.“ Obwohl er der Überzeugung war, „dass ein höheres Tier, etwa ein Hund, ein Erleben hat“, darf nach seiner ausdrücklichen Meinung dieser Glauben nicht in die Formulierungen der wissenschaftlichen Verhaltensforschung eingehen, was er an folgendem Beispiel erläutert: „Wenn ich mit einer zahmen Wildgans spazierengehe und diese Gans streckt sich plötzlich, macht einen langen Hals und stößt einen leise schnarchenden Warnlaut aus, dann sage ich vielleicht: ‚Jetzt ist sie erschrocken.‘ Diese subjektive Kurzfassung besagt aber nur, dass ich weiß, die Gans hat einen Flucht auslösenden Reiz empfangen, und nach Gesetzlichkeiten der Reizsummation sind jetzt ihre Schwellenwerte für andere, ebenfalls Flucht auslösende Reizsituationen stark herabgesetzt“ (Lorenz 1974, S. 360).
Während Lorenz selbst die Fragen nach dem subjektiven Erleben der Tiere im Sinne der wissenschaftlichen Verhaltensforschung und ihrer verobjektivierenden Terminologie für unbeantwortbar und psychisches Geschehen als „grundsätzlich alogisch“ bezeichnet, hat sich neuerdings auch bei seinen engsten Mitarbeitern, zumindest was die Frage des Bewusstseins der Tiere betrifft, eine andere Haltung in der wissenschaftlichen Behandlung dieses Begriffes durchgesetzt. So beantwortet Wolfgang Schleidt die Frage „Dürfen, können oder müssen wir Bewusstsein bei Nicht-Menschen als wissenschaftliches Konzept annehmen?“ dreimal mit Ja (Schleidt 1992, S. 327).
Die Annahme, dass nicht nur der Mensch, Homo sapiens, sondern auch Tiere Bewusstsein haben, ist nicht nur mit der Evolutionstheorie verträglich, sondern auch eine logische Konsequenz des Grundprinzips der Evolution, das seit Darwin bekannt ist, der Anpassung an die Umwelt durch Selektion. Doch diese Anpassung des Verhaltens ist niemals vollkommen. Denn die natürliche Umwelt und insbesondere das Nahrungsangebot bleibt keineswegs immer konstant. Vielmehr stellt die Natur die Tiere oft vor komplexe Anforderungen, denen sie am besten mit einem Verhalten begegnen, das rasch wachsenden Umständen angepasst werden kann. Dabei schwanken die Umweltbedingungen und noch mehr die Situationen und Zustände der sozialen Mitwelt, die sowohl von den Artgenossen als auch von Fressfeinden oder Beutetieren hervorgerufen werden, so sehr, dass das Gehirn eines Tieres Instruktionen von einer unvorstellbaren Menge enthalten müsste, um programmierte Vorschriften für optimales Verhalten in allen Lebenslagen zu haben (Griffin 1990, S. 61).
Zwar ist es bei gekonnten Bewegungen eines Tieres durchaus plausibel, anzunehmen, dass sein Verhalten leistungsfähiger ist, wenn es automatisch abläuft und nicht durch bewusstes Denken verkompliziert oder gar gestört wird. Das gilt auch für den Menschen: „Um durch rauhes Gelände oder dichte Vegetation zu gehen, ist ein ausgewogenes Zusammenspiel gegensätzlicher Muskelgruppen nötig. Gehirn und Rückenmark verändern die Aktionen der Muskeln, je nachdem ob der Boden ansteigt oder abfällt oder ob der Bewuchs nachgibt oder nicht, wenn wir darüber steigen“ (Griffin 1990, S. 62). Auch jene mentalistisch eingestellten Verhaltensforscher wie Griffin geben zwar zu, dass dieser Vorgang, falls er überhaupt bewusstes Denken erfordern sollte, sicher nur in einem sehr geringen Maß vom Bewusstsein begleitet ist.
Aber ähnlich wie wir bei dem Aneignen oder Erlernen von neuen Fähigkeiten in neuen Situationen und Umweltbedingungen alle Einzelheiten sorgfältig und bewusst beachten müssen, erscheint es einleuchtend, dass einem Tier, welches neuen und schwierigen Anforderungen gegenübersteht, bei denen es um Leben oder Tod geht, bewusstes Denken und Abwägen echte Vorteile bietet. So haben Wölfe, denen Fallen gestellt worden sind, eindrucksvolle Leistungen vollbracht, die ohne eine Art des einsichtigen Handelns gar nicht möglich sein können. Sie haben nicht nur die Fallen erkannt, sondern sie konnten diese manchmal sogar unschädlich machen. Die große Vorsicht, mit der Wölfe und Füchse Fallen umgehen oder unwirksam machen, erklärt sich dadurch, dass sie sich keine Fehler leisten können. Ein Wolf oder Fuchs, der einmal in einer Falle einen Fehler begangen hat, indem er den Fangmechanismus ausgelöst hat, macht diesen Fehler in seinem Leben kein zweites Mal mehr. Wölfe, die nachts beobachtet wurden, zeichnen sich durch geradezu minutiöse Absicherungen aus: „Sie machen nicht einen Schritt, ohne genau zu erkunden, wohin sie die Pfote setzen. Ihre Bewegungen erfolgen im Zeitlupentempo. Nur entlang der Wege, die sie bereits gegangen waren, rannten sie unruhig auf und ab, gingen immer wieder zurück, um sich dann wieder langsam vorwärts zu tasten. Es kann Stunden dauern, bis sie auch nur einen Meter vorangekommen sind, wobei das Ganze durch längere Ruheperioden unterbrochen wird, wenn das Tier nicht überhaupt sein Vorhaben aufgibt und vielleicht erst ein paar Nächte später wiederkommt“ (Zimen 1989, S. 305).
Schon auf diesem Niveau der sensomotorischen Intelligenz zeigt sich, dass Bewusstsein eine notwendige Eigenschaft von Lebewesen ist, die schnell und sicher auf veränderte oder unbekannte Umweltbedingungen und Situationen reagieren müssen, um zu überleben. Daher muss das Bewusstsein bei Menschen und bei Tieren in sehr früher Zeit entstanden sein.