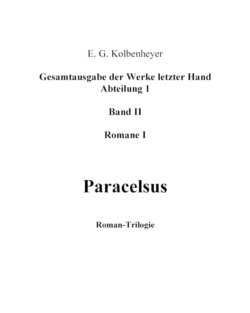Читать книгу Paracelsus - Erwin Guido Kolbenheyer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die große Göttin
ОглавлениеEls Ochsnerin war zwei Tage vor dem Feste mit aller Arbeit soweit gekommen, daß sie Mann und Kind in die fernhinschauende Giebelkammer des Pilgerspitals einholen konnte. Die meisten Gottshausfrauen, die unter ihrer Aufsicht gefront hatten, waren entlassen worden. Sie saß am Abend dieses letzten schweren Tages blaß, abgemagert daheim, erwartete Bombast von Willerszell her. Sie war allein und sprach dem Krüglein Milch nur mäßig zu.
Die Fenster standen offen. Mit dem kühleren Hauch drangen in den herdwarmen Gadem die Stimmen einiger Krämer herein, die am Tische vor dem Ochsnerhause eine letzte Rast gemacht hatten, um Erkundigungen einzuziehen und die vom Paßwege erschöpften Tiere ein wenig stehen zu lassen. Der alte Ochsner wußte, wohin er die Gäste zu weisen hatte. Er stand an der Teufelsbruck auf einem Posten, es gingen ihm von Einsiedeln her die Winke zu. Er gab seinen Rat bedachtsam, als müsse er sich für die oftgestellte Frage jeweils besinnen. Das ehrte den Gast und schuf Vertrauen.
Theophrast huschte im Hause umher. Er schleppte einen Brotbeutel hochgeknotet am Hals und füllte ihn mit den nützlichsten Dingen für den Auszug.
Er kannte den Weg hinüber, aber seine wahre Länge hatte er erst im Frühjahr ausgemessen, als sieden schwarzen Änderle henkten. Da war er zum erstenmal auf eigenen Sohlen bis auf den Galgenberg vorgedrungen, und zwar allein.
Der Änderle hing am Galgen, machte große Augen und streckte die Zunge heraus. Die Augen starrten auf zwei Raben, die ober dem Änderle auf dem Riegelholz saßen und, da sie sich von dem glasigen Blick immerhin getroffen fühlten, vorsichtig bald mit dem einen bald mit dem andern Auge herunterfunkelten. Theophrast suchte einen flachen Stein, der gut durch die Luft pfiff, und hätte den einen Raben fast getroffen. Die schwarzen Vögel schwangen fort gegen das Stift zu und krächzten. Theophrast bekams mit dem Gewissen: am Ende hatte er die heiligen Raben des St. Meinrad erschmeißen wollen, sie strichen zur Gnadenmutter hinüber und würden es nicht verschweigen. Der Änderle sah zum Querbaum hinauf und bleckte die Zunge, obwohl die Raben fort waren. Das war unheimlich, wenn er auch sonst ruhig hing.
Theophrast setzte sich an den Straßenrand dem Gehenkten gegenüber. Nach Einsiedeln blieb ein gutes Stück. Dort hätte er den Götti besuchen können. Doch der mochte ihn nicht, und er mochte den fetten Götti ebensowenig. Der brodelte immer aus seinem schleimigen Hals: „Frästli, daß Gott erbarm, bist als ein dürftigs Büebli und hast kein Heiligen nit.“ – Zum Götti wärs aber näher gewesen als heim. Theophrast sah immer wieder zurück. Haus und Teufelsbruck hatte der Erdboden verschlungen, sie lagen in der Schlucht. Hätte die Mutter ihn am Tage vorher mitgenommen und nicht eingesperrt, als sie den Änderle henkten, so hätte er nicht auf eigene Faust gehen müssen. Und es war kaum des weiten Weges wert. Er hing ganz still, sah den neuen Balken an, bleckte dabei die Zunge, und seine Hände waren hinter dem Rücken zusammengebunden. Er hätte höchstens mit den Füßen stoßen können. – Und vor ihm haben sie alle Angst gehabt, nur der Theophrast nicht. Er hat den Änderle gut gekannt, denn er hat weitum alle Vogelnester gewußt. Sie haben ihn geprügelt, weil er einmal mit dem Änderle im Borzerwald war und das Kiebitzei von ihm genommen hat. Seit der Zeit ist es schwer gewesen, Freundschaft zu halten. Alles mußte verschwiegen bleiben. Und der Änderle konnte erzählen, wie weit er über allen Bergen gewesen war. Jetzt aber mußte er bleiben, konnte nichts mehr als die Augen verdrehen und die Zunge blecken. Seine Füße hingen einer über dem andern, als seien sie über Schnee gelaufen und frören. Theophrast stand auf und ging unter den Galgen, um zu fühlen, ob des Änderle Füße wirklich so kalt seien, wie er tat. Er streckte sich, aber erlangte sie nicht. Da kam ein Klosterknecht mit Pferd und Karren den Weg vom Stift her. Er kannte das Kind und nahm es auf dem Karren mit.
„Der Änderle ist min Fründ gsi“, erklärte Theophrast, während er in dem rüttelnden Karren stand und sich festhielt. „Und er ist über alle Berg gewest, nu aber hanget er und hat kalte Füeß.“
So wußte Theophrast, wie weit es eigentlich nach Einsiedeln sei, wenn einer nicht reiten noch fahren konnte, darum auch wollte er sich und die Seinen für alle Fälle versehen. Es wurde der Brotsack voller und die Sorge des Theophrast leichter.
Zwei Nägel und vier Knöpfe lagen zu unterst im Sack. Ein Ballen Hanf, weil nur ein kurzer Strick aufzutreiben war. Ein Stück Tuch, wenn Hose oder Ärmel ein Loch bekämen. Ein Strumpf, zu dem der Zwilling fehlte. Eine Glasscherbe, mit der man Aufgeharschtes von Tisch und Bank kratzen konnte, daß die Mutter beim Scheuern eine Erleichterung fände. Eine Schelle, mit der er läuten wollte, wenn er die Mutter im Gedränge verlor. Der Plappart, den ihm der Götti zu hl. drei König geschenkt hatte, um Schafbock beim Lebzelter, Lichter für die Gnadenmutter, wächserne Arme und Beine, vielleicht auch einen jungen Maulesel für den Vater zu kaufen, denn das Schwabenjörgeli war schon alt. Aber auch für alle Fälle ein tüchtiger Keil Brot und ein Stück Käse: es konnte etwa alles Brot in Einsiedeln ausgehen, dann wollte er mit dem seinen der Mutter und dem Vater beistehen und sich recht als einen vorsichtigen Mann erweisen. Er hatte die Nahrung für diesen Zweck längst beiseite gebracht. Überdies führten auch die Pilgeri Brot und Käse in ihren Säcken mit. Dazu kamen noch fünf Nüsse, ein blaues Band, so lang, daß es zweimal um seinen Bauch ging, ein Bogen Druckwerk aus irgendwelchem Buche, den hatte Theophrast unter einem der Gasttische gefunden, und wer weiß, was für wichtige Dinge darauf standen. Dann noch ein Stück Kette, das einen Übeltäter fesseln konnte, wenn einer sich an Vater oder Mutter vergriff. Die Läufe waren ungetreu. Etliche Hutzelbirnen. Und jenes bunte Seidentüchlein, das ihm von der Mutter nach langem Für und Wider geschenkt worden war, als der Vater ihr zwei schöne, neue aus Zürich mitgebracht hatte.
Mit dem Brotsack schleppte sich Theophrast seit frühem Morgen und fuhr alle Winkel aus, um nichts zu vergessen, was den Seinen von unberechenbarem Nutzen sein konnte. Ein leises Fieber befiehl ihn, als er endlich das Schwabenjörgeli an der Krippe vor der Tür fand und wußte, daß der Vater von Willerzell zurück sei. Sie mußten fort. Er brauchte nur noch sein Schwert umzubinden.
Das Schwert lag im Gadem unter der Ofenbank. Der Marx hatte es aus Eschenholz geschnitzt. Die Schneide war mit Eichengalle schwarz gefärbt, Griff und Bügel mit Zwiebelschale goldbraun. Das Schwert schnitt den dicksten Schierling glatt durch.
Im Gadem saßen Vater und Mutter. Die Mutter lehnte an des Vaters Schulter und hielt die Augen geschlossen. Aber der Vater sah unwillig drein. Theophrast hörte noch:
„… ist Ohnrecht an uns, bist ausgeronnen, und du bist min und des Buben, sunst niemands.“
„Ist dannocht min Hoimat, Bombast, und ich müesset vergohn“, flüsterte Eis.
„Sie händ es nit vergessen; ich bleib der Schwöb, und steh ich gleich im Einsiedeler Dienst. Nu flackerts am Bodensee und Rhein, sie sänd von Tag zu Tag mehr in den alten Zorn verbissen. Balde so brennend sie – und blüetend. Dann wird min Heimat bespien und min Bluot von aller Bosheit geschmächt.“
„Du bist hie wohlgelitten, Bombast, und ich müesset vergohn.“
Theophrast sah nicht gern, wenn Vater und Mutter beisammen saßen. Eine ungewisse Scheu bedrängte ihn dann. So oft er konnte, trennte er sie. Beide liebte er, doch den Vater anders als die Mutter. Er vermochte nicht diese Liebe zu vereinen.
Lag die Mutter zärtlich hingegeben an des Vaters Brust, wie in diesem Augenblicke, dann glaubte er eine entwürdigende Schwäche zu beobachten. Liebkoste Hohenheim seine Frau, empfand er deutlicher: der Vater stellt sich bloß. Er litt es, und ein sanfter Frieden erfüllte ihn, wenn beide Eltern ihm mit streichelnder Hand begegneten. Aber das sah er nicht. Hätte ers gesehen und nicht nur gefühlt, er würde ihre Liebe vielleicht trotzig abgewehrt haben. Nicht Eifersucht trieb ihn zwischen Vater und Mutter, wenn beide einander umfingen. Das augenfällige Zeichen ihrer Liebe befremdete ihn bis zum Unwillen. Er wußte nicht, daß sie selber mehr fühlten als sahen, wenn sie zärtlich zueinander waren. Und der andere schlummernde Grund blieb, daß er beide anders liebte. Er schied das Wesen des Mannes von dem der Frau ahnungsvoll.
Noch fühlte und wußte er von dem Bande nichts, das beide unlöslich umschlingt.
Was tut der Mann solch heimlicher Wirrnis gegenüber? Er zieht das Schwert und zerhaut die Knoten. Theophrast drängte sich mit erhobenem Schwerte zwischen Vater und Mutter.
Er sagte: „Nu müessend wir reisen.“
Sie wollten ihm den wohlgefüllten Brotsack abnehmen, aber er wußte seinen Willen mit Glück durchzusetzen. Der Großvater hob ihn vor die Mutter auf das Schwabenjörgeli, das unmutig über die neue Last die Ohren zurücklegte. Es hatte schon vom Stallfrieden geträumt und von wohligem Dösen und leisem Schwanken auf allen Vieren mit dämmernden Augen, vollem Magen und hangendem Kopf. Es mußte nun wieder auf Knüppel und Stein acht haben; war auch die Last geringer, der Abend lag schon in allen Gliedern. Doch kostete es nur die ersten paar widerwilligen Schritte. Dann reckten sich die Ohren wieder vor. Es galt die Teufelsbruck. Und hatte sie das Schwabenjörgeli auch hundertmal überschritten, ihr Brausen blieb ewig unheimlich. Man mußte auf alles gefaßt sein.
Hohenheim ging schweigend neben dem Tier her, das Frau und Söhnlein trug, er hielt die Zügel. Theophrast sah über den Bergen das matte Grün des Abendhimmels, ein kühner Stern durchzitterte es. Das Herz des Kindes zitterte erwartungsvoll mit dem Gestirn.
Und in die Freude seines Erlebens fiel bald eine fremde Bangigkeit. Er hatte einen ganzen Tag lang fröhlich Abschied genommen, nun aber wußte er immer deutlicher mit jedem neuen Stern, der durch das ermattende Licht brach, daß viel zurückgeblieben war, was nie in seinen Brotbeutel gegangen wäre.
Er fragte die Mutter leise:
„Warzu müessend wir fort?“
„Wir gohnt uf die Engelwih.“
„Werdend die Engel ze Einsiedeln sin?“
„Die sänd allerweg.“
„Warzu als müessend wir fort?“
„Weil die Gnadenkapell ze Einsiedeln stoht, und die ist von den Engeln gewicht. An der Tüfelsbruck stoht aber kein Gnadenkapell nit.“
„Als werdend wir die Engel ze Einsiedeln sehn?“
„Das wird nit sin. Die Engelwih, do sie herniedergestiegen, ist ehedem vollbracht und uf ünser Zit nit meh.“
„Hats einer ehedem gsehn?“
„Es muoß so sin, dann sunst wissend wirs nit.“
„Was hat derselbig gsehn?“
„Wo ünser heilig Meinrad ist von denen Mörderen beiden erschlahen, hänt sie ünser lieben Frouen ze Einsiedeln Altar und Kapell ufgericht, und war alles bereit, daß man sie wihet. Und ist der Bischof ankummen, viel Pfaffen gohnt mit ihme und Münch, die wollend sie wihen uf den morgenden Tag. In der Nacht ist der liebe Gott vom Himmel gefahrn unde für denselbigen Altar und hat ehender das heilig Amt und die heilig Meß vollbracht. Er hat ein veigelfarben Meßgewand angehät. Sant Matthei, Sant Marx, Sant Lux und Sant Johann satzeten ihm, als die heiligen Evangelisten all vier, sin Inful uf das Houpt und nahmens wieder ab. Und beschach ihm alls wie dem Bischof, so er die Gnadenkapell am morgenden Tag gewihet hätt. Die Engel sänd all kummen und hänt gülden Rochfässer mit, facheten die Gluet mit ihrer Fittich Schlag, daß es rauschet. Bi dem lieben Gott gstund Sant Greger und hielt den Wadei, brauchet kein Becken nit, dann der Wadei tropfet us ihme selbs von dem himmelschen Wichwasser. Sant Peter hielt den Stab, Sant Augustin und also Sant Ambrosi gstunden bi dem lieben Gott. Die heilig Jungfrau aber schwebet über dem Altar. Es ist us ihrem gülden Gewand ein Licht usbrochen als wie der Blitz, wenn es umb Mitternacht wettert. Und sungen die Engel all, denen ist Sant Michel Fürsinger gsi. Geschähe alles, als sunst bi der Wihen. Und es brauset die Orgel von der Heiligen Hand gerührt. Sant Christofei aber hat den Balg treten mit aller Kraft, dann der ist der stärkist unter den Heiligen und hat ehedem das heilig Kind samen der Welt durchs Wasser tragen.“
Theophrast lehnte an der Brust seiner Mutter, die beide Arme um ihn geschlungen hatte. Er sah unter gerunzelten Brauen in die Sterne.
„Sänd die Engel all darbi gewest, Mammeli?“
„Sie warend all darbi, darumb heißt es die Engelwih.“
„Wer gstund dann bi denen Kinderen in derselbigen Nacht? Brauchet ein jeds zwölf Engel. Und sänd all uf Einsiedeln gewest.“
„Vor die Nacht hat ihnen der liebe Gott Urloub geben.“
„Das war nit guet von ihm. Es kunnt eins us dem Bettli fallen.“
„Was der liebe Gott tuet, ist guet, Frästeli. Do darf keiner nit fragen.“
„Warumb nit?“
„Weils der liebe Gott ist.“
Theophrast schwieg. Er konnte nicht weiter. Aber in seiner Brust glühte ein Zweifel, wenn er auch keinen Laut fand. Er war verstummt, doch nicht gestillt; und er wußte nicht, was ungestillt blieb.
Hätte er das verhaltene Lächeln seines Vaters gesehen, vielleicht wäre er entbunden worden. Jenes Lächeln, das ihn so heftig reizte, weil es offenbar Erinnerung an Zweifel, Kämpfe, Siege und Niederlagen der Großen verhehlte. Dieses Lächeln sagte ihm: ich bin wie du gewesen, aber ich bin damit fertig geworden. Und unfertig zu gelten, trotz heißer Mühe und Schaffensnot, das quälte ihn mehr als die Großen begriffen.
Doch Theophrast merkte das verhaltene Lächeln seines Vaters nicht, das zwischen Freude und Bitterkeit hing. Er sah den dunklen Himmel mit seinen hellen Sternen, fühlte die Arme der Mutter, das sanfte Wehen ihres Atems – er vergaß die kaum bewußte Bedrängnis, wie die sinkende Welle ihren Schwung vergißt.
Sie kamen an. Die Lichter der steilen Gasse freuten Theophrast. Er hatte noch nie leuchtende Fensterreihen gesehen.
Vor den Toren am Straßenrande standen Wagen und Karren, die meisten von Linnenblachen auf Holzreifen überspannt. Durch manches Wagendach schimmerte Laternenschein.
Auch vor dem Tor des Pilgerspitals stand ein Wagen mit weitem Wetterdach, das bunt bemalt war und von einem Maste überragt wurde, der ein Fähnlein trug. Theophrast sah unter dem hellen Halbrund etliche Leute kauern. Ein Mann trat dicht an die schaukelnde Zugwaage, er reichte einen Krug, dann Brot und Speck hinauf. Die Leute sprachen sehr laut, sie lachten, Theophrast verstand sie nicht.
Seine Mutter drängte, aber er bettelte, die Gasse zu sehen; da beschied Herr Wilhelm die Frau ins Haus und nahm das Söhnlein an di e Hand.
Weit hinauf sahen sie flimmernde Lichter über den Weg tanzen. Aus den Toren, wenn sie da und dort geöffnet wurden, brach wie ein lauter Ruf der Schein. Die Stimmen der Männer und Frauen schwirrten wunderlich durch die Dunkelheit.
Auf der Höhe des Weges lag ein Klumpen Finsternis und reckte zwei ungeheure scharfgespitzte Zähne in den mattdurchschimmerten Himmel.
Theophrast umklammerte die führende Hand. Er kannte die Nacht groß und schweigend, vom ruhevollen Brausen der Sihl erfüllt. Hier fand er sie von unruhigen Lichtern und Stimmen angerührt. Obgleich er voll Neugier und Staunen das fremde Leben aufnahm, beklemmte es ihn.
Er fragte leise: „Was gangend die all nit schlafen?“
„Die werden auch schlafen, die habend viel vor. Dann diese Täg sollen die Beutel ründen. Es seind die mehristen Kramervolk und fahrend Lüt. Die wollend wohlversehen sin.“
Weiter oben standen leere Bretterbuden in mehreren Zeilen dicht gedrängt. Bei ihnen lagen, unordentlich, verschlossene Kisten. Vor den Mauern des Stifts plätscherte der vielstrahlige Frauenbrunnen, dessen Mündungen nach dem Feste von Pilgerlippen blankgescheuert sein werden. Die meisten Waller werden aus allen Rohren trinken, um auch an dem einen heiligen Strahl die Lippen zu netzen, von dem der Heiland getrunken hat, da die Gnadenkapelle geweiht wurde.
Das Stift lag lautlos hinter den Mauern, seine Dächer ruhten unter dem mächtigen Schatten der Basilika, die das Heiligtum der Gnadenkapelle barg. Die beiden kühngehelmten Türme verstärkten das drohende Schweigen.
Theophrast schlief diese Nacht unruhig, er träumte:
Der finstere Kirchenkörper wächst höher als die Mythen, wächst und schwillt. Sprengt die Klostermauern. Zerknittert Bretterbuden. Malmt Häuser nieder, löscht ihre Fensterreihen und alle Strahlenbüschel der offenen Hausfluren unter lautlos stürzenden Wänden aus. Vertilgt die kleinen Lichter, die über die Straße tanzen. Die Räder unter den erleuchteten Blachen rollen eilig die Straße herab. Das Ungeheuer quillt schneller, bäumt sich an einer Bodenwelle, stößt, wirft, zermalmt die Wagen im Räderwirbeln. Kein Laut, kein Licht. Theophrast fühlt nur, wie der Schatten wächst und schwillt.
Am andern Morgen war Herr Wilhelm hastig ins Kloster gerufen worden. Ein Züricher Münzknecht hatte einem andern das Messer in den Leib gerannt. Frau Eis huschte noch vor Tags die vielen Treppen des hochgiebligen Hauses hinunter: das Pilgerhospital erwartete seinen Teil an Klostergästen zu früher Stunde. So blieb Theophrast allein in der Giebelkammer, von der man jenseits des Brühls das Türmlein der St. Gangolfkapelle und den Galgen sehen konnte. Er wußte, der Galgen stand leer. Der Änderle war abgefallen.
Von der Straße herauf schwärmte das Stimmengewirr, raunte das erste Pilgerlied derer, die in der Nacht schon aufgebrochen waren, um über das Fest einen sicheren Unterschlupf zu erlangen. Und mit dem ersten Wallerkreuz und Fähnlein, das dem Türmer sichtbar wurde, begann die Predigtglocke ihr winkendes Geläute. Sie sollte an diesem Tage kaum verstummen.
Theophrast gürtete sein gutes Schwert um, entleerte den Brotsack bis auf den Plappart und die Schelle, ehe er ihn umnahm, kletterte die finsteren Treppen hinunter. Das Neue und Bunte auf eigene Faust zu bestehen.
Den bemalten Wagen mit seinem Mast und Fähnlein fand er nicht mehr. Auch alles andere Fuhrwerk hatte seinen Nächtigungsplatz geräumt. Die Gasse war von Fußgängern, Reitern, Handkarren lebhaft durchströmt, ein größeres Gefährt drang nur langsam, unter lautem Geschrei des Lenkers durch.
Mit der Terzenglocke sollte der Wechsel des Klosters aufgetan werden. Ihm liefen die Kaufleute und Landesfremden zu. Es war untersagt und wurde scharf gehütet, Wallfahrtszeichen, Druckwerk, Kerzen und wächserne Weihbilder einzuführen, alles mußte aus dem Zeichenamt und von den Kerzenbänken des Klosters erstanden sein. Beide Kaufstellen gehörten zum Wechsel, wo auch die einzige Geldbank aufgeschlagen war. Wer sein Geld eingetauscht und seine Warenkisten gefüllt hatte, konnte in Ruhe die Bretterbude ausstatten und die ersten Käufer locken. Doch viele Krämer trugen noch das Kaufgeld vom gestrigen Tage her im Säckel, und es brannte ihnen, als hätten sie es gestohlen. Überdies war mit sinkender Nacht ein großer Nachschub eingetroffen.
Sie drängten mit ihren leeren Säcken und Koffern vor dem geschlossenen Tor, stießen einander, fluchten, schlugen zu und gaben der geharnischten Wache zu schaffen. Herr Diebold hatte geboten, daß nicht mehr als je ein Dutzend zugleich eingelassen würde.
Die Pilger waren bald zurückgeschoben, das fremde Geld sollte warten, bis die Krämer ihre Waren hatten. Wer eher mit vollem Sack und Pack kam, erlangte die bessere Bude. Es gab etliche, die einen Platz näher dem bewachten Tore zu erkaufen strebten; andere vereinbarten nach Art des Fußvolkes, das von Reiterei bedrängt wird, einen „Igel“ zu schließen und eng umschlungen, in gesammelter Wucht, durch die Vordermänner zu brechen, wenn es galt. Sie stellten sich zurecht, wurden durchschaut und dichter umlagert, man machte Miene, sie fortzuschieben, aber der Nachdrang war zu stark. Die Köpfe wurden röter, die Augen drohender, die Mäuler standen voll Schaum und platzten von Flüchen, die Finger zerrten an dem, was sie zu halten hatten, jede freie Hand war geballt, und die Ellbogen arbeiteten. Ein Schimpf und Knuff zählte nicht, sie hörten und fühlten drüber hinweg. Bisweilen sammelte sich die Ungeduld an einem Ruf. Der hinderliche Nebenmann wurde Genosse; sie brüllten einmütig: Uftun! Uf! Terzzit!“ Dann wurde der Schwarm dichter und schob einen Fuß breit vor, die Ordner wurden an das Tor gepreßt.
„Räudigs Kuttenvolk! Versoffen Plattenhengst! Schmeißet das Nönnle usm Bett! Ufton!“
Sie paukten mit den Stiefeln gegen das Holz. Die beiden verlorenen Ordner brüllten und schwuren allen die fallend Sucht, den hitzigen Ritt und die Franzosen in den Leib.
Endlich fiel die helle Stimme der Zeitglocke. Das Menschenknäuel verstummte, schwankte ein wenig zurück, als hole es aus. Die Riegelbalken scharrten an der Tür und fielen. Der Haufe brach ein. Die Ordner waren machtlos. Aber Herr Diebold hatte sich etlicher fester Hände versehen. Die packten und warfen, was da wie Kriegsfurie den Wechsel stürmte, auf gut schwyzer Art gegen Mensch und Mauer.
Und mit dem Schmerzgeheul aus einem Dutzend Kehlen war der wilde Eifer geschlichtet. Man zählte alle Glieder nach, die heil aus der Presse gekommen waren, fand den Schmerz der geprellten Stürmer gerecht, lobte die ordnende Gewalt, tat vor den Geldwechslern freundlich und bescheiden, um doch einen oder den andern verrufenen Schinderling unterzubringen. Man täuschte sich, versuchte vor der Kerzenbank und im Zeichenamt noch einmal sein Glück mit dem falschen Gelde, wurde übel angeblasen und ließ für diesmal allen Profit dem Kloster der lieben Frau und Ernährerin unbenagt. Im Hintergründe klafften die Eisentruhen und fletschten ihre Riegel. Neben jeder Eisenkiste standen zwei Klosterknechte, die kurze, blitzende Schwyzeraxt in der Faust.
***
In Gottes Namen fahren wir,
Siner Gnaden geren wir.
Nu helfe uns die Gotteskraft,
Der reinen Ilgen Mutterschaft.
Christ uns genade!
Kyrileis!
Die Heiligen all helfend uns!
Nah und fern entwuchs der eintönige, uralte Gesang den Staubwolken der Pilgerstraßen. Ein Kreuz zog voraus. Der Heiland hing grell bemalt daran, zuweilen blinkte sein Leib golden oder silbern in der Sonne, immer hielt er den Kopf sterbensmüde zur Brust geneigt, und es schien, als glitte sein lidverhangener Blick traurig über den Weg hin, den er getragen wurde.
Waren die dunklen Menschenzüge auf die Höhen des Etzel, des Schnabelbergs, des Haggenecks und Katzenstricks gekommen, flackerten sie auf wie von neuem Leben. Sie hielten, knieten nieder und winkten der Lilie in Dornen, der Rose im Himmelstau, dem Zederbaum ohne Wurm in hundertjährigen Gesängen und Gebeten zu.
Dort sahen sie das Heil vor Augen: von Türmen geschützt, in Geläute gehüllt, die breite Basilika, die den engelgeweihten Gnadenhort beschirmte. Die Träger entrollten das Fahnentuch, zuweilen kostbare Stoffe, deren Flammenspitzen von schweren Goldquasten gestreckt wurden. Auf dem Fahnenblatte blühten in bunten Farben die Namenssymbole Christi und Marias, die Gestalt eines Märtyrers, einer Heiligen. Der graue Zug hob sich, froh der ragenden Türme und winkenden Glocken. Bald, bald war die Buße in all der schweren Pilgrimsnot getan.
Seit Wochen schluckten sie Staub oder froren in durchnäßten Mänteln, während der Morast der Straße das Schuhwerk beschwerte und erweichte. Aus den Niederlanden, von der Ostsee, über die Vogesen, die Alpen, von der Donau her drangen sie durch Unrast der Tage und Unbill der Nächte, starrend vor Schweiß und Schmutz, übel verlaust, auf wunden Sohlen, von Bast zu Rast stumpfer und müder. Sie sahen nicht mehr die Lieblichkeit der oberdeutschen Länder und nicht die fürstlichen Berge; ihr Gehör war am ewiggleichen Tonfall der Gesänge und Gebete stumpf geworden. Das Gewissensfeuer, das sie aufgejagt hatte, schlug nicht mehr lechzend gen Himmel, sein Qualm kroch auf den Niederungen der Landstraße, erstickte und beklemmte die Herzen. Der helle Freiheitsschrei ihrer Seelen war ein dumpfes Stöhnen nach Gnade und Erlösung aus aller Erbärmlichkeit geworden. Die Sünde hatte ihre jagende Kraft verloren, sie blieb ein schleichendes, gemeines, willensfremdes Übel. Die Körper waren ausgeronnen, der Mut hing an den müden Schritten und matten Stimmen der anderen, die mitzogen, die längst nicht mehr von Haus und Arbeit sprachen, sich längst nicht mehr umsahen, nur das schwebende Kreuz oder die gleitende Landstraße im Blick hielten, heiser sangen und murmelten.
Aber dort im Tale, von Engeln geweiht und unzähligen Gebeten seit Menschengedenken angehaucht, sprudelte der Gnadenquell. Das weite Hochtal war von seinem Segen fühlbar erfüllt. Die Pilger tauchten von den Paßhöhen nieder wie in einen heiligen See.
Was sonst ließ ihre Herzen laut werden, ihre Augen aufflackern? Was konnte ihnen sonst mit wundersamer Erquickung die gemarterten Glieder durchstrahlen?
Neu brannten die Sünden. Sie hatten Blut vergossen, Ehe gebrochen, gestohlen, betrogen, den Nachbar verlästert und vernichtet. Brandstifter, Schlemmer, Hurer, Verräter, Meineidige und die Feigen, deren Schuld ein Leben lang läßlich blieb, aber beklemmend wurde, da die Kräfte sanken. Alle, die durch Geld, Verwandtschaft und Macht geschützt, dem Rechte der Welt entschlüpft waren, vereint mit den Frommen, Armen und Demütigen im Geiste und auch mit jenen Bußlüsternen und Geilen im Staube, sie alle durchglühte der erste Taumel der Gnade. Der Brand der Sünden wärmte mehr, als er sengte. Er verklärte das Bußwerk der wochenlangen Entbehrung zum Verdienste. Je tiefer der Sünder stand, desto schwerer glaubte er gelitten zu haben.
Die Erbsen und Steine in ihren Schuhen trugen und jämmerlich nachgehumpelt waren, versuchten nicht mehr auf dem Fußrande oder der Ferse zu gehen, um dem stechenden Wundschmerze zu entrinnen. Sie traten fester auf und verzerrten ihre Gesichter zwischen Qual und Lachen. Da sie das Ziel vor Augen hatten, schauerte Wollust durch ihr Leiden. Eine Stunde noch! Sie schrien die ewig gleichen Verse, und die andern hoben ihre Stimme mit ihnen.
Zurück blieben, die gelobt hatten, den letzten Weg angesichts des Heils auf den Knien zu überwinden. Sie gürteten den dunklen Pilgerhabit hoch auf die Brust und entblößten die Knie. Sie ließen den Rosenkranz perlen, weil sie nicht mehr im Takte singen konnten, auch nicht beisammen blieben.
Die anderen gingen schnell. Es gab ihrer, die wie Trunkene vorwärtstaumelten, um sich auf den Boden zu werfen, wenn sie den Vorsprung eines Ave Maria gewonnen glaubten, den Staub zu küssen und zu beten, bis die Brüder nachgekommen waren. Je lauter die Glocken wurden, desto höher brannten ihre Wangen, der Schweiß der Erschöpfung floß von ihren Stirnen.
Im Orte stießen sie mit anderen Pilgerzügen zusammen und mündeten in den großen Strom, der aufwärts zu den weiten Toren zog, aus deren Dunkel es hundertfältig blinkte und aus denen, je näher sie drangen, es rauschte und brauste wie stürzende Wässer.
Sie sangen nicht mehr. Sie schwangen die Pilgerstäbe und Rosenkränze dem Eingang entgegen, lallten, jauchzten den Namen der Gottesmutter, beschworen sie um das Gnadenwunder, ächzten ihr alle Mühsal und Schmerzen entgegen, die sie auf weiten Straßen hingenommen und hergeschleppt hatten.
Ein Keil von Ordnern war von der Kirchenmitte in die Flut vorgebaut worden und brach die Wucht, schob die Andringenden zum linken Tore, drängte die Ausströmenden von dem rechten Tore weiter, wenn es not tat, mit kräftigen Partisanenstößen. Man wußte, daß die Ohren taub, die Augen geblendet, die übermüdeten Leiber stumpf waren.
Und sie kamen nahe. Die Knie zitterten. Den meisten wars, als müßten sie über den Stufen zusammenbrechen, ehe sie noch die Gnadenreiche gesehen hätten.
Dann umschlug sie der heiße, düstere Dunst, weihrauchgesättigt, vom Qualm der unzähligen Lichter verdichtet. Ein Schleier lag vor ihren Augen, sie meinten mit den Händen weitertasten zu müssen. Um sie her schallte es, keinem Sturm vergleichbar, unbändiger als alle Laute, die sie je vernommen hatten. Sie schrien, um ihre eigenen Stimmen zu hören, um sich am eigenen Schrei wiederzufinden. Eines jeden Lebensgefühl drohte zu zerschellen, aufgelöst in dem zersprühenden Bewußtsein der anderen, willenlos, hingerissen, vernichtet und erhöht.
So wußten sie nicht mehr, daß sie weitertrieben. Nur an dem stechenden Schmerz ihrer Kehlen fühlten sie, daß es aus ihnen verlaute.
Und sie sahen, wie die Seitenwand der Gnadenkapelle zurückwich. Jedem erschiens, als offenbare sich das Geheimnis für ihn allein.
Silberglanz, Goldgarben, zahllos zitternde Flämmlein. Inmitten: ein Mantel, gepanzert von Gold, Perlen, Steinen, er glich einer Glocke. Ein Schleier, der, faltenlos gefroren vor Kostbarkeit, vom goldbelasteten Scheitel bis zum Mantelsaum starrte. An der Krone glimmte es kalt und funkelte. Unter der Krone: ein rosiges, lebloses Antlitz. Die kleinen Schlitzaugen von hochmütigen Brauenbögen überglitten, eng aneinandergeschoben, halb verschleiert, jenseits von Liebe und Erbarmen. Das Mündlein mit den üppigen Lippen, satt, gleichgültig geschlossen. Das runde, willenlose Kinn glänzte wie eine große Perle. Augen, Mund, Kinn waren so eng an die lange, dünne Nase gerückt, daß die Wangen der Gesichtsscheibe fetter erschienen. Die Stirn schimmerte glatt, gedankenlos. An den Ohren glitzerten Gehängebüschel. Der kurze Hals war vom Geschmeide gedrosselt.
Das Kindlein hing an der linken Schulter des Bildes in einer Mantelglocke von gleicher Üppigkeit, sein winziges, feistes Köpflein war unbeweglich zwischen Krone und Halsschmuck eingezwängt.
Die rechte Hand des Bildes war von Juwelen, Ketten und Bändern bedeckt, sie hielt ein schlankes Zepter. Zwischen ihr und der Mantelglocke des Kindes sprühte ein großes, loderndes Diamantenherz die Farben des Regenbogens.
Die Augen gingen über, klärten sich und verschwammen. Keiner hatte je solch lastenden Reichtum gesehen. Sie wagten kaum zu blinzeln. Da sie näher und näher trieben, verstummten sie. Der heiße Qualm genügte den Lungen kaum. Sie ächzten aus offenen Lippen. Einigen schwand das Bewußtsein für die Zeit eines Herzensschlages. Sie konnten nicht sinken, sie verloren beinahe den Boden unter den Füßen, schwebten, da sie näher kamen. Die Hände zitterten auf der Brust. Keiner wagte zu flehen. Dumpf schwelte es in ihnen, sie müßten erhört sein. Niemand wußte, weshalb er vor diesen maßlosen Prunk getrieben wurde.
Erst in der Nähe der Gnadenkapelle, da die Harzwolken und der Dampf des Wachses unerträglich wurden, züngelte es durch ihr Bewußtsein: Gold, Edelstein, Perlen … opfern … auch ich …
Die Finger hasteten unter den Mantel in Koller und Mieder. Dort ruhte das Beutelchen mit dem Opferpfennig seit ihrem Auszug aus der Heimat auf dem Herzen.
Durch das brusthohe Gitter der Gnadenkapelle streckten die Opferstöcke ihre Trichter und schlürften ein. Es klapperte unaufhörlich.
Nicht jeder Pilger konnte zu seinen Münzen gelangen. Er warf dann irgend etwas über das Gitter: Hut, Paternoster, eine Kette, den Gürtel, seinen Ring. Zwei Knechte standen im Heiligtum zu beiden Seiten, sie gruben den stets wachsenden Haufen der Opfer von Zeit zu Zeit ab und ebneten ihn.
Etliche klammerten sich an das Gitter, um vor dem Unerhörten ein paar Atemzüge länger bestehen zu können. Auch war in einige beim Geklapper des Geldes ein kalter Strahl Ernüchterung gefallen. Sie vermuteten ein Recht auf eine demütige Bitte und wollten sich besinnen. Aber sie wurden fortgeschoben, ihre krallenden Finger rissen sich an den Stäben und Ranken, sie taumelten in den Wirbel zurück, der vor dem Heiligtum kreiste, ohne einen letzten Blick auf das Gnadenbild geworfen zu haben.
Unnahbar und starr hing das Bildnis, von tausendfältigem Schimmer überhuscht. Sein kalter Blick stand tot in der Dunkelheit und achtete der Menschen nicht. Das Bildnis schien zu lauschen. Das Wirrsal der Schreie, des Stöhnens, des Lallens und des unaufhörlichen Klapperns der Opferkästen schien es zu sättigen. Was vermochte die kälteste Herrschergeste eines Herrn der Welt gegen diese lauschende Ungerührtheit, gegen diese lauernde Sattheit!
Und gerade der Widerspruch einer hoffnungslosen Kälte, die durch den heißen Qualm, das Gedränge, Edelsteinsprühen, Goldflimmern, Lichterflirren gehoben wurde, mit der inbrünstigen Erwartung der Gnade, Milde, des sanftmütigen Erhörens überwältigte die Massen. Sie wagten ihre Kleinheit nicht mehr ans Ungeheure. Ihre Sünden zerrannen in ein klägliches Gerinnsel, das von einem einzigen Strahl des kleinsten Geschmeides der Unnahbaren aufgetrocknet wurde. Und sie waren alle durch Garben des Glanzes hindurchgeschritten!
Vor den Toren stürzte das Sonnenlicht lästig auf sie ein. Sie sammelten mühsam ihre Sinne, versuchten stehen zu bleiben, wurden weitergestoßen. Erst als der Schwarm sich lockerte, zwang sie ein fieberndes Unbehagen, nach den Fahrtgenossen Umschau zu halten. Sie suchten ihre Fahne und das Kreuz, dem sie gefolgt waren. Dann schleppten sie wortlos, in der gewohnten Reihenfolge dem Führer nach.
Erst an den Tischen oder auf dem Rasen bei Bier und Wein erwachten sie.
Noch vor der Mittagsstunde erwartete Einsiedeln den Legaten des Papstes. Seinetwegen war in der Abtei mancher Gänsekiel verschnitten worden. Diebold von Geroldseck hatte mit aller Linguistik auffahren und das Stift hatte jeden seiner Buchstaben mit einem Dukaten behängen müssen. Papst Alexander verweigerte länger einen besonderen Ablaß, als man trotz aller Kenntnis seiner Geldgier voraussetzte. Das römische Jubeljahr stand bevor, es durfte durch die Gnadenmutter zu Einsiedeln nicht geschmälert werden. Die Todsünden sollten zwei Jahre noch auf Zinsen liegen, dann gutgeprägt und vollwichtig der Kurie zurollen.
Nach eifrigem Bemühen des Mutterhauses – die Pilger erhofften ein sichtbares Zeichen von Petri Stuhl – wurde der Assistent des Papstes, Protonotar Onofrio de Nartia, durchgesetzt. Auch dieser nur, weil es die Kurie für nützlich hielt, zuverlässig zu erfahren, welcher Stimmung die Eidgenossen gegen Maximilian wären.
Alexander änderte seine Politik. Er hatte im Mai der Totenmesse seines Feindes von ehedem, weiland König Karls VIIL, in der Hauptkapelle zu St. Peter, von achtzehn Kardinälen umgeben, beigewohnt, dabei ein Gebet gesprochen und Absolution erteilt. Er wünschte seinen ältesten Sohn, den Kardinal Cesare Borgia, zu verehelichen und mußte dabei auf die Hilfe Ludwigs XIL bedacht sein.
Herr Diebold stand mit dem Allerheiligsten an der Biberbrücke. Der Damasthimmel wurde von acht Schwyzern in blanken Kürassen und Gewändern, die auf die Farben des Stifts gelb und schwarz geteilt waren, über ihn gehalten, und der Kranz von Kaplänen, Evangeliern und Epistlern umgab ihn. Es ruhte das Volk in weitem Ringe auf dem Rasen bei den aufgepflanzten Kreuzen und Fahnen.
Ein Ruf reckte alle auf. Sie sahen die erwartete Staubwolke und begannen zu singen. Der Legat sprang in angemessener Entfernung vom Pferde und eilte, nur von einem jungen Kleriker begleitet, in kurzen, hastigen Schritten dem Allerheiligsten entgegen. Sein Pluviale, das mit zierlichen Stickereien gesäumt war, wehte wie ein abgeflautes Segel, und die violetten Quasten seines Hutes schlugen ihm um die Schulter. Er leistete dem Allerheiligsten die Ehrenbezeugungen und erteilte nach allen Seiten hin den Segen.
Der Empfang kam unerwartet. Weil die Abtei für unwohnlich galt, war im „Weißen Wind“ sein Quartier ausbedungen worden. Er hatte-schon seiner Begleitung wegen-gewünscht, dorthin ohne Geleit zu gelangen. Allein die Nachricht, in der man alles Zeremoniell vorgesehen hatte, schien verloren gegangen zu sein. Herr Diebold war aus Rapperswil gegen Morgen hin verständigt worden, aber nicht vom Legaten, sondern vom Wirte des Nachtlagers. Eine Auseinandersetzung angesichts des Heiligtums wagte der Protonotar nicht, ebensowenig konnten die liturgischen Gewänder aus dem Wagen und den Koffern herbeigeschafft und übergeworfen werden.
So mußte der Legat, gestiefelt und gespornt, das letzte steile Wegstück unter die Füße nehmen und konnte überdies barhaupt hinter dem Himmel dreinschleppen. Es gelang ihm nur den Degen abzuschnallen. Herr Diebold winkte die Kapläne, Evangelier und Epistier dicht um den Legaten her, der sich trotz aller Sonnenglut fest ins Pluviale wickelte. Die Meßschellen übertönten sein Sporenklirren. Er preßte die Lippen zornbebend gegen die gefalteten Hände und machte durchaus den Eindruck eines gottesfürchtigen Mannes.
Die Pilger drängten mit Kreuz und Fahne Zug um Zug nach. Sie hatten das Mißgeschick des Legaten nicht gesehen. Nur die Letzten konnten bemerken, daß aus dem Gefolgswagen zwei Frauenzimmer sprangen, die geschäftig an eine Sänfte traten und in ihrer lauten, schnellen Sprache auf eine Person einredeten, deren silbernes Gelächter durch alle Schleier drang. Das Gefolge hatte den Befehl erhalten zu warten. Auch etliche Pilger der letzten Schar schienen an dem Segen des päpstlichen Gesandten vorläufig genugsam erquickt. Sie beschlossen, aus dem Zug zu treten und im Schatten, abseits der Straße, zu lagern.
Dort säumten sie nicht lange ungesättigt. Kaum hatte sich der Staub gelegt, entschlüpfte der Sänfte eine Dame, die in ein weitfaltiges Gewand von dunkelblauer Seide gehüllt war. Ihr wurde ein roter Hut aufgesetzt, dessen Krämpe tief über den Nacken fiel. Sie sprach und lachte ungebührlich laut. Sie deutete lebhaft auf den Zug und dann zum Waldesrand hinüber. Zwei Diener schleppten einen Teppich in den Schatten, und Frauenzimmer folgten mit Körben.
Die bewegliche Dame warf sich auf den Teppich, und ihr bauschiges Gewand umfloß sie weit. Sie schleuderte den Hut in den Rasen, tastete über ihr blauschwarzes Haar, das sie mit kostbaren Bändern aufgebunden trug. Man richtete ihr aus den Körben an. Den ergötzten Pilgern, die unweit saßen und kaum zu reden wagten, lief das Wasser im Munde zusammen. Und wie sie schwatzte und lachte, den Dienern und Mägden etliche Bissen zuwarf, sich endlich auf den Rücken wälzte, die Arme hinter dem Kopf gekreuzt und die Beine keck überschlagen, während der lange Schnabel eines roten Schuhs aus den weichen Seidenwellen hervor in der Luft wippte – wußten die frommen Lauscher, daß die beschwerliche Reise des Gesandten nicht ohne Ergötzlichkeit überstanden war. Ein Tuchhändler hockte unter ihnen, er flüsterte eine Summe, die nur das Gewand der Dame betraf, aber manchen erschauern ließ.
Die Dame hieß Cursetta. Sie wäre im Frühling beinahe an der Tiberbrücke gehenkt worden. Ihr Geliebter, ein Maure, hatte öffentlich Frauenkleider getragen und sich den Namen Barbara beigelegt. Da die Cursetta des geschmeidigen Leibes und der Wildheit wegen zu den bekannteren Kurtisanen gehörte, fand man selbst in Rom das Verhältnis ärgerlich. Sie wurden beide eingezogen und zu einem Bußgang verurteilt, der die ganze Stadt auf die Straße lockte. Die Cursetta trug ein schwarzes Samtkleid, das ungegürtet von oben bis unten aufgeschlitzt war, und ihr Geliebter ging in Frauenkleidern neben ihr, doch hatte man ihm die Kittel bis unter die Brust aufgewunden. Der Protonotar begegnete dem johlenden Zug auf dem Parioneplatz, als er vom apostolischen Palaste nach dem Hause Massimi, dem Palais des Kardinals Carafa, ritt. Die Cursetta, vom Geschrei und den beizenden Worten der Frauen nicht weniger als von den gierigen Blicken der Männer gereizt, ließ die schwarzen Samtflügel flattern und zeigte, daß ihre Glieder des Aufsehens wert seien. Der Protonotar schätzte sie.
Man gab die Cursetta frei, den Mauren wollte man auf dem Campo dei Fiori verbrennen, doch verkohlten nur die Schenkel, da ein Platzregen den Scheiterhaufen löschte.
Immerhin regte die Cursetta die Wallfahrer zu allerlei erbaulichen Vermutungen an. Sie lockte über die flüsternden Lippen Histörchen und Vergleiche, die viel Verständnis entgegenbrachten. Doch dabei wurden die Pilger allmählich der belebenden Entdeckung Herr. Die Taubheit ihrer wegmüden Glieder begann sie an die Genossen zu mahnen. Sie erhoben sich ächzend und zogen steifbeinig in ihren dunklen Mänteln, unter den breitkrämpigen Hüten, gestützt auf die langen Pilgerstäbe, an der Cursetta vorüber zur Straße. Und wallten schweigend dem Orte des Heils zu, von woher die letzten Schallwellen der Hauptglocken drangen.
Der Legat betrat die Kirche. Er hatte von den Stufen aus, zwischen Fürstabt und Prior stehend, den Segen gegeben, und alles Volk lag tief gekrümmt auf den Knien. Er schritt in der Basilika durch die Menge der Kleriker, die, erstaunt über seine unerhörte Gewandung, aber gedemütigt durch seinen fast drohenden Blick, vor der Geste des Segens ehrfurchtsvoll zurückwich, den er auch hier mit hocherhobenen beiden Armen gab. Er sank am Gnadenaltar langsam in die Knie, ohne die erhobenen Hände zu senken. Erst als er mit geschlossenen Augen und unter murmelnden Lippen der Madonna sein unsichtbares Opfer eine Zeitlang dargereicht zu haben schien, küßte er den Altar und lag tief gebeugt in einem endlosen Gebete. Seine Andacht hielt die Kleriker im Zaum, man wagte kaum zu flüstern.
Als er sich dann erhob, war sein Gesicht eigentümlich verklärt. Er folgte unaufhörlich flüsternd dem Fürstabt und Prior, die das Allerheiligste zum Hauptaltare trugen. Und da es geborgen war, verkündigte er mit wohlklingender Stimme den besonderen Segen des Heiligen Vaters und den besonderen Ablaß, der in Rom nach schwerer Mühe und mit gutem Golde ausgewirkt worden war. Der Ablaß betraf Ehebruch mit geistlichen und weltlichen Personen. Der Protonotar ermahnte die Beichtväter und Prediger, jene Gläubigen, die von andern ungebüßten Todsünden beschwert seien, auf das Jubeljahr aller Christenheit zu vertrösten und sie nach Rom zu lenken, wo ihrer ein umfassender Ablaß harre.
Er schloß sein Latein: „Ihr wisset alle, ich komme gleichwohl nicht mit leeren Händen in dieses unserer geliebten Mutter Kirche keineswegs ungefährliche Land deutscher Nation. Der heilige Vater kennt jene ungewissen Strömungen halber und ganzer Häresie, die mit Gottes und der heiligen Jungfrau Beistand von unserem Eifer niedergehalten werden, so daß sie niemals an die Oberfläche zu gelangen vermöchten. Darum begleitet mich der besondere Segen des Vaters aller Christenheit für euch, ihr Hirten und Kämpfer, an Christi Statt gespendet. Und auch das nicht geringe Gnadengeschenk aus dem Schatze der Kirche zur Tilgung der heimlichsten Sünden unseres Fleisches begleitet mich. Waltet eures apostolischen Berufes nach Kräften!“
Er sprach mit ausgezeichnetem Vortrag und jener schwebenden Weisheit in der Stimme. Man vergaß seine Stiefel und Sporen; alle fühlten sich merkwürdig geeint und gestützt. Konrad von Rackeiberg würgte heimlich an einer Beklemmung, denn er wußte, daß bei dem Empfange irgend etwas verfehlt worden sei. Vor der Rede war der Fürstabt sicher gewesen, da er dem Legaten an Würde gleichstand.
Er lud nun in seinem zweifelhaften Latein den Protonotar zum Imbiß, allein dieser nickte unentschieden, als habe er nicht verstanden, und winkte seinem Kleriker, dem er italienisch etliche Aufträge für das Gefolge zuflüsterte. Dann lächelte er dem Fürstabt zu und erkundigte sich liebenswürdig nach dem, was man ihm mitteilen wolle. Konrad von Rackelberg wurde rot und stammelte neuerdings seine Einladung, während man dem Seitentor der Kirche zuschritt. Der Legat fragte, was da eigentlich genossen werden solle. Der Fürstabt wechselte die Farbe vor Zorn. Es entfuhr ihm: „Kotz Bocksbluet! Du bist unter dütschen Edellüten, was die eintuend, möcht dir als ouch nit din wallisch Ingeweid verkrümben!“
Der Protonotar lächelte und antwortete, daß er wohl nicht deutsch verstünde, aber hoffe, die Speisen, die seiner warteten, mögen weicher gekocht sein, als ihre Namen klängen.
Theophrast fand zur Mittagszeit wohlbehalten ins Pilgerspital zurück, und die Mutter teilte ihm Suppe und Brot zu, doch geschah es mit einer Hast, die das Kind verdroß. Er hatte so viel Fremdes gesehen, daß er nach beruhigenden Zeichen verlangte. Er wußte kaum, was alles ihn erstaunte; ebensowenig wie die Großen, wenn sie dem Unerhörten gegenüberstehen und der Welle hingegeben, die sie trägt, schreien, ohne zu wissen, was sie schreien, opfern, ohne zu wissen, wem sie opfern. Aber er hatte noch seine Hilfen, die ihm ein Erlebnis maßen: an den verwunderten oder gleichgültigen Mienen der Großen schlichtete er das Fremde. Waren die Mienen gleichgültig, so wußte er, daß er das Befremdende durchdringen müsse, um auch groß zu sein. Bestaunten die Großen ein Ereignis, so vergaß er es bald, denn es gehörte auch ihnen nicht, und er wollte nur das, aber all das, was den Großen zukam.
Die Küche war heiß, obwohl die Fensterläden offen standen. Pilger, Männer und Frauen, kamen und ließen in ihre Schüsseln aus dem Suppen- und Breikessel schöpfen. Die Mutter trat manchmal an ein Fenster, trocknete das gerötete Gesicht und saß einige Augenblicke nieder, während ihre Helferinnen an Herd und Tischen schwere Arbeit taten.
Theophrast kauerte auf einem Haufen von Decken, die in einem Winkel zusammengeworfen waren. Er wagte nicht recht zur Mutter zu gehen, weil er sah, daß sie sogleich aufsprang, wenn sich irgendeine Helferin an sie wandte. Er wußte auch, daß sie jetzt mehr zu den anderen gehörte.
Frau Eis mochte aber einen seiner Blicke verstanden haben. Als sie eine Zeit verschnauft hatte, ging sie zu ihm, nahm ihm das Schüsselchen ab und streichelte sein Haar.
„Host den Vater gsehn, Frästeli?“
„Alls ist voll Lüt, die lan ein nindert durch.“
„Gang nit in die Kirch! Sie möchtind dir ebbes anton.“
„Ich gang nit. – Mammeli, der Hans stoht bi dem Wechsel und hat ein’ griffen, der schrije sorglich, weil der Hans ihn hart für dem Bouch hat griffen und hat ihn gebütelet. Der Hans hat mir zuogewinkt. Do hänt die Lüt uf mich gsehn.“
„Was hast do in dinem Brotsäckli?“
„Nur vom Götti min Plappart.“
„Do wirst ihn vertuon.“
„Den werd ich wohl hüeten. – Sie sänd mit eim Dach gangen, Mammeli, und drunter ist der Herr Diebold gsi, hat ein gelen Mantel an, der glitzeret wie die Sunn. Er hat ein kleins, gels Hüsli tragen. Alle Lüt sänd uf die Erd gfalln, do hab ich drüber gsehn. Einer schrije zu mir: ,In d’ Knie, sunst frißt dich der Tüfel!“ Do fraget ich den leis: ,Ist es der Tüfel, den der Herr Diebold im Hüsli halt, daß er mich frißt?“ Do saget der Mann und hats Krüz geschlahen: ,Bi Gott, du bist ein verlorn Seel, so grün du bist, und touget ein Mühlstein umb dinen Hals, daß man dich ersoufet!“ Do bin ich ihme entloufen. Was hat der Herr Diebold in dem gelen Hüsli tragen?“
„Das ist nit bloß ein gels Hüsli, sundern ist gülden. Und drin steckt das Allerheiligest. Drumb müessend die Lüt vor ihme uf der Erd liegen.“
„Wie schouets us?“
„Es ist ünser Herr Jesus Christ.“
„Ist der als ring und verhützlet, daß er ins gülden Hüsli goht?“
„Er ist nit klein und nit groß. Er ist größer als all Ding und wohnet dannocht im Kleinisten.“
„Soll ichs gloubt der Frästeli nit.“
„Du mueßt glouben, Frästeli, sunst hat der Mann recht, und du kummst in die Höll.“
„Wo all brinnend, oder nur dort?“ Er zeigte auf die Ofenhölle.
„Wer nit gloubt, der kummt in die Höll, wo all brinnend uf all Zit, ist ein Hünen und Zähnklapperen.“
Theophrast sann nach, die Mutter aber beschloß:
„Du sollt nit umb Ding fragen, welich du nimmer verston könntest.“
„Unde du?“
„Ich gloub daran, und ist gnuog darbi.“
Da sah Theophrast hinüber, wo auf dem Wandbdrd etliche Äpfel lagen, die stachen ihm schon lang in die Augen. Er zog die Brauen zusammen, und Frau Eis wußte, daß eine schwere Frage im Zuge sei. Sie wollte entwischen, denn die Fragen ihres Söhnleins setzten ihr zuweilen hart zu. Er aber hielt sie und sah sie an, daß sie bleiben mußte. Langsam kam es ihm von den Lippen:
„Mammeli, mich hüngert.“
„Ich will dir ein Müesli geben.“
„Mammeli, mich hüngert nit nach eim Müesli, sundern nach Apfel.“
„Wen hüngert, der hat ein Müesli gern, ein Apfel ist nit vor den Hunger, sundern ein Glust.“
Die Antwort war dem Theophrast bekannt.
„Mammeli, mich hüngert arg nach ein’ Apfel.“
„Dann ist din Hunger Luog. So du das Müesli nit willt, hüngert dich nit meh. Und ein Luog verdient Hieb.“
„Ist kein Luog. Mich hüngert nach dem Apfel, und du gloubst mir nit. Du mueßt desglichen in die Höll, do all brinnend, Mammeli.“
„Das ist ein andrer Glouben, Theophrast“, sagte die Mutter unter Lachen und Ernst, denn sie erschrak darüber, daß sie von ihrem Kinde versucht worden war. „Ich will dir ein’ geben, so du willt folgen. So du willt knien und beten, wenn alle knien unde beten.“
Sie wartete aber das Versprechen nicht ab und brachte den Apfel. Er aß bedachtsam, während Wärme und Müdigkeit sanft in sein Blut sanken, so daß er mit dem halben Apfel in der Hand entschlief.
Am Nachmittag entdeckte Theophrast, wonach er schon in aller Frühe gesucht hatte, den Wagen mit dem buntbemalten Wetterdach und dem Fähnlein. Sie hatten den Wagen neben der Etzelstraße gegen die Gangolfkapelle geführt, wo es noch Raum gab. Der Wagen half einen runden Platz begrenzen, der mit hohen Stangen ausgesteckt war. Von Stange zu Stange hatten sie mannshohe Blachen gespannt. An den Lücken zwischen Holz und Zwilch lauerten Kinder. Auch Große blieben und warfen einen Blick in das Geheimnis. Man hörte Peitschenknallen, Rufe, Klappen und Klirren. Die lugenden Kinder schrien den andern zu, was sie sahen. Dann drängte der Schwarm dichter an die freigebige Lücke. Wurde das Stoßen des Zaunvolkes heftiger, daß die dünne Wand zitterte, fuhr ein wohlgezielter Peitschenhieb dagegen. Wer getroffen war, zog heulend ab.
Theophrast wartete geduldig auf einen Platz; er war klein, er konnte es nicht mit den Jungen wagen. Die an den Lücken hingen, wichen nur der Gewalt. Er drängte von der Seite näher. Der glückliche Mann an der Glunze beschrieb, nicht ohne boshaftes Pochen auf den Vorteil seines Platzes, die wunderbaren Ereignisse. Da erfuhr Theophrast, daß hinter der Blache im Kreise geritten wurde. Einer schleudert dem Reiter Zinnteller zu und der Reiter fing die Becken an einem Stabe. Ein Pudel sprang durch mehrere Reifen. Man warf mit Messern, ging auf Händen. Theophrast fühlte den Schwung des Pferdes deutlich, wenn es vorüberkam. Doch bald fiel das Pferd in ein kurzes Stampfen, und es wurde still. Zögernd löste sich der letzte Glückliche von der Lücke. Noch einige kleine Leute, die gleich Theophrast keinen Blick hatten tun dürfen, zwängten ihre Nasen zwischen Stange und Blache durch, um wenigstens den Platz der Begebenheit zu sehen. Aber sie waren bald befriedigt und zogen den anderen nach, die unweit auf dem kurzen Rasen des Brühls die Kunst mit Steinen, Mützen und Stöcken versuchten.
Theophrast blieb allein und hatte Muße. Nach einer Weile pflockte der schwarzhaarige Mann, der am Abend Speise und Trank in den erleuchteten Wagen gereicht hatte, als der noch vor dem Pilgerspital stand, einen Strang in den Boden, während ein Bursche zwei Lattenböcke herbeischleppte. Der Strang wurde über die Gabel des einen Bockes gespannt, dann über die des andern und endlich an einem zweiten Pflocke festgewunden. Der Mann pfiff, und aus dem Wagen antwortete eine feine Stimme irgend etwas, das Theophrast nicht verstand. Der Mann klatschte in die Hände, da lief ein kleines Mädchen in den Kreis. Ihr buschiges Rothaar wippte, wenn die schlanken, nackten Beine den Boden berührten. Das Kind war kaum älter als Theophrast. Es hielt seine Hände auf der Brust und sah bekümmert auf den Burschen, der das Seil noch festknüpfte. Der Mann zog eine Gerte aus dem Stiefelschafl und ließ sie pfeifen. Die Kleine vermochte ihr Unbehagen bei dieser Musik kaum zu verhehlen.
Dann war der Bursche fertig, wischte mit seinem Ärmel über die Stirn und faßte an einem Bocke unter dem Seil Stellung, während das Mädchen zögernd zu ihm ging und der Mann sein Instrument ungeduldig gegen den Stiefel klatschen ließ.
Hoppla! Die Kleine war von der Hand des Burschen auf das Seil gesprungen und lehnte in der Gabel des Bockes. Der Mann rief ihr ein Wort zu. Das Kind richtete sich auf, indem es beide Arme breitete und das Gleichgewicht mit kleinen Rucken des Oberkörpers zu erhalten strebte. Dann lief sie, die Augen starr in die gegenüberliegende Bockgabel gerichtet, hurtig über das Seil. Sie fing sich gerade noch am Holze.
Der Mann schrie hinauf und ließ die Gerte pfeifen. Die Kleine kauerte so, daß Theophrast in ihr Gesicht sehen konnte. Das Gesicht zuckte, aber die Lippen blieben fest. Nur die Augen standen ängstlich offen. Sie war nicht geschlagen worden, schien aber doch einen Hieb gefühlt zu haben. Theophrast wurde blaß wie das Mädchen. Sein Herz schlug. Er hatte einen Schrei verbissen, als die Peitsche ausfuhr. Zum erstenmal fühlte er, daß sein Herz schlug.
Das Mädchen lief zurück. Diesmal glücklicher, denn sie vermochte zu halten, mit einem Schwünge zu wenden und neu zu beginnen. Unter ihr tappte der Bursche immer mit. Doch sie mochte zu schnell laufen. Ihr Meister schalt heftig, indem er neben ihr herzottelte und mit der wippenden Gerte spielte, als wolle er die Füßchen mit kleinen Hieben hemmen.
Sie versuchte es langsamer. Der Bursche stellte sich bereit, denn das Mädchen warf Arme und Oberkörper verzweifelt nach rechts oder links, es spreizte das Bein ab und versuchte eine Zeitlang, den schwebenden Fuß wieder auf das Seil zu bringen. Dann fiel die Kleine, haschte das Seil, klammerte sich mit Händen und Beinen daran. Die Gerte biß zu. Das Mädchen ließ mit einem Schrei los und wurde von dem Burschen aufgefangen. Der Mann fluchte und drohte, sein Gesicht wurde rot. Das Kind stand vor ihm, die Augen geschlossen, weiß bis auf den vollen, kleinen Mund, der ein wenig klaffte. Inzwischen ging der Bursche wieder zu seinem Platz beim Bock. Hoppla! Die Kleine trippelte hin und schwang sich aufs Seil.
Theophrast ballte die Fäuste, er keuchte vor Anstrengung, denn er stand mit seinem ganzen Wesen der kleinen Tänzerin auf dem Seile bei. Mehrmals mußte sie von dem Burschen aufgefangen werden, und die Gerte biß noch mehrmals zu. Aber die Kleine weinte nicht. Dann gelang ihr doch die schwere Aufgabe. Sie tanzte ohne zu fallen, langsam und gleichmäßig hin und zurück. Ihr Meister schien zufrieden. Er klatschte kurz in die Hände, sie setzte sich in eine Bockgabel, strich ihre rote Wolle aus den Schläfen und lächelte befreit.
Der Bursche reichte ihr eine lange Stange. Sie griff rasch darnach und holte die Stange bis zur Mitte auf. Und alle Kunst schien gewonnen.
Sie tanzte vor- und rückwärts, blieb in der Mitte des Seiles stehen, kniete nieder und stand wieder auf, sprang, daß der Strang schwirrte, und fing ihn wieder mit den Sohlen so sicher, als fühle sie den treuen Boden der Wiese. Die Übung war bald beendet.
Sie ließ die Stange fallen, glitt am Seil nieder, hielt sich mit beiden Händen, schaukelte etliche Male hin und wieder, sprang leicht und schön ins Gras.
Theophrast war froh, doch seine Freude bedrängte ihn. Das Mädchen stand nahe und rieb einen brennenden Striemen, der ihr quer über die Wade lief. Theophrast dachte an die Salben seines Vaters. Sein Wunsch zu helfen war so heftig, daß er alle Scheu überwand, die Lücke weiterzerrte und rief:
„Maideli, kumm!“
Das Kind sah auf, witterte vorsichtig nach dem schwarzhaarigen Mann hin und huschte nach einer Weile bedachten Lauschens zwischen den Wagenrädern durch ins Freie.
Theophrast lief ihr entgegen und faßte ihre Hand.
„Kumm, der Laur hat dir weh ton. Min Vater hat ein guet Salben vor din Bein.“
Beide liefen, bis sie in Sicherheit waren. Die Kleine lächelte, schien aber ihren Freund nicht verstanden zu haben. Als er talab gegen das Spital wollte, blieb sie stehen und zeigte auf die Bretterbuden, durch deren Zeilen die Leute drängten.
„… Bockeli …“
„Was willtu, Maidli?“
„… kain Fennik? Du? Kauft Bockeli gutt, molto, serr gutt … Bockeli …“
Sie rieb den Bauch und kostete, als schmölze ihr etwas Delikates zwischen Gaumen und Zunge.
Theophrast lachte, er hatte gesehen, daß ihr Finger auf einen Lebzelterstand wies.
„Du willt kein Salben nit, aber Böckli schmeckend dir wohl!“
Er begriff nun auch, was sie unter Fennik meinte, und holte den Plappart aus seinem Brotsack. Die Kleine funkelte das Geld lüstern an und wollte es ihrem Ritter entreißen. Der aber hielt sein Gut fest.
„Du! Der Plappart ist kein Pfennig nit, sundern da gangend viel Haller drauf. Den hab ich vom Götti, der hat meh Geld als der Herr Kuonrad uf dem Stift.“
„… schön Fennik kauft serr gut Bockeli …“
„Der kaufet Schafbock und vor min Vater ein ander Jörgeli, dann der Schwabenjörgeli ist fast alt. Der hat uns hertragen uf Einsiedlen von der Tüfelsbruck und hinket mannigs Mal.“
Die Kleine ging ganz nahe an ihn heran und sah ihm scharf auf die Lippen. Sie hatte verstanden, daß er von den süßen, runden Honigkuchen sprach, die als Einsiedler Schafbock weitum bekannt waren, aber die Geschichte vom Schwabenjörgeli verstand sie nicht und fürchtete Ausflucht dahinter.
Sie faßte also die Hand, darin der Schatz lag, und zog den Plappart gegen eine Bude, auf deren Bank die süße Herde weidete.
Theophrast erstand zwei Böcklein, und da die Lebzeltnerin im Ochsnerhaus an der Teufelsbruck bekannt war, erhielt er auch seinen guten Rest an Hellern. Er nahm das Geld erstaunt, denn er hatte nun statt des einen Stückes eine Handvoll. Und die kleine Seiltänzerin blickte bewundernd auf die volle Hand. Sie kannte das Geld besser, sie sammelte mit dem Messingbecken ein. Viele süße Schafböcke glitten unerlöst in den Brotbeutel zurück.
Als nun Theophrast ihr den einen Honigkuchen reichte, lächelte sie zärtlich und führte den zierlichen Knix aus, mit dem sie zu danken pflegte, wenn eine Münze in das Sammelbecken klapperte. Das Büblein wurde rot vor Freude. Er reichte ihr rasch noch den andern Kuchen, und sie knixte wieder. Er vergaß die Großen ringsum, die spöttisch lachend auf das artige Paar sahen, und langte in seinen Sack, um mehr Böcklein für die kleine Seiltänzerin zu kaufen. Aber die Frau, der das geschmeidige Wesen nicht zu gefallen schien, fuhr ihn an:
„Nu gang! Das wallsch Gogelvolk hat gnuog!“
Einer meinte: „Der lässet bi guter Zit Haar.“
Etliche lachten laut. Ein feister Städter kniff der kleinen Tänzerin in die Wangen und brodelte über feuchte Lippen:
„Du Katz! Frißt Böckli gern, was? Willtu han, du Katz?“
Er versuchte sie zu streicheln, da entwischte die Kleine zwischen zwei Buden, und Theophrast stand allein.
Er kannte das breite Grinsen und die zwinkernden, verkniffenen Augen von den Tischen des Ochsnerhauses her, wenn dort die Männer und Frauen saßen und sich nach dem schweren Etzelweg gütlich taten. Es kam auch vor, daß ein fremder Mann an ihm seinen Witz probierte. Aber dann war das Lachen der andern redlicher. Jetzt bei der Bude mit den süßen Böcklein überkam ihn eine jähe Angst, als müsse er sein Gesicht vor den Larven verbergen, deren grinsende Mäuler und zwinkernde Augen ihn bedrängten. Es stieg ihm heiß und beklemmend auf. Er zog den Kopf ein, versteckte das Gesicht hinter einem Arm und schlich davon, als habe er etwas stehlen wollen und sei ertappt worden. Hinter den Buden begann er zu laufen. Er sah nicht rechts noch links und nahm den Arm erst vom Gesicht, als er bestimmt wußte, er werde von niemand mehr der Böcklein wegen angesehen.
Eines stand felsenfest, daß er nie wieder Böcklein kaufen wolle. Aber mit diesem Entschlüsse war sein Unfrieden nicht behoben. Er konnte nicht finden, was ihn bedrängte.
Die Kleine war verschwunden. Er suchte sie nicht. Es war gut, daß sie fortblieb. Die Leute hatten übel gelacht, die Frau im Böcklistande hatte ihn angefahren. Sollte die Kleine kein Böckli haben? Ihr war hart genug geschehen.
Theophrast ging langsam dem Pilgerspital zu. Er war bedrückt wie jeweils, wenn er nach Hause schlich, da er den Änderle heimlich im Walde getroffen hatte, obwohl ihm der Änderle verboten war.
Und er mußte an die kleine Seiltänzerin denken. Nur daß er immer weniger ihrer Hiebe und Not gedachte, sondern sie mit fliegendem Röcklein und wippendem Haar über das Seil springen sah. Wenn er die Kunst auch könnte! Ihm kam ein Lächeln der Freude über die Lippen, er erinnerte sich des zierlichen Dankes, da sie ihr Böcklein erhalten hatte und das seine dazu. Aber dann waren die Großen dazwischen gekommen. Durfte er nichts schenken? Durfte das Mägdlein nichts von ihm … das wars vielleicht. Nur für die Großen sollte sie freundlich sein.
Wenn er sie suchte, sie riefe und fragte, warum die Großen an ihr böse und häßlich würden? Es überkam ihn bei diesem Gedanken quälend, wie er es noch nie gefühlt hatte … nein, wie er vorhin erst gefühlt hatte, als die Großen lachten und er sein Gesicht verstecken mußte. Das war eine andere Angst, die nicht auf Prügel, zornige Worte und Mienen hinauslief, sondern ihn am eigenen Herzen verzagen ließ. Er wußte schließlich nur, daß er davongelaufen wäre, wenn er die kleine Tänzerin gesehen hätte.
Wohl ahnte er nur das frühe Aufdämmern, das sein Wesen durchschauerte, da ihn zum erstenmal Scham besiegte. Er legte endlich das beklemmende Gefühl und seine halben Gewißheiten auf die erträglichste Weise zurecht, indem er meinte, es sei sehr dumm, zwei schöne Böckli herzugeben, und die Großen seien über seine Torheit aufgebracht und belustigt gewesen. Eine Last fiel ihm vom Herzen, als er diesen Schluß gefunden hatte. Je mehr Reue er über die vergeudeten Leckerbissen empfand, desto weiter verlor sich das Grinsen und Augenzwinkern der Großen, das ihn beschämt hatte.
Sein Herz blieb unbefleckt, wenngleich eine heimliche Not in ihm nachzitterte. Es trieb ihn über die vielen Treppen des Pilgerspitals in die Kammer seiner Eltern hinauf, ohne daß er die Mutter suchte. Er holte seinen sorgsam geborgenen Kram aus dem Versteck und breitete ihn vor sich hin.
Da lagen die Knöpfe und Nägel, das Seidentüchlein und das blaue Band, der Ballen Hanf und der Strick – seine ganze Fürsorge lag vor ihm, und aus den vielen wertvollen Dingen sollte nun etwas entstehen, das ihn als kunstreichen Mann erwies und eine Torheit wohl aufwiegen konnte.
Jeder Knopf hatte ein Öhr, auch die Schelle, die er im Brotsack trug. Er holte die Schelle heraus. Der Strick war zu dick für die Öhre. Da half der Hanf. Er zog etliche Fasern aus dem Ballen und drehte Fäden, wie es Mutter und Großmutter an Winterabenden machten, wenn die Spindel über das Estrich tanzte. Das gelang zwar nicht so schön, und die Fäden wurden reichlich naß, aber sie schlüpften durch die Öhre, und er konnte die Schelle an sein blaues Band binden, zu beiden Seiten der Schelle aber je zwei Knöpfe. Er legte das Band über seinen Bauch, so daß die Schelle schön in der Mitte hing, und hatte einen stattlichen Gürtel.
Wenn die kleine Tänzerin den Gürtel trüge, wie würde die Schelle klirren, wie möchten die gelben Knöpfe blitzen! Er lehnte sich an die Wand zurück. Über ihn hauchte der Abend kühl durch das Fenster in die heiße Kammer hinein.
Wenn er auf dem Seile so springen könnte? Und höher noch müßte ers! Daß sie ihm staunend zusähe. Er würde dann hoch herab auf den schwarzen Kopf des Meisters springen, daß der Laur hinfällt und weint vor Kopfweh und ihn bittet, nie wieder so hart mit ihm zu sein. Dann zieht er ihm die Gerte aus dem Stiefelschaft, zerbricht sie und wirft sie weit über die Leinwand fort. Er führt die kleine Tänzerin zu dem Böcklistand und kauft für sie – soviel er will! Und wer sein Maul zu Schimpf verzieht, der bekommt eins drüber mit dem Schwert! So …
Theophrast war aufgesprungen, hatte sein Schwert ergriffen und hieb auf die Kissen des Bettes ein.
Als er an seiner Rache müde geworden war, hob er das Band mit der Schelle und den Knöpfen auf, besah es fast verächtlich und warf es in einen Winkel. Ihm nach flog alle andere Fürsorge, mit der er sich vom Ochsnerhaus hergeschleppt hatte.
Es war dunkel geworden. Er fühlte Hunger und wollte nun die Mutter suchen.
Während er, auf den Zehen stehend, den Holzriegel hob, begannen alle Glocken zu läuten. Er hielt eine Weile an und lauschte.
In das schlagende Dröhnen und summende Singen des vollen Geläutes schmetterten die Posaunen und Trompeten ihren reschen, trotzigen Laut. Den Schwall durchbrach aus dem groben Geschütz, das vor der Abtei aufgefahren war, der erste Schlag, ein Zeichen für die Feuerwerker und Böllermeister auf den Höhen rings.
Theophrast jauchzte. Er hatte den Riegel zurückgeworfen und strebte, so eilig es in der Finsternis ging, über die Stiegen hinunter.
Sie läuteten, bliesen und bollerten das Fest der großen Engelweihe ein. Während das Knäblein Theophrast über die finsteren Stiegen und Gänge des Pilgerspitals zu den Menschen tastete, umdrangen ihn die rufenden Stimmen, als seien Tore gesprengt, als stehe eine neue Welt offen.
Er hatte aus erster dunkler Wirrsal des Herzens den Weg gefunden, tastend noch durch finstere Gänge und über knarrende Treppen, eingeschüchtert von dem Unsichtbaren, aber umwallt von rufenden Stimmen.