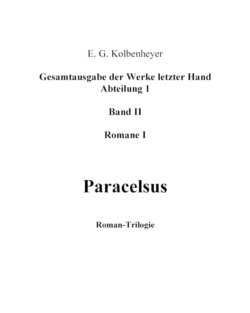Читать книгу Paracelsus - Erwin Guido Kolbenheyer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Quellenlaut und Sumpfnebel
ОглавлениеIn weitem, dichtem Kranz standen viel Tausend am andern Tag rings um die Klostermauern. Sie hatten geruht, sich gütlich getan und brauchten nicht ans Weiterkommen zu denken. Sie waren begierig, den hohen Klerus, Vornehme und Reiche, die von Roß und Sänfte herbeigeschleppt waren, demütig hinter dem Kreuze ziehen zu sehen. Als das Geläute anhob und aus den offenen Toren der Kirche heller Jubelton drang, schmolzen die dunklen Mäntel, die staubgrauen, breiten Hüte in eine dichte Masse zusammen, aus der Tausende schaulustiger Augen blitzten.
Ein schweres Goldkreuz leitete die Prozession, ihm nach drangen die Kreuze und Fahnen der Pilger. Fremde Priester trugen den Schatz der Heiligtümer und Weihgeräte, die funkelnd nach jahrelangem Kirchendämmern das Sonnenlicht an den gediegenen Spitzen und Zacken und in den zahllosen Edelsteinen fingen und wieder aussprühten. Den Zug der Priester beschloß Herr Diebold. Dann führte eine Schar von singenden Schülern den Fürstabt und den Protonotar. Herr Konrad von Rackeiberg im Pontifikalschmucke, Onofrio de Nartia im prunkenden Kirchengewand. Seine Dalmatika aus gelber Seide mit Musterung von grünem Samt trug goldgestickte, perlbesetzte Bandstreifen, sie wurde von Kennern laut bestaunt. Beide schritten nebeneinander, ihnen zur Seite die Assistenten.
Nach einem Abstande, der von zwanzig Schwyzern im Harnisch, mit geschulterter Hellebarde gehalten wurde, folgte der sonderbare Zug, auf den die Neugier des Volkes am meisten brannte.
Noch in später Stunde des Vorabends war die Nachricht von Mund zu Mund gegangen, daß sechzig Geißler aus der Kurpfalz eingetroffen wären. Dort wütete schon ein Jahr lang die Pest. Die Geißler nächtigten in einem Klosterschupfen. Ihr Meister hatte verkünden lassen, daß keiner mit einer Weibsperson sprechen dürfe, weshalb das Frauenzimmer ihnen fern zu bleiben habe. Sie würden eine Statt wählen. Am morgenden Tag, der ihnen einzig für den Gnadenort gewährt sei, würden sie während der Prozession und gegen den Abend hin auf der Geißelstatt die Buße vollziehen. In der Prozession sollten sie von den vornehmsten Wallfahrern begleitet sein.
Sie gingen nicht gleichmäßigen Schrittes wie die übrigen. Die einen trippelten, andre langten weit aus und bogen die Knie, als läge eine schwere Last auf ihnen, etliche wankten todmüde, und es gab einige, die beinahe tanzten. Dadurch kam die merkwürdigste Unruhe in die Horde. Weil manche Ketten an den Füßen und Händen mitschleppten, übertönte das Rasseln den klatschenden Laut der Hiebe. Sie hatten den Rücken entblößt und schwangen den Bußriemen über die Schultern. Je vier Nadeln waren in die drei Knötchen eingeknüpft und rissen die entzündeten, schwärenden Rücken auf. Das Blut floß schon nach den ersten Streichen. Ein Seufzen und Lallen, aber gedeckt, als käme es nicht von den Lippen lebender Menschen, hing an dem Zuge.
Zu beiden Seiten der blutrünstigen Schar schritten Edelleute in glänzender Gewandung. Sie trugen gewundene Kerzen. Ungrische, böhmische, sächsische, französische, welsche, flandrische Kleidung. Gekrauster und glatter Brokat, Satin, Karmoisinseide, Kamelot, Damast. Viel Gold in Ketten und Ringen. Stein und Perlen überall. Durch die Menge schauerte eine dumpfe Erregung, als sie das rinnende Blut der blassen Menschen sah, die wie eine Herde in beide Reihen der farbe- und glanzstrotzenden Herren eingepfercht waren. Wo die Geißler hinkamen, vernahm man halbunterdrückte Rufe.
Aber diese Erregung wurde fast plötzlich niedergeschlagen. Hinter den Geißlern gingen die Frauen der Vornehmen. Sie übertrafen ihre Männer an Üppigkeit der Tracht. Ein anderes Feuer flackerte aus den Augen unter den Pilgerhüten. Neid, Habsucht, stumpfe Bewunderung, blödes Staunen, hastig schlürfende Gier. Wie sie ihre Weiblein ausstatteten! Fast konnten die zierlich beschuhten Beine den Faltenwust des Kittels und der Schleppe nicht weiter bringen. Und die Brüste zitterten auf dem Leibchenrand, von einem kostbaren Vorstecktuch schmiegsam und dünn bedeckt, daß die dunklere Farbe des Warzenhofes zu sehen blieb. Auf dem Kopf der Damen wehte meist die französische Hennin, ein geflochtener Turm mit Äugelnden Behängen. – Eine befreiende Äußerung fand unter dem Landvolk zuweilen jauchzenden Schall und Widerhall. Die Ordner, die den Zug der Frauen begleiteten, mußten mit quergehaltenen Hellebarden gegen den Menschenring andringen. Man konnte gewärtig sein, daß ein betrunkener Lümmel, dessen Blut durch die Geißler in Wallung geraten war, sich an den Entblößten vergriffe.
Auf die Damen folgten Schwyzer im Küraß, und hinter ihnen schwenkten die Pilger ein, bis auch der ganze Kranz von dunklen Menschen in die Bewegung aufgenommen war, während die Kleriker, Geißler und Vornehmen wieder in die Basilika eintraten.
Theophrast hatte sich, als die Kirche leer stand, durch die Reihen der nachdrängenden Pilger gezwängt und war eingetreten. Burschen rissen an den Glockensträngen, die zu beiden Seiten in das Atrium herabhingen. Und da die Stränge im Gleichmaß des Geläutes durch die Löcher der Decke auf und nieder schlüpften, ahnte Theophrast den Zusammenhang. Er wollte ihn ergründen, fehlte jedoch die richtige Treppe und kam auf das Orgelchor, wo Männer und Knaben um einen hageren Kleriker standen, der halblaut auf sie einsprach.
Theophrast schlich an die Brüstung. Er konnte nicht darüber hinwegsehen. So zog er einen Schemel in die Ecke, erkletterte ihn und setzte sich rittlings auf die Brüstung.
Tief unten lag die Gnadenkapelle, ein unheimlichs Funkeln und Glimmen. Rings an den Wänden vor düsteren Bildern zitterten zahllose Flämmchen. Je weiter in der Tiefe, desto lichter wurde der Raum, und das blinkende Gedränge der Brandopfer mußte vor dem Sonnenschein verblassen, der sein schräges Goldgebälk durch die Fenster schlug. Aber ganz hinten im hohen Chor, wo neben dem Hauptaltare die schenkeldicken Standeskerzen herrisch über dem flimmernden Heere flackerten, konnte auch der helle Tag die Flammenwoge nicht schlagen. Der Altar glich einem sprudelnden Feuerquell, von dem aus zwei Funkelströme längs der Wände flössen. Sie versanken im Halbdunkel der Vorhalle und verglommen geheimnisvoll in der Gnadenkapelle.
Theophrast glotzte in das Wunder. Die dicke Luft, die schwer nach Wachsdampf, Ruß und erkaltetem Weihrauch roch, legte sich auf seine Brust. Ihm war, als würde sein Atem von einer ehrfurchtheischenden Macht unterdrückt. Und ehe er noch sein Auge an dem Gefunkel sattgeweidet hatte, ging eine Bewegung durch die Leute des Orgelchors, auch tief unten vernahm er das Geräusch der Sohlen. Mit einem Jubellaute setzte die Orgel ein. Theophrast schmiegte sich in den Schatten einer Holzfigur, deren Schultern und Kopf über die Brüstung heraufragten.
Sie führten feierlich die glitzernden Heiltümer an der Gnadenkapelle vorbei. Das breite Schiff der Basilika lief von bunten Menschen voll, die alle gegen den Hauptaltar zudrängten. Ihnen nach schob die dunkle Masse der Pilger. Zwischen dem Chorgestühl warfen sich die Geißler auf die Fliesen, ein Purpurstreif in dem weißen Felde der Chorhemden. Die Heiltümer säumten mit ihrem Glanz den Purpurstreifen. Auf dem Bischofssitze saß der Legat in seiner strahlenden Dalmatika. Der Fürstabt weihte den Altar für das Hochamt. Er trug jetzt das veilchenfarbene Meßgewand.
Theophrast sah weiße Wolken durch die schrägen Sonnenbalken rollen. Des Chores Stimmen drangen fern her und wurden brausend von Orgel und Kantorei beantwortet. Da fiel ihm die Erzählung der Mutter ein. Er wartete und hoffte auf die Engel Gottes.
Aber nur schwüler stieg der Menschendunst auf. Zuweilen meinte Theophrast, er müsse entschlafen. Er ritt auf der Brüstung, hing an der Schulter des hölzernen Heiligen und wartete, wartete auf die Engel Gottes.
Da hörte er durch das Dämmern seiner Sinne den Silberton der Meßschellen. Ein Brausen ging durch das Schiff. Als sei der Sturm in ein Saatfeld gefallen und halte die Ähren unter seinem Hauche gebeugt, so sank die Menschenflut. Und über sie hinweg schrillte der Silberton, ein sanftes, herzdurchdringendes Gellen.
Theophrast saß aufgereckt und spähte. Die alle mußten es sehen, er sah es nicht. Eine tiefe Bangigkeit beklemmte ihn. Seine Augen irrten durch den heißen, erstarrten Raum.
Dann hob sich das Brausen wieder. Die Menschenflut staute empor. Helles Jauchzen aus Orgel und Kehlen.
Sie hatten es gesehen! Vielleicht waren die Engel herabgestiegen, und er, er wußte nichts davon.
Er rieb die Augen und fühlte, daß er am Wams festgehalten werde. Ein Männlein, dessen Schultern kaum über die Brüstung ragten, stand bei ihm. Es trug lange weiße Haare. Das Männlein sah lächelnd auf, seine Augen waren licht und klar wie der Himmel in den ersten Lenztagen. Theophrast sah die Augen und den weißen Scheitel, auf dem ein goldiger Schimmer lag, und fühlte keine Furcht. Er neigte sich herunter und flüsterte:
„Seind die Engel do g’si?“
„Ünser Herr Heiland ist do gewest.“
„Wo ist der hin?“
„Er ist ufgeopfert und ingenommen.“
„Ich hab ihn nit gsehn.“
„Bis gueten Muets, Kind, die mehristen hänt ihn nit gsehn. Aber kumm. So ich nit hinter dir gestund, lägest erschlahen unt in der Kirch. Siehe, der hülzern Heilig do stoht nit meh fest.“
Das Männlein berührte den Hals des hölzernen Heiligen, auf dem Theophrast halb und halb gelegen war, und das Bild schaukelte leise.
Dann zog das Männlein den Knaben herab und führte ihn durch das Gedränge in und vor der Kirche so leicht und unaufhaltsam, als wäre es ein großer Herr, vor dem die Leute eine Gasse bilden.
Es schob Theophrast sanft vor sich her, und Theophrast meinte, er würde getragen. Da die Menschenreihen lockerer wurden und das Rauschen des Frauenbrunnens den Orgelton und den Meßgesang übertönte, fühlte Theophrast einen geringen Schlag auf seine rechte Schulter. Er sah um, aber das Männlein war verschwunden.
Die Mutter stand nicht weit von ihm bei anderen Frauen. Sie wollte ihn schelten. Er mußte sie beschwichtigen und redete von dem weißgelockten Mann zu ihr, der ihn gehalten und durch die Menge geleitet hatte. Die Mutter fragte, und ihr Herz zitterte, da sie mehr und mehr erfuhr, in welcher Gefahr ihr Kind gehangen habe. Immer wundersamer kam ihr die Rettung vor, und sie wagte kaum, der Ahnung Sinn und Wort zu verleihen, die ihr mit frommen Schaudern die Brust schwellte. Im Pilgerspital zog sie ihn vor das Kreuz an der Flurwand.
„Knie nieder und bet mit mir!“
Er gehorchte, weil er durch die Stimme der Mutter und ihre Fragen, die stets bewegter geklungen hatten, eingeschüchtert war.
So fand sie beide Herr Wilhelm. Die Frau berichtete mit verhaltener Stimme und bedeutsamen Blicken das Erlebnis Theophrasts.
und er hat uf die Engel gewart’t.“
Das Kind sah zu seinem Vater auf, als müsse ihm eine Erklärung für das Gemunkel der Mutter werden. Herr Wilhelm erkannte den Blick. Er schüttelte langsam den Kopf und redete zu dem Knaben.
„Wer derselb gewest sie, des sollt ihr euch nit bekümmeren, wollend hoffen, er seie ein gueter Gesell gewest. Aber du mußt bedacht sin und wohl versehen. So dir all Ding ze Zeichen und Wundern werdind, möchtist ein schweren Stand uf der Welt han.“
Theophrast verstand den Vater nicht. Er war noch in den Jahren, da ein Kind den unmittelbaren Lauten der Mutter folgt. Aber die ruhigen Worte ließen ihn doch vergessen, daß es aus den Fragen der Mutter wundersam gebebt hatte.
Wilhelm Bombast fügte hinzu:
„Du sollt mich gen Abend zu denen Geißlern begleiten, die kunnten meiner begehrn, dann sie liegend unter ohnmenschlich harter Regul. Und solltu mir den Eimer nachtragen. Ufdaß du nit allso allein streifest.“
Er sagte es mit besorgtem Blick auf sein Weib, das kaum die Bürde des Spitalwesens aushielt; wie mochte sie noch des eigenwilligen Knaben warten!
Und er seufzte leise. Ihm ward mehr und mehr die Freude auf seines Lebens Feierabend entrissen.
Herr Wilhelm hatte die Jahre her ein kleines Häuflein Geld zusammengetragen. Er durfte die schmalen Tage seiner landfahrenden Zeit vergessen. Aber soweit reichte der Pfennig nicht, daß er die Frau und den Knaben hätte von den Mönchen freikaufen können. Obwohl er, ein freier Mann und von Adel, ein Weib ehelichte, dessen Familie ein Wappen führte, war seine Nachkommenschaft dem Kloster fällig. Die Mutter blieb hörig, das Kind folgte nach altem Rechte der böseren Hand.
Und er mußte Zusehen, wie das Weib, von Haus und Dienst bedrängt, vor der Zeit verblühte. Aber er hatte ja viel zu schaffen und scheute die rauhen Wege nicht. Man litt ihn wohl. Doch man litt ihn, und auch das bedrängte zuweilen den verschlossenen Mut.
Wenn das Schwabenjörgeli unter ihm durch den hohen Tann zur Teufelsbruck niederzottelte und er die Börse am Gürtel um etliche Plappart härter fühlte, wars ihm, als sei wieder ein Schritt in die Weite gewonnen. Er träumte, daß er vermittels eines runden Sümmchens an einem fernen Ort zu Brot und Haus gelangen werde, wo man sein Weib nicht aufbieten könne, und alle einen Frieden hätten.
Dann sollte sein Ehstand neu erblühen, wenn die Eis Ochsnerin nicht mehr auf Heimatboden stand, der ihre Kraft aussog. Er wußte wohl, daß sie zäh am Ochsnerhaus hing, aber er kannte auch ihre Treue und Liebe zu ihm. Sie würde ihnen beiden nachfolgen und, wenn etliche bittere Zeit verstrichen wäre, die Wohltat erfühlen, ihres eigenen Hauses Herrin zu sein und eine Muße zu gewinnen. Herr Wilhelm träumte, daß die rauhen Hände der Eis weich und zart sein könnten, daß sich die müden Furchen ihres Gesichtes glätten und ihre Wangen rosenrot erblühen würden. Doch sprach er nie zu ihr von diesen heimlichen Wünschen. Sie hätte ihn kaum verstanden.
Er kannte die Haushalte ringsum. Überall welkten die Weiber in jungen Jahren unter ihrer Last. Die Männer, wenn sie länger im Überschuß der Kräfte standen, griffen nach den Mägden, und es gab wenig wohlbestellte Höfe, darin mit der Kinderschar nicht auch etliche Kegel aufwuchsen. Der Bombast von Hohenheim, wiewohl er einer Sehnsucht nach Seßhaftigkeit bedachtsam gefolgt war, hatte die Ochsnerin nicht nur der Heimstatt wegen gefreit. Da er die Heimstatt besaß, begehrte er in der Ehefrau das Weib, das ihm mit zarter Schönheit und süßem Rausch die reifenden Jahre bekränze. Er war kein Bauer, der nimmt, was ihm in die Hände fällt, und nach gesättigtem Triebe der Bodenkrume und dem Viehstand lebt. Sein Blut war alt und gar, sein Geist rege. Während er die stöhnende Not seiner Kranken beriet und heilte, Salben und Tränke bereitete, wollte er die Gewißheit einer schönen, beglückenden Stunde haben.
Diese Labsal hatte er nicht. Also begann die Unrast seiner früheren Jahre wieder das lockende Spiel von der seligen Ferne vor ihm. Und er wußte zuweilen nicht, was ihn mehr forttrieb: die Sehnsucht, sein Weib zu pflegen, auf daß er in ihm sein Leben genösse, oder das Neue zu gewinnen und eine gastlichere Erde unter den Füßen zu fühlen, die nicht nur tragen wollte, was auf ihr laufen gelernt hatte.
Im Stillen hoffte Herr Wilhelm von der nächsten Zeit: der schwäbische Bund war eine gute Waffe in der Hand Maximilians, und die Hand erhob sich drohend gegen die Eidgenossenschaft. Man wird ihm sein Schwabenblut verargen. Auch Eis wird es fühlen müssen. Und so wird er einen gerechten Grund finden, die neue Weite zu gewinnen.
Noch vor der Engelweihprozession war Wilhelm Bombast ans Lager eines jungen Menschen aus der Geißlerschar gerufen worden. Der wurde hart vom Fieber geritten und stammelte wirre Gebete. Wenn ihn der Husten befiel, warf er eine Handvoll Blut aus. Er hatte dennoch kaum gehalten werden können, als die Glocken zum Kreuzgang anhoben. Sie mußten ihm hoch geloben, er werde des Nachmittags an der Geißelung nicht gehindert sein, und sie meinten, er wäre bis dahin so entkräftet, daß ihm ein Aufstehen wohl verginge.
Die Geißler hatten ihre Fahne neben eine Kanzel auf dem Brühl gepflanzt. Sie durften nur einen Tag verweilen. In dreiunddreißig und einem halben Tage, soviel als der Herr Jahre auf Erden gelitten, mußte die Betfahrt beschlossen sein. Auch sollte das Volk nicht Gelegenheit finden, sich irgendwo allzu lange an einem Bußwerke zu entflammen, das die Hut der Kirche leicht durchbrechen konnte.
Theophrast trug dem Vater ein kupfernes Eimerchen nach, das am Frauenbrunnen gefüllt worden war. Die Leute ließen sie willig in den Ring treten. Die meisten knieten auf dem Rasen und beteten den Rosenkranz. Etliche Priester gingen durch die Menge und redeten den Leuten, zu. Man hütete die berauschenden Kräfte des rinnenden Blutes. Heimliche Geißelungwurde seit einem Menschenalter als Ketzerei unterdrückt; etliche Geißelbrüder waren schon verbrannt worden. Nur selten gewährte ein Bischof die blutige Betfahrt und nur dann, wenn sie ein Ziel hatte, wo die schwärmerischen Wellen in das erwünschte Strombett geleitet werden konnten. Aber die knienden, betenden Menschen erwarteten das Schauspiel der Geißelung doch wie ein Sakrament.
Sie zogen paarweise aus dem Mauertor neben der Abtei. Auf ihren Mänteln brannte das rote Kreuz. In ihren gefalteten Händen trugen sie den dreigeschwänzten Marterriemen. Ihre Stimmen klangen mißtönig, heiser und zäh. Eine stumpfe Glut lag in den Augen, wenn sie die Lider hoben und ins Grenzenlose sahen. Sie sangen den alten Leis aus der Zeit des schwarzen Todes:
„Nu ist die Betefahrt so guot,
Hilf uns, Herre, durch din heiligs Bluot,
Das du an dem Krüze vergossen host,
Und uns in dem Elende glassen host.
Nu ist die Straße allso breit,
Die uns zu Unser lieben Frouen treit In unser lieben Frouen Land,
Nu helfe uns der Heiland …“
So kamen sie näher und schritten endlich um die Geißelstatt. Nach den letzten Worten:
„Und bitten den viel heiligen Christ,
Der aller Welt gewaltig ist“,
blieben sie stehen, kehrten sich der Mitte des Kreises zu, warfen die Mäntel ab, entblößten die geschundenen Rücken; alles in langsamen, fast leblosen Bewegungen.
Ein Seufzen schlich durch die kniende Menge. Das Geflüster der Priester wurde nicht mehr beachtet.
Da tönte eine Stimme aus dem Marterkreise weithin durch die Stille:
„Jesus, der ward gelabet mit Gallin!“
Und die andern schrien auf:
„Des sulln wir an ein Krüze fallin!“
Sie spreizten die Arme und fielen bäuchlings zu Boden, daß es stäubte, und lagen unbeweglich, als seien sie an ein Kreuz gespannt. Über eine Weile, sie mochte nach stillen Gebeten gemessen sein, ging eine Bewegung durch die Geißler. Das Volk rings reckte die Hälse und begann zu deuten und zu zischeln.
Die meineidigen Büßer wälzten sich auf die Seite und reckten die drei Schwurfinger über das Haupt empor. Die Ehebrecher blieben auf dem Bauche liegen, nur daß sie die Arme einzogen. Die Mörder rollten auf den Rücken. Die Diebe krümmten sich zur Seite und umfaßten den Knöchel eines Fußes. Und jede Sünde hatte ihre Gebärde. Aber es gab etliche, die nichts zu bekennen hatten, was laut nach Rache schrie, sie blieben zu Kreuze gestreckt auf dem Boden.
Jener Sieche, zu dem Herr Wilhelm geholt worden war, lag auf dem Bauche und er streckte die Schwurfinger über seinen Kopf. Von Zeit zu Zeit warf das Übel den elenden Körper. Wo der offene Mund auf dem Grase lag, wurde es vom Blute rot.
Wilhelm Bombast und sein Söhnlein saßen nicht weit hinter ihm. Der Heilmeister hatte die Tasche geöffnet und hielt ein Fläschchen in der Hand; er beobachtete das qualvolle Verlöschen, dem er nicht mehr begegnen konnte, nur es zu lindern war er entschlossen.
Theophrast sah, wenn ihn die Bangigkeit überwältigen wollte, den Vater an, und weil der ernst und gehalten blieb, löste sich sein Grauen immer wieder, und er fand den Mut, die geschundenen Leiber zu betrachten. Es war gleichwohl eine harte Lehre. Und als es zur Geißelung kam und das erweckte Blut über die Rücken rann, stand ihm das Weinen hoch im Halse, zumal sich ringsum ein Würgen und Schluchzen erhob. Aber des Vaters Stirn, die sonst auch in ihrem Ernste klar blieb, war hart verfinstert. Und das stärkte sein Herz.
Es war nach einer stummen Frist, darin die Büßer ihre Sünden vor aller Welt zur Schau stellten, der Meister aufgestanden. Er schritt über den ersten Geißler, der neben ihm lag, und schlug ihn mit dem Riemen.
„Stand uf durch der reinen Märtel Ehre Und hüt dich vor der Sünde mehre!“
Der Getroffene stand auf und folgte dem Meister. So erhob sich einer nach dem andern, und alle schritten über den nächsten hin. Da alle aufgerufen waren, gingen sie paarweis im Ringe und geißelten sich, daß mancher sehr blutete.
Die Kraft hatten, sangen den langen Leis von der Sünde und der Nachfolge Christi:
„Jesus Christ, der ward gefangin,
An ein Krüze ward er erhangin,
Das Krüze ward vom Bluote rot.
Wir klagend Gotts Märtel und sinen Tod.
Durch Gott vergießen wir ünser Bluot,
Das sije uns für die Sünde guet.
„Sünder, womit willtu mir lohnin Dri Nagel und eine durnin Kronin,
Des Krüzes Fron, eins Speeres Stich,
Sünder, das leid’t ich alls durch dich,
Was willtu leiden nu durch mich?“
Langsam sangen sie, Jede Strophe des langen Liedes sagte dasselbe; sie waren bereit, in der Marter auszulöschen, wie ihr Heiland ausgelöscht war. Der eigentümlich juckende Schmerz, den die Hiebe erregten, und das rinnende Blut jagten sie aus der stumpfen Entkräftung ihrer Betfahrt auf. Sie fühlten, je mehr sie entbrannten, die hundert Augen voll Angst, voll Begeisterung, voll Tränen auf sich ruhen. Sie wankten durch ihr Martyrium mit lechzenden Lippen und halbgeschlossenen Augen, als verlangten sie die Sündengalle der ganzen Welt einzusaugen. Und die beißende Wollust ihrer Buße wuchs riesengroß vor ihnen. Sie fühlten sich eins mit dem sterbenden Christus.
Ehe noch der Leis ausgesungen war, fand die lauschende Menge Sättigung ihrer äußersten, peinlichen Erwartung, die nach und nach alle Augen getrocknet und auch die Begeisterung abgestumpft hatte. Die Blicke folgten nur mehr jenen Geißlern, die ihre Marter kaum weiter zu schleppen vermochten, denen man ansah, daß sie den eigenen erschöpften Leib durch die Hiebe aufpeitschen mußten, sonst wäre er zusammengesunken.
Und als es geschah, bemerkten es zunächst die wenigsten. Der junge Mensch, um dessentwillen Wilhelm Bombast gekommen war, hatte beide Arme gegen den Himmel geworfen, einen gurgelnden Wehlaut ausgestoßen, der aber im Gesang, im Riemenklatschen, im Kettenklirren ertrank, und war mit einigen taumelnden Schritten in den Kreis geflüchtet. Er brach nieder, und sein dunkles Blut schoß aus dem Mund. Er versuchte mehrmals sich auf die Seite zu wälzen und lag dann schlaff, ohne Leben.
Bombast war durch den kreisenden Ring hindurch dem armen Teufel zu Hilfe geeilt. Das hatte aller Blicke gelenkt. Sie raunten, deuteten, reckten sich auf, riefen und drängten hinzu. Aber die Geißler hielten nicht ein. Sie achteten des Gefallenen nicht und schienen die Bewegung des Volkes nicht zu merken. Nur daß sie etwas lauter sangen, ihre Riemen weiter ausschwangen. Und ihre Unberührtheit hielt die Menge im Zaum, schlug die erschreckten Rufe zu Geflüster nieder, zwang die begierigen Blicke zu Scheu und Demut. Die Menge staute zurück, viele sanken wieder auf die Knie.
Theophrast lief mit seinem Eimerchen außerhalb des kreisenden Ringes hin und wider. Er wollte zu seinem Vater und fand den Durchschlupf nicht. Die sausenden Riemen schreckten ihn nicht mehr als die beronnenen Leiber und mißtönenden Münder. Er lief auf und nieder, weinte leise und wimmerte: „Min Vater! Min Vater!“
Keiner hörte ihn. Nie noch hatte er sich so verloren gewußt als da, umgeben von den fühllosen Großen, nur wenige Schritte von seinem Vater entfernt, aber von ihm getrennt durch die fürchterliche Erbärmlichkeit der Geißler.
Der Gesang verstummte, das Riemenklatschen, das Rasseln. Die Büßer standen und kehrten sich gegen die Mitte des Kreises. Ein Krächzen fuhr aus der Luft durch die Stille, daß selbst die Augen der Brüder erschrocken aufblickten. Raben strichen über sie hin. Der dunkle Vogelschwarm ließ manchem das Herz stocken, mancher wurde der Grausamkeit des Schauspieles erst bewußt. Da rief die Stimme des Meisters seine Bußgesellen zurück und sie zerriß auch das zweiflerische Bangen des Volkes.
„Jesus ward gelabet mit Gallin!“
Und sie schrien auf:
„Des sullen wir an ein Krüze fallin!“
Sie sanken Hin. Etliche gruben die Finger ihrer gespreizten Arme in den Boden, als müßten sie sich fester an die Erde klammern, um nicht im Wirbel des Schmerzes und der Entkräftung fortgerissen zu werden.
So fand Theophrast einen Weg zu seinem Vater, indem er über die blutbespritzten Arme zweier Büßer stieg.
Wilhelm Bombast hielt den Kopf des sterbenden Mannes in seinem Arm und ließ ihm zwischen die weißen, zitternden Lippen aus dem Fläschchen hie und da einen Tropfen sickern. Dann geriet die Zunge des Geißlers in eine matte Bewegung. Seine Lider hob er nicht mehr.
Theophrast kniete ihm zu Häupten, er sah aufmerksam nieder. Da er bei seinem Vater war, fürchtete er nichts.
Das Fläschchen hatte einen betäubenden Inhalt, der Geißelbruder konnte ohne Wehlaut verscheiden. Er seufzte kaum auf, da er zusammensank. Herr Wilhelm legte ihn behutsam nieder.
„Nu schlafet er wohl“, flüsterte Theophrast befriedigt, denn des Toten Gesicht lichtete ein Lächeln.
„Ja, nun schlafet er wohl, Theophrast. All sins Herzens Qual hat ein Bschluß. Er ist tot.“
Da neigte sich das Kind spähend über das weiße Gesicht und wollte erkennen, was der Tod sei. Aber es wurde vom Vater sanft aufgerichtet, denn die Büßer traten nahe heran. Ihr Meister fragte und erhielt Bescheid. Ein Kreuz schlug er über den Toten und winkte Herrn Wilhelm, aus dem Kreis zu treten.
Die Geißler standen dicht um ihren Gefallenen und murmelten auf des Meisters Geheiß halblaute Gebete. Sie hatten schon hinter Kolmar erwartet, daß der Bruder sterben werde.
Dann nahmen ihn die acht stärksten auf. Sie zogen schweigend dem Kloster zu, und viele folgten ihnen bis an die Mauern nach.
Auf dem Heimwege fragte Theophrast den Vater:
„Was tuend die mit ihm?“
„Sie graben ihn ein und ziehen alsdann weiter.“
Die Antwort befriedigte Theophrast vollkommen, denn er hatte am Tonfall der Worte erlauscht, daß sein Vater zu einem großen Mann auch nicht anders gesprochen hätte.
Als sie im Schwarme der Leute an dem buntbemalten Wagen und dem abgeblachten Platze vorbei kamen, faßte Theophrast des Vaters Hand fester und meinte:
„Das muoß ein Narr sin, so er dem Gugelvolk zwen guete Schafbock gibt und tuet sie nit selbsten ein!“
Herr Wilhelm, dessen Herz andere Dinge füllten, nickte nur, und Theophrast fand sich in seiner Welterkenntnis sehr bestärkt. Er beschloß, kühngemut der kleinen Verführerin zu begegnen und sie bei gutem Winde trefflich anzufahren, darum weil sie ihm mit zwei schönen Schafböcken so schmählich entlaufen war.
Schon bei dem Engelweihschmause am Tage des Hauptfestes kam es, da die ersten Schüsseln genossen waren und mancher Wein seinen Weg gefunden hatte, zur friedsamen Parteiung der Kleriker. Anfänglich lag freundschaftlich flüsternde Befangenheit über den geräumigen Tischen des großen Abteisaales. Doch man aß nicht schlecht und schlürfte den erfreulichsten Trunk.
Um den Tisch des Fürstabtes und des Legaten schlich es am längsten mißtrauisch auf Zehenspitzen. Der Legat war in spanischer Edelmannstracht erschienen, er unterhielt sich nur mit Standespersonen, soweit sie Latein und Italienisch geläufig sprechen konnten. Fürstabt Konrad von Rackeiberg aber hatte, vertrauend auf den Wein, in seine Nähe Herren geladen, die ebensowenig von dem römischen Wesen hielten, Wild und Weib gut kannten, ein untadeliges Wappen trugen, vorerst noch beharrlich schwiegen, aßen und tranken.
Herr Diebold saß am zweiten Tische. Und dieser Tisch wurde gleich zu Beginn des Mahles rege. Sie redeten nicht laut, aber lebhaft und zungengewandt. Herr Diebold hatte zunächst von Nikolaus de Donis gesprochen, und ein Reichenbacher Mönch hielt eine Lobrede auf den gelehrten und freisinnigen Freund in flüssigstem Latein. Den meisten an Herrn Diebolds Tisch huschte dabei ein Lächeln der Befriedigung über das durchgearbeitete Gesicht, und das Lächeln blieb, es löste die Zungen. Man wußte, man kannte, etliche zitierten sogar aus Briefen. Ehe die erste Schüssel geleert war, fühlte sich jeder geborgen. Und die erlauchtesten Namen der Zeit, Ruhmestitel manches Klosters und mancher Universität, schlangen das geistige Band um die Stirnen dieser Männer. Sie erkannten einander nach wenigen Worten, ihre Augen glänzten, ihre Lippen wurden schmal und heiter, in Blick und Mundwinkeln zuckten bereits Neugier und Ironie, die Fußangeln der geistigen Freundschaft. Sie waren bei sich und unter sich. Dankbar, daß sie für eine Stunde des Genießens vor aller Barbarei ihrer Brüder und der Oberen geborgen waren, tranken sie Herrn Diebold zu, und er, der nun ein halbes Jahr in Fron der Kerzen- und Zeichenbank, des Hausund Kellerwesens, der Berufungen, Quartiere, Krämerei und Polizei gelegen hatte, feierte die Auferstehung seiner beschaulichen Winterfreuden, wie einen wohlverdienten Triumph.
Von Reuchlin hörte man, daß er an den kurpfälzer Hof zu Johannes von Dalberg, der noch immer die rheinischen Akademiker führte, ehestens ziehen werde. Ihm war das Leben in Tübingen und Stuttgart vergällt, er war sogar seines Lebens nicht sicher, da der Augustiner Holzinger vom jungen Herzog Eberhard zum Kanzler der Universität ernannt worden war. Reuchlin hatte den wüsten Gesellen zu Lebzeiten des alten Herzogs, Ruhm seinem Andenken, hinter Schloß und Riegel gebracht. Holzinger, der Freund des jungen Fürsten, trachtete dem berühmten Gelehrten mit gleicher Münze heimzuzahlen. Und Reuchlin war kein Mann, der seine Fehden jenseits des Schreibpultes und der Lehrkanzel führen mochte. Er schrieb seinen Freunden klägliche Briefe, denn er scheute auch, da er zäh an dem gewohnten Besitze hing, die Reise mit Sack und Pack auf Landstraßen, wo er des Leibes und des Gutes nicht viel sicherer war.
Da kamen etliche mit leiser Elegie, die von den andern unter halbem Lächeln angehört wurde, auf das Benificium des Klosterlebens zu sprechen, dessen Frieden und Abgeschiedenheit den Wunderbaum an Gelehrsamkeit, Trithemius, den Abt zu Sponheim, ungekränkt wachsen ließ. Tritheim war streng kirchlich geblieben, schicklichermaßen wurden die Einrichtungen der Kirche gelobt, wenn man ihn nannte; das gehörte zu Tritheims Lebensstil. Sie kannten ihn fast alle. Man stellte sich gerne gut zu dem Berühmten. Er sammelte für ein Werk, das alle Gelehrten seiner Zeit anführen und ihre Verdienste preisen sollte.
Doch fiel der Name des Unruhgeistes Konrad Celtes wie eine Befreiung in den Kreis der Wissenden. Die Kirche war gelegentlich Tritheims gepriesen, man hatte geistige Absolution für etliche Gespräche, die einen geschätzten Förderer der Musen betrafen, der offenkundig heidnisch empfand und lebte. Fast jeder wußte irgendeine andre Stätte, wo er des unermüdlichen Celtes Einfluß und Wirken im Dienste der Poesie erfahren hatte. Und man brauchte sich nicht zu hüten, von den zahlreichen Liebschaften des fahrenden Gelehrten zu erwähnen, deren Freuden er selbst in ungeschminkten Liedern aller Welt preisgab, aller Welt, die feingeschulte Ohren besaß und ihr Vergnügen an eleganten Versen finden konnte.
Auch gegenwärtig – so berichtete ein Reichenbacher – sei er einer Dame erlegen, aber nicht in Liebesgluten. Er werde in Wien bleiben, die Universität Ingolstadt habe ihn für alle Zeit verloren. Celtes machte Ingolstadt wohl den Vorwurf eines dummen, saueren Bieres, das einer nur tränke, der verdürste, aber im Grunde sei es doch die Frau des Rechtsgelehrten Fontulanus gewesen, die ihn ausgebissen habe. Sie hätte dem Poeta Laureatus anfänglich gute Zeiten verheißen und wäre alles an allem ein Weibsstück von angenehmer Ründung und kräftigem Begehren; die ihr gefielen, brauchten um Amt, Titel und sonstige Vorteile der alma mater nicht bange zu sein – nur stünde sie nicht mehr in der ersten Blüte, während Celtes, der Kenner, den zarten Flaumhauch eben gereifter Frucht liebe und abgefingerte Süßigkeiten verschmähte. Die Fontulanin sei in dem ungleichen Kampfe Siegerin geblieben, denn sie hätte den Mann und fast die gesamte jüngere Universität auf ihrer Seite gehabt, während Celtes nur über etliche Giftpfeile verfügte. Die seien bald verschossen gewesen, und zwar in allen Metren des göttlichen Horaz, und seien an der gegerbten Haut seiner Feindin abgeprallt. Da habe er weichen müssen.
Vielen war die eigentliche Ursache des Umzuges nach Wien unbekannt gewesen, denn Celtes hatte verbreitet, er suche Wien zu erreichen, um hier eine gelehrte DonauGesellschaft im Geiste der Poesie zu gründen.
Von Celtes kam man auf Cuspinianus, der, zwanzigjährig, von Maximilian in einer glänzenden Fürstenversamlung, unmittelbar nach den Exequien Friedrichs III. mit dem apollinischen Lorbeer gekrönt worden war. Der Liebling des Adels! Er stünde vor dem medizinischen Doktorgrade und müsse demnächst Rektor werden. Neben diesem Wunder an Jugend, Kunst, Rhetorik und Gelehrsamkeit werde selbst der erfahrene Celtes einen schweren Stand haben. Denn Celtes, wiewohl kaum vierzig, altere, daran sei leider nichts zu ändern. Das üppige Leben im Wechsel mit Entbehrungen, die Ruhelosigkeit … man müsse ihm wünschen, daß er in Wien einen warmen Herd fände.
Und an diesem frommen Wunsche fanden die Zungen und Herzen aus der bedrohlichen Nähe der Husaren und Türken zurück an den Rhein, wo Johann Wimpheling fast alle Städte zwischen Basel und Köln befahren hatte, die edlen Künste der Alten zu fördern. Man gedachte Sebastian Brandts zu Basel, des Historikers Murrho zu Kolmar, des Geiler von Kaisersberg und seiner Freunde, des Canonikus Thomas Wolf, des Adolfus Ruscus und Georg Erlebachs.
Nicht nur vom Rhein und aus dem östreichischen, auch von Schwaben, Franken, Bayern her und von Sachsen und Böhmen wußten sie stille und laute Geister zu beschwören, die über allen spitzfindigen Zank der Schola, über Realismus und Nominalismus hinweg zum Sonnenglanz der olympischen Muse zurückgefunden hatten.
Sie nannten am Tische Diebolds von Geroldseck Gott, Christus, Maria und die Heiligen nicht eitel, sie halfen ihren Beteuerungen mit Jupiter, Apoll und Minerva. Herkules, der die heitere Erde vom Rücken des Atlas auf seine prächtigen Schultern genommen hatte, vermochte ihre Reden besser zu stützen als das gotische Ungetüm St. Christoffel, das mit aller mystischen Welt des Glaubens auf den zottigen Achseln durchs Wasser geplanscht war.
Etliche erwähnten auch des Desiderius Erasmus, der in Paris lebte, London und Italien besuchte, deutsche Lande aber mied, obwohl er auch da einen guten Ruf unter Kennern genoß.
So lebte ein nicht geringer Teil der Welt an diesem Tische. Die Gespräche wurden kaum lauter, wenn auch die Wangen sanft erglühten.
Hingegen erwachte der andre Tisch des Saales um so merklicher, besonders der Kreis um Kuonrad von Rackelberg. Da ließen sich die geistlichen und weltlichen Herren von ihren Dienern aufwarten und tranken zu gleichen, vollen und halben, obwohl der Wormser Reichstag zwei Jahre vorher die Sitte des Zutrinkens verboten hatte. Und sie wurden bald voller.
Zunächst erwärmten sie über dem Weidwerk, da einer behauptet hatte, daß man den Falken nach alter deutscher Weise besser blende, als mit der Haube. Durchs untere Lid sei ein Faden zu ziehen und daran das Lid aufzubinden. Die meisten verlachten die veraltete Ansicht und traten polternd für die Blendkappe ein. Und das Gespräch sprang bald auf die Politik ab. Maximilian, seine ritterlichen Eigenschaften in Ehren, war Gegenstand ihres derben Gespöttes. Unverrichteter Dinge kam er aus Burgund. Er hatte kein Geld mehr, also auch kein Heer. Wie wollte er seinen ewigen Landfrieden stützen. Auch sein Reichskammergericht war aus dem Leim gegangen, da man weder Richter noch Commissarien zahlen konnte. Auf dem Lindauer Tag hatten die Stände alle Hilfe rundweg ausgeschlagen, und der Kaiser war mit leerem Säckel zornig abgereist, ohne den Abschied zu erwarten. Kein Ritter wird unter Reichsgericht und -Steuer gezwungen werden, geschweige besserer Adel. Darauf konnte man ruhig trinken.
Der Legat spitzte unvermerkt die Ohren, als sei ihm das Deutsch verständlich, das über Maximilian herging. Er hatte seinen Kreis mit dem Hofleben des Papstes leicht unterhalten, obwohl er die verfänglichsten Vergnügungen des Heiligen Vaters verschwieg. Und er fand Anerkennung, als er, nicht ungewandt, eine verhältnismäßig harmlose Kurzweil Alexanders IV. beschrieb: in einem Hofe des apostolischen Palastes rossige Stuten von turkmenischen Hengsten beschälen zu lassen. Nach den rossigen Stuten fiel das Gespräch auf die Weiber. Man ließ durchblicken, daß die Cursetta allgemein beachtet werde. Der Legat lobte das Frauenzimmer, wie man einen gutgezogenen Jagdhund preist. Etliche äußerten Zweifel, um die Eitelkeit des Legaten aufzustacheln, und er meinte lächelnd, daß er ihre Neugier befriedigen würde, wenn er nicht auf barbarischem Boden stünde, wo man kaum sicher sei, daß nicht jeder Genuß in Bestialität ausarte. Er würde die Cursetta nackt auf einem Tische tanzen lassen. Man spöttelte, aber der Legat blieb kühl und erzählte die Affäre seiner Geliebten, um zu beweisen, daß er nicht vor ein paar hundert Augen zu verstecken brauche, was ganz Rom gesehen und bewundert hatte.
Die deutschen Herren hatten den Gesprächsstoff der Italiener erwittert und wieherten bald mit geblähten Nüstern und wässerigen Äuglein. Auch in den beiden Nebensälen waren sie über die Notbrücke der Politik in das Sumpfland geraten. Die Zote goß ihren Spülichtkübel über die Tische der Abtei.
Eines einzigen jungen Mönches Schamröte blühte fremd unter den erhitzten Köpfen, und nur der feiste Bruder Clemens von Augsburg achtete der Qual des jungen Mannes, der nach Mut zur Flucht rang. Der gespaltene Schweinsrüssel ober den Wulstlippen des Augsburgers zuckte vor Vergnügen, wenn er merkte, daß der junge Bruder heimlich erbebte und einen scheuen Blick über die Runde huschen ließ.
Als dieser Bruder begann, erblaßte der junge Mönch, denn die Worte züngelten über den Tisch, als seien sie nur an ihn gerichtet. Bruder Clemens erzählte, aller Ohren nahmen durstig ein:
„Eins Becken Marxen Walters Fraue ist im Kindbett gelegen. Er war sunst Gaismaier genennt, in St. Jergen Pfarr. Der hat dieselbig Zeit umb seine Magd in dem Haus gebullet, daß sie seins Willens war und sich hälsen ließ. Die wollt sein Willen nit tun und sagt es der Frauen. Die Frau beredt die Magd, daß sie ihn sollt auf die Nacht an ihr Bett bstellen, und daß er nit ein Wort saget und still wär. Das tät die Magd. Also leget sich die Frau an der Magd Statt in der Magd Bett. Da kam der Beck, tat ihr so übel nit und flüsterte: ,Wann mein Weib also freundlich wär als du, das wollt ich gern.“ Tat ihr demnach Bescheid, daß sie still bleib, er wollet bald wiederkehren. Auf sollichs ging der Beck zu seinem Knecht und spricht: ,O Lieber, gang hin, die Magd möcht gern ein Liebs von dir, ich trauet mich nit, sie sag es mein’ Weib? Sollichs saget er, dann er forcht ein Kind. Und hoffet, so geb sie das Kind mit Glimpfen dem Knecht. Also ging der Knecht hin zu seiner Frauen und meinet auch, es wär die Magd. Zu Morgen saß der Beck, sein Knecht und die Magd bei einander in der Stuben und aßen ein Suppen. So trat die Frau in die Stuben und spricht: ,Mein Mann, du issest billiger ein gut Ei im Schmalz und etwan zween, dann ich hatt das zu dir nit versehen, daß du in einer Nacht bist also zu zweien Malen freudig. Warumb han ich mich nit langost in der Magd Bett gelegt! Du bist je länger, je freudiger.' Da ward der Beck verstan und gab dem Knecht und der Magd Urlaub und weigeret ihren Lohn. Da verklagten sie den Becken vor dem Bürgermeister, und der Beck ward beschickt. Also ist dieser Handel offen worden. Doch ward der Knecht auf dem Rathaus für dem Meister gelobt von der Frauen.“
In das Gelächter, Glucksen und brodelnde Behagen klangen die letzten Glocken. Und keiner hörte die Stunde als der junge Mönch. Ihm kam das Ave wie ein Freundesruf, der einen wüsten Traum zerwirft. Es gab ihm Mut, daß er aufstand und vorgebückt aus dem Saale lief, als müsse er hinter schützendem Buschwerk dem Feinde entfliehen. Seine Hände lagen zitternd auf dem Herzen, er flüsterte:
„Heilig Jungfrou, sije bedankt, daß du mich host erlöst!“
Im Hofe des Klosters war alles still. Ein Wächter stand unter der Seitenpforte der Basilika und gab dem Mönche den Weg in das Kirchenschiff frei.
Der junge Mann sog die schwere Luft gierig ein. Der hohe Raum war von rotem Lichte erfüllt, und Schritte der beiden bewaffneten Ordner, die das Feuer der Opferstände zu hüten hatten, schauerten durch die Stille.
Er hastete nach dem Hochchor und warf sich auf die Stufen des Altars. Die Gebete der Completzeit fielen ihm von den Lippen, ohne daß er ihren Inhalt merkte. Er krümmte sich noch unter der Gewissensmarter der letzten Stunden. Und dann wußte er, daß die Gebete gesprochen waren. Sein Herz war gelöst, er konnte es entladen.
„Herr! Complete Zit! Tu uf die Pforten des Abgrunds und loß sie schlücken, daß sich die Höllen mäst, dann siehe, das Wild ist feist!
Complete Zit, Herr Gott! Wir sänd all gel vom Brand der Weltsunn als die Frucht des Felds! Schick üns: der niederschneidet und verbrinnt, dann alls ist toub und vom Unkrout ersticket!
Wo ist din Stein, Herr, wie ein Mühlstein in der Hand dins stärkisten Engels, daß er die groß Hur zermalmet: Wehe, es ist der Drach los! Alls brinnt vor Sünden!
Warumb gibest du kein Schwert mir in das Moul, daß es die Heiden schlüg! Warumb so bin ich ein siden Fähnli in dem Wind ihres Speiwerks und ihrer Wollust und bin kein Fels nit, darab sie zerspitteren!
Du hast mir das Wort inton, das süeß schmecket, do ichs uf der Zungen spür, süeß und ein Füer, als die Rache des Gewissens. Aber do ich es verschlungen, krimmet es minen Bouch, die bitter Not des Gewissens, und wird nit erlöset!
Ich muoß sie sehen, und min Herz zittret, der Mund aber ist versieglet, und die Ougen decket ein Schleier vor Menschenfurcht.
Ich sehe des Tüfels Hörner us ihren hochen Stirnen brechen, die eine Zung hänt, triefend vom Weine des Weltwissens, und die Ougen hänt, als sijen sie des heiligsten Gottes voll.
Ich hör das Glächter der Höllen us ihnen brechen, deren Bluot feist ist vom Tran der Wollust, und deren Händ nach dem Fleische zitteren.
Und du gibest mir nicht din Tou uf mine lechzinden Lippen, nur eines Fingers Spitz, und umb mich her brinnt die Höllen!“
Er preßte sein Gesicht gegen die kalten Steine und schluchzte. Und er lag eine Zeitlang in tiefster Ermattung. Ihm war, als schwebe er zwischen Eis und Flammen im Sternenraum.
Ein klirrender Schritt erschreckte ihn. Der Knecht drückte ein verlechzendes Licht aus, entnahm dem vollen Opferkasten eine Kerze und pflanzte sie auf den Stachel.
Der junge Mönch hüllte sein Gesicht in beide Hände und erhob sich. Er atmete tief, als sei er wunderbar befreit, sein Herz schlug, als habe es ein Leben überwunden. Er wußte nicht, wie lange er gelegen war. Seine Knie knickten noch einmal vor dem Allerheiligsten zusammen, er wollte die Kirche verlassen; da trieb es ihn vor die Gnadenkapelle. Sehen, nur sehen! Er sah den goldgepanzerten Mantel und Schleier. Das Perlenschimmern und Glitzern der Steine. Unter der schweren Krone das rosige Gesicht, die kleinen Schlitzaugen, die hochmütigen Brauenbögen, das Mündlein mit den satten, gleichgültigen Lippen, die glatte, gedankenlose Stirn.
Die Kiefer des jungen Mönches schlotterten, ihn fror in der schwülen Luft. Seine Augen standen weit offen und maßen die Reichtümer, glitten immer wieder zurück zu dem hölzernen Gesicht, dessen lauernde Unberührtheit Gedanken weckte, die ihm die Haare sträubten. Er fühlte den Drang und die Unermeßlichkeit der Gebete, Seufzer, Hoffnungen – alle an diesem Bilde aus Holz und Stein zerschellend. Lüge! Sie alle opferten ihrer Seelen heimlichsten Brand der Himmelskönigin nicht, deren Reinheit sie nie begriffen. Sie opferten ihr Innerstes dem Holzbild auf, das sie mit schwülem Prunk betäubte, durch geile Sattheit demütigte.
Der Mönch ballte die Fäuste. Seine Augen liefen voll. Lüge, Lüge und Ausgeburt des Schreckens der Lüge vor ihrer eigenen Erbärmlichkeit! Das – das zwingt vor einem toten Holz in den Staub. Der Adlerschrei des Gewissens gellt über ihnen, und sie beten das geschnitzte Holz, die geschliffenen Steine, das Gold, ihr Gold, und die gereihten Perlen an, daß der Schrei des Gewissens in ihnen verstumme.
Der junge Mönch schloß die Augen. Zorntränen stürzten über seine Wangen. Seine Hände streiften einander, als wolle er sie vom Schmutze reinigen.
Dann schlug er seine Hände vors Gesicht, schritt eilig durch die Kirche, über den lautlosen Klosterhof, in den Schlafsaal der Abtei. Dort holte er aus dem Strohsack seines Bettes ein Beutelchen mit Geld und verließ das Kloster.
Er ging über den Brühl, durch die Wagenburg und die Gasse nieder. Überall aus den offenen Fenstern scholl der heisere Lärm der Betrunkenen. Die Gasse war erfüllt von lachenden, schreienden Leuten.
An einem Wirtshaus hing ein Wams aus, zum Zeichen, daß hier aufgegebene Pfänder feil seien. Dort erstand der Mönch ein Lederkoller und einen kurzen Spieß.
Und er wanderte rüstig talab. Seinen Weg beleuchtete der Mond, und der Biberbach rauschte bald lauter, bald leiser.
Ihn umfing die große Wundernacht des neubürtigen Lebens. Keine Regung hielt ihn zurück. Sein Gelübde war von ihm gefallen.
Wohin er trieb – er wußte es nicht. Aber ihn füllte ein heiliger Jubel. Er wußte, daß ein reines und befreites Herz nicht verderben kann.
Im Ausschreiten, da er den Spießschuh kräftig gegen den Boden stieß, während der Biberbach die laute und stille Weise rauschte, hob es sich von seinen Lippen wie ein junger Vogel:
„In Gottes Namen solltu sin Min Mantel, tiefe Nacht.
Ich fahr ins nüe Leben in,
Vom Herzen ohnbedacht.
Mich keine Regul führt nit mehr,
Mins Gloubens will ich blühn,
Der Gnaden Gotts allein ich gehr,
Die sollt min Weidschiff sin.
Nu kumm, du Tag,
mit guetem Streit,
Ich biet dir frumm die Hand,
Do mines Herzens fri Bescheid
Baß ist dann Münchsgewand.“