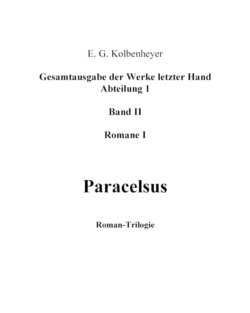Читать книгу Paracelsus - Erwin Guido Kolbenheyer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Reinigung und Verheißung
ОглавлениеDer Predigtglocke winkendes Geläute wurde bald überhört. Neue Pilgerscharen kamen, und jene, die eine weite Heimfahrt hatten, zogen nach wenig Tagen wieder ab. Die Predigtglocke bekam einen schalen Ton. Von den Wirten und Kaufleuten wurde der neue Zuzug mit kurzen Blicken abgeschätzt. Kaum eine Spur von einladender Liebenswürdigkeit lag mehr in ihren Augen. Alle wußten bereits, mit welchem Gewinn sie die heißen Tage bestehen würden.
Der dichte Pilgerstrom kreiste nicht mehr vor der Gnadenkapelle. Eine breite Insel, lagen sie vor dem Altar aufgestaut, und je länger sie knien und beten konnten, desto spärlicher hatten die Trichter der Opferkästen zu schlucken.
In den Bänken saßen die Mönche, müde, von der Hitze gedrückt, sie lauschten vorgebeugt der endlosen Beichtmühle. Immer dieselben Worte. Eigentlich hörten sie nur mehr jene Sünden, die auf zwei Jahre zurück zu dämmen waren. Gelegentlich solcher Sünden gewann ihre Zunge eine leichte Anregung und sie sagte stets das gleiche von Rom, Jubeljahr, Heiligem Vater, Absolution, und über die Vorstellungskette der Absolution rasselte die Erregung des Sprechtriebes wieder ab; erst wenn der Sünder endgültig verstummte, erwachte ihre Zunge wieder und erteilte Buße und Befreiung.
Jener Augsburger Bruder hatte großen Zulauf. Seine Freikanzel, dort wo die Geißler geblutet hatten, war dicht umlagert. Er hielt einen Predigtenkranz über die Wunden und die Freuden Mariens, jeden Tag über eine Wunde oder eine Freude abwechselnd. Und an den Wundtagen wurde nicht weniger gelacht als an den Freudentagen.
Theophrast fand in dieser Zeit, da eine buntverdichtete Welt ihn umkreiste, über einige Dornzäune heil und erwachter zu den Seinen zurück.
Die Leute drängten sich um die Drille und waren über die Grimassen erfreut, die ein Bruder Sundfeger schnitt, während ihm in seinem wirbelnden Gefängnisse todübel wurde. Die Drille stand neben der Etzelstraße, sie war ein Käfig, der leicht auf einer Spindel gedreht werden konnte. Brach irgendein Landstreicher durch den Zaun der Ordner, die Wege und Stege besetzt hielten, und suchte er etliche gute Tage im Schatten der Gnadenmutter durch freiwillige und unfreiwillige Gaben zu erstehen, so mußte er seine Kunst meistern, sonst wurde er gefaßt und in die Drille getan. Und es gab kaum einen Jungen, der nicht sein Bestes drangesetzt hätte, so lange mitzudrehen, bis dem Gauchen das Innerste nach außen geschleudert war und er besinnungslos auf dem tanzenden Boden des Gefängnisses hinschlug. Dafür standen immer etliche Heller zu erwarten. Aber es gab nur wenig Pracher, die nicht in Ehren bestehen wollten, auch sie konnten etliches von den Belustigten erhoffen, wenn sie kräftig aushielten. Und so kam es zu einem Kampf zwischen den treibenden Jungen, die einander ablösten, und dem allmählich erblassenden Gartbruder im Käfig.
Als Theophrast sich glücklich durch die Großen und Kleinen vor der Drille durchgezwängt hatte, war der Kampf eigentlich schon entschieden. Etliche schworen, der Vagabund werde kaum mehr ein Dutzend Runden aushalten. Und man gröhlte befriedigt, da er, mit seinen letzten Kräften in den Stäben hängend, taumelig, kreideweiß, mit hervorgetriebenen Augen, noch die Kraft fand, seine Zunge zu blecken. Allein die Anstrengung blieb nicht ohne Folgen. Kreischend, johlend vor Vergnügen, stürzten die Leute zurück, rannten einander um und rollten auf der Erde: dem Gedrillten entfuhr der Mageninhalt in weitem Gusse. Dann schlug er hin, und man warf den atemlosen Jungen lachend etliche Geldstücke zu, ließ auch einige in den Käfig springen.
Theophrast sah das voll Staunen. Er merkte erst, als die Leute auseinandergingen, daß ihn die kleine Seiltänzerin am Wams zog.
Er hatte mit der Mutter einmal in dem eingeblachten Raume der Vorstellung zugesehen. Von einem Feuerfresser war er tief erschüttert worden. Die Kleine aber zeigte in einem roten Fähnlein, das über und über mit Glasperlen benäht war, nur solche Kunststücke, die sie wohl beherrschte, und der schwarzhaarige Meister setzte ihr weiter nicht zu. So hatte sie in Theophrast keinen sonderlichen Eindruck hinterlassen. Ihm war bang geworden, als sie aufs Seil sprang, dann aber warf er sein Geldstück ohne Befangenheit in ihren Zinnteller. Nur die beiden vergeudeten Böcklein wurmten ihn heftiger. Doch sagte er der Mutter nichts davon.
Da nun die kleine Tänzerin neben ihm stand und seinen Brotbeutel begierig musterte, sah er sie feindselig an.
Doch sie lächelte und flüsterte:
„Nimm dein schön Haller! Kauf Bockeli, gut Bockeli.“
„Du Gugelvolk, loufst eimweg! Dir sollet ich eins weisen!“
„Nit schimpf, nit zank, Bockeli kauf!“
Sie nahm ihn bei der Hand, und er folgte widerwillig. Hinter einem Strauch kauerte sie nieder und deutete einladend daneben auf den Rasen.
„Zeig dein schön Haller, gut Bübli.“
Sie schlang ihren Arm um seinen Hals und preßte ihre Wange an die seine. Theophrast aber stieß sie heftig fort, und sie ließ sich ins Gras fallen, blieb liegen, vergrub das Gesicht in die Arme, als habe er ihr weh getan. Da wurde es dem Büblein bang, es kniete zu ihr, faßte das dichte Kraushaar und wollte ihren Kopf wenden, um zu sehen, ob sie spiele oder wirklich weine. Sie warf sich blitzschnell um, lachte und fuhr mit hurtigen Fingern in den Brotbeutel, nahm was sie greifen konnte und rannte davon. Sie hielt das Seidentüchlein in der Hand. Und in das Tüchlein hatte die Mutter die schönen Haller gebunden.
Er jagte ihr nach, fiel einmal hart über sein Schwert, so daß die kleine Diebin einen guten Vorsprung gewann. Er gab nicht auf. Sie rannte einigen Jungen zu, die ihrer unweit zu warten schienen, und stellte sich hinter den stärksten.
Theophrast hielt ein und kam das letzte Stück zögernd näher.
„Die soll min siden Tüchli geben“, rief er.
Die kleine Schlange aber schmiegte sich an den Wilhelm Fenkh, den Ältesten vom ,Weißen Wind', und keifte:
„Er zank, er schimpf und will slak!“
Da entschied der Wilhelm Fenkh: „Du muoßt ein Buoß zahln.“
Theophrast pochte auf sein gutes Recht: „Ich zahl kein Buoß nit umb das Gugelvolk. Sie hats us min Bütel gstohln.“
Wilhelm Fenkh meinte mit großem Ernst: „Willtu ein Schwert führn, und loßt dir usm Bütel stehln?“
Theophrast drohte: „Min Vater wird iich weisen!“
Wilhelm Fenkh nahm der Kleinen das Tüchlein ab und entschied:
„Din Vater sollt miner müßig gan.“
Da sprang Theophrast unversehens zu und entriß dem starken Bengel das Tuch, fuhr damit ab. Es glückte nicht weit. Einer warf ihm seinen Prügel zwischen die Füße. Theophrast schlug hin, und die ganze Horde lag über ihm mit Knuffen und Tritten. Er deckte sein Tüchlein mit dem Bauche und schrie:
„Helfet, guete Lüt, helfet!“
Etliche Große blieben auch bei dem balgenden Haufen stehen und meinten, dem Theophrast geschähe recht, da er dem Wilhelm Fenkh das Tuch entrissen.
Endlich vermochte der kleine Mann die Prügel nicht länger zu ertragen, er mußte sein Tuch freigeben. Die anderen rannten mit ihrer Beute fort, und er lag übel zerrissen, eingepulvert, mit schmerzenden Gliedern im Gras und heulte den guten Hallern und dem Tüchlein nach. Dann saß er lange und konnte nicht verstehen, wie er um sein gutes Recht und zu harten Prügeln gekommen war. Da er die Augen wieder hob, sah er die Räuber in Ordnung zurückkehren, sie trugen kurze Spieße, und in ihrer Mitte wehte an einem langen Stecken das Seidentuch.
Er stand auf und schlich beiseite und mochte zunächst das flatternde Fähnlein nicht sehen, so bange war ihm danach. Es war ihm nie so bunt und schön vorgekommen als jetzt auf der Stange seiner Räuber. Oft hatte er es dem gleichen Zweck zuführen wollen, aber der Mutter wegen nie gewagt, den Schatz so offenkundig vor aller Augen zu tragen. Immer meinte er, man müsse ihm sonst das linde, seidene Ding wieder abnehmen.
Heimlich wandte er sich noch einmal um. Sie waren nahe gekommen, und er entdeckte, daß ein Loch mitten in das Fähnlein gerissen war. Ihm wurde angst. Wenn die Mutter das Loch merkte … die Mutter … er fühlte erst, was ihm geschehen war.
Wenn die Mutter nach dem Fazenettli früge? Sie hat selber die Haller eingebunden. Nun sah er auch, wie sehr sein Wams von Staub und Schmutz besudelt war, und sein Ärmel hing in Fetzen. Wie sollte er den prüfenden Augen entgehen? Anders wars mit dem Änderle gewesen. Niemand hatte ihm angesehen, wenn er mit dem Änderle im Walde war. Und den verschluckten Vogeleiern, die oben und unten aufgepickt wurden, ehe man sie austrank – denen konnte niemand mehr nacheifern. Dem Theophrast kams vor, daß eine Schuld erst peinlich werde, wenn man sie merke. Und er sann nach, wie er sein verschmutztes Wämslein reinigen könnte.
Er kam auf den Frauenbrunnen, denn er hatte die reinigenden Kräfte des Wassers zuweilen heftig am eigenen Leibe verspürt. So schlenderte er ein wenig verzagt und versonnen, da sein Versuch mißlingen konnte, den beiden großen Türmen zu, blieb da und dort stehen, besah immer wieder sein Wams, ob es nicht doch erträglich wäre, erschrak stets und machte sich wohl oder übel an seinen Plan.
Die vielen Rohre des Frauenbrunnens sprudelten das Wasser in einer bequemen Höhe aus, daß die Pilger beim Trinken sich nicht allzu tief neigen mußten. Theophrast stand eine Weile, er wollte abwarten, bis niemand mehr von Rohrmund zu Rohrmund ginge, um andachtsvoll auch an jenem Lauf des heiligen Quells die Lippen zu netzen, den der Heiland nicht verschmäht hatte. Allein der Brunnen wurde nie frei. Also faßte Theophrast – als nur drei Weiber tranken und kein Ordner in der Nähe schien – ein Herz und sprang unter die Strahlen. Die Weiber wollten erst seinem Übermute wehren, da sie aber sahen, daß der Theophrast bescheiden sein brennendes Gesicht und sein Wämslein wusch, meinte die eine: „Sehet den Knaben!“ Sie glaubte, er könne sich des heiligen Gewässers nicht ersättigen.
So wurde der kleine Mann in kurzer Zeit von Kopf bis zu den Füßen triefnaß und er wäre standhaft geblieben, wenn nicht einer der frommen Frauen die Sache doch bedenklich geschienen hätte. Sie faßte ihn und entzog ihn dem Wasser.
„Gang, Büebli, was kummt dir an mit so narrechter Täding?“
„Ich wollet min Wammes Wäschen.“
„O du Narr, gang hoim, sust möcht dir ein Pestilenz ankummen!“
Es fröstelte ihn, und er sah, wie sich um seine Schuhe eine Pfütze sammelte, die beklemmend an Zeiten erinnerte, wo derlei Wässerlein verübelt worden waren. Die dringliche Stimme der Frau nahm den letzten Rest seiner Sicherheit, und er merkte, daß kein guter Stern über dem Unternehmen stand.
Was sollte er tun? Das Wämslein schien nicht sauberer, er aber floß, als sei er in die Sihl gefallen. Es blieb nichts übrig, als demütig heim zu ziehen.
Auf dem Weg erlebte er die Genugtuung, daß die fließende Nässe allmählich versiegte, seine Fußspur wurde unmerklich. Mit dieser Entdeckung kam ein glücklicher Gedanke. Am Ofen trockneten die Großen ihre Mäntel und Koller zur Regenzeit. Er beschloß in die oberste Höllen zu kriechen und dort zu trocknen. Heimlich hoffte er, daß die Mutter nicht in der Küche wäre.
Er hatte Glück und erstieg unbemerkt das Höllenbänklein, hoch zwischen Wand und Ofenturm. Warm wars genug, da konnte keiner klagen. Und wie er nach einer regelosen Weile seiner sicher wurde und die Augen kecker schweifen ließ, gewahrte er in greifbarer Nähe auf dem Ofenturm zwei verdeckte Bretter, die dörrende Apfelschnitze trugen.
Niemand nimmt ein Glück für unverdient, nur das Unglück trägt den heimlichen Stachel des Schuldgefühls in sich. Die dörrenden Apfelschnitze sprachen Theophrast beruhigender zu, als etwelche Anerkennung seiner vergeblichen Tapferkeit und seiner unverschuldeten Leiden es vermocht hätte. Er nahm und aß wie ein Mann, der sagt: „Seht so bin ich: zuerst eine redliche Arbeit, aber dann auch einen günstigen Griff ins menschliche Behagen, denn Gott gibt den Seinen gerne.“
Die Kleider des Theophrast begannen zu dunsten und rochen warm. Er blinzelte hin und wieder auf sein Bäuchlein, ob es die dunkle Wasserfarbe schon verlöre, und er streifte den letzten Vorwurf, der ihm noch am Halse hing, seinen leeren Brotsack, mit einem frohen Entschlüsse ab. Es lebte sich leidlich auf dem warmen Höllenbänklein, umgeben von den Dampfwolken verflüchtigender Sünden, in handlicher Nähe des Hutzelobstes, das seine Süßigkeit hinter einem sanften Leder im warmen Fleische sammelte.
So hätte er lange sitzen können, ihm fehlte zu seinem innigen Behagen nichts, und er wäre endlich auch trocken geworden. Im Ochsnerhaus, wo jeder Gegenstand an die Seinen mahnte, wäre ihm sicherlich bange gewesen. Dort lag eine strenge Zucht in der Luft. Aber hier im Pilgerspital war er so frei wie im Walde; und er genoß die Unbeschränktheit dieser neuen Welt.
Theophrast durchwitterte noch überall die Andersart der Dinge. Die Tische da unten: wunderlich genug, daß sie den gleichen Dienst taten wie die des Ochsnerhauses, obwohl sie ganz anders aussahen! Und Fremdes überall. So oft bewog ihn nur die Sicherheit, mit der die Großen an den Dingen schafften, eine Sache brüderlich dem Gleichgearteten des Ochsnerhauses anzureihen. Auch er kam, da er scharf zusah und darum mehr schied als willig glaubte, wie jeder Große, auf seinem Umweg hinter das Wesen des Ungewohnten. Mag die Fremde immerhin den bedrücken, der eine letzte Entspannung seiner ermüdeten Triebe und einen unbedingten Schutz sucht, sie befreit auch von den heimlichen Gesetzen der Gewohnheit, die langsam aber sicher Herr über jeden werden, und habe sie einer vom Grund aus selber geschaffen.
Theophrasts Herz ward leicht auf dem Höllenbänklein im Klosterspital zu Einsiedeln und er schmauste das Hutzelobst ohne Gewissensbisse, bis er Schritte vernahm, die er kannte. Da erschrak er und ließ den eben angenagten Schnitz fallen. Die Mutter sah sogleich; das Unheil war ihr vor die Füße gerollt.
„Frästeli!“
Theophrast duckte sich in den hintersten Winkel der Hölle. Alles Ungewitter der letzten Stunden türmte sich drohend vor ihm.
„Frästeli, du bist in der Höll und tuest Huzlen in?“
„Mammeli, ich muoß in der Höll sitzen!“
„Was muoßt?“
„Daß mir alls wieder trücknet.“
Die Mutter tastete über ihn.
„Bi Gott, du bist naß! Wo bist gsi?“
Da faßte Theophrast ein Herz und rief:
„Es ist ein großer Regen an mich gfallin!“
Die Mutter sah ihn an, daß er schon widerrufen wollte, da streifte ihr Fuß den Brotsack, sie hob ihn auf. Man hätte ihn auswinden können. Und sie sah nach.
„Wo ist’s, das Tüechli und dine Haller, so ich dareingebunden?“
Theophrast schöpfte tief Atem und rief:
„Es ist ein großer Wind an mich gfallin, der hots usm Sack grissen.“
„Kumm, Büebli, ich will dir Wind und Wetter gewiesen han!“
Sie zog ihn vom Höllensitz, und er sperrte sich nach Kräften.
„Ei, du bist all in Fetzen, wer hot dich allso schändlich zuogricht?“
Theophrast schwieg.
„So uf einmal Regen und Wind an dich gefalln, möchts och der Dunnerschlag gewest sin?“
Theophrast sah ein, daß er nie auf solch einen günstigen Gedanken gekommen wäre. Er stand mit gerunzelter Stirn vor der Mutter, blinzelte sie keck an, denn er meinte, die ärgste Gefahr sei nun vorüber.
„Als möchts der Dunnerschlag gewest sin, Mammeli.“
„Dann solltu och ein letzt Ohngewitter guet bestahn“, rief die Mutter und spannte die Höslein.
„Holt in, Mammeli, sie hänt mich allweg!“
„Du host diner Mutter ein Luog geben!“
Da brach es schluchzend aus ihm:
„Nu ist das seidin Fazenettli verton, und die Haller sänd hin! Du sollt darumb nit klagen, dann sie hänt ein Fähnli darvon gmacht, das wehet im Wind, und hänt guet Böckli kouft, die schmeckend ihn’n sehre.“
Weil nun Eis Ochsnerin sah, er wolle sie trösten, hielt sie wirklich ein, hob ihn auf den Tisch und erforschte sein Mißgeschick. So kam alles an den Tag.
Die Mutter wußte nun, daß er schwer hatte kämpfen müssen.
„Du bist ein Tippei überalle und loßt dir von eim Maideli stehln. Du sollt dich schämen. Kumm, so wird din Kleid nimmer trucken. Du muoßt untern Kolter, ufdaß du dich besinnest uf dine Torheit.“
Theophrast stieg an der Mutter Hand die Treppen hinauf. Ihm war so leicht und frei zu Mut, daß er hätte singen und schreien mögen. Sie war gut, sie war viel besser als alle andern, sie hatte ihn nicht geschlagen, und ihm waren doch das Fazenettli und die Haller gestohlen worden! Sie wußte alles und er brauchte nicht mehr daran zu denken.
Als er entkleidet war und unter der Decke steckte, breitete er, da sie mit dem nassen Gewände in die Küche wollte, seine Arme nach ihr aus und hielt sie.
„Mammeli, so einer ist ein Tippei und allso ringmüetig, muoß er unterm Kolter stecken bliben und darf nit usschlupfen und nit ein Bein regen. Und muoß diner wartin.“
„Nu louft dirs Moul über! Der heilig Brunn möcbt dir kein Leids nit ton haben, und ich will bitten, daß du gstundist unter dem rechten Strahl und Gott dich erlücht.“
„Es möcht wohl der recht Strahl gewest sin, Mammeli, dann er ist mir an die Hout gfahrn.“
Die Mutter ging, und Theophrast lag regungslos unter dem Kolter. Er dachte an Mutter und Vater, an all die Seinen im Ochsnerhause. Nie noch war ihm so friedvoll und sicher zu Mut gewesen.
Sing deinen Zauberreim, Blut, der fest macht und beständig vor dem Gemeinen! Sing dein Lied, das einzige Schlummerlied der kämpfenden Seele, die an ihren Grenzen wund geworden ist! Deine Welle führt den Trost von hundert bestandenen Fehden mit, weither, hundert Geschlechter weit. Keine Kraft war an dir verschwendet. Sing dein Lied, du reifes Blut, Blut der letzten Wellen, die am lautesten, schönsten singen! Bombastblut, sing, singe, du bist alt geworden und also mündig!
Während Theophrast gereinigten Herzens unter dem Kolter lag und diesem seltsamsten Liede lauschte, war sein Vater in die Küche gekommen, wo die Mutter das durchnäßte Gewand am Ofenreck aufgehangen hatte. Herr Wilhelm warf seine Tasche auf den Tisch, daß es klirrte. Die Mutter sah fragend hin, der Mann ging zornblaß auf und nieder. Frau Eis wußte: sie durfte jetzt nicht gehen, ohne ihn gehört zu haben, sie durfte aber auch nicht fragen, sondern hatte ruhig irgend etwas zu schaffen, das nicht zu laut und nicht zu leise wäre, als sei alles in guter Ordnung. Sie zog an den trocknenden Kleidungsstücken, daß sie nicht schrumpften, maß Hirse in den Breikessel, goß Milch und Wasser dazu, legte die Glut frei und schob harziges Spanholz von allen Seiten auf das rote Häufchen. Bald flackerte es unter leisem Knistern. Zum Glück begann Bombast, denn sie war fertig.
„Nu ist mir sine Gnaden guet entfahrn, Graf Eitelhans zu Barbi uf Brunsberg und Biberlingen, daß ihn der Tuifel schänd! Der hat mir zwenzig Guldin verheißen, so ich ihn von sinem Grimmen erledig, und ich hab min oleum glesi drufgesatzt bis uf den letzten Tropf. Nu ist er entwischt. Der Wirt vom Pfauen hat ihm noch ein silbrin Wehrgehäng verpfändt. – Er lässet mir ein günstigen Grueß bstelln, und ich sollet nit murren, dann er wollet bi günstiger Gelegenheit mir nit zwenzig, sundern an fünfundzwenzig Guldin schicken. Do sulln wir satt sin von siner gräflichen Gnaden! Und ich muoß uf Zürch, so guet es will gohn, daß ich ein Bernstein kouf und mir ein nüs oleum destillier. – Ei Frou, zu dreien Malen bin ich Tag vor Tag bi dem Gauchen gewest, hab ihn purgiert und die Ader gelassen. Hab ihn ouf die Füeß gestellt, dann er ist allbereits übel gelegen. Und ist ihme ein Stein abgangen als ein Nuß groß. – Eis, gib ein Trunk und Bissen, daß sich mine Gail nit verschlägt. Ich will froh sin, dann diese Tag sänd umb.“
Eis war flink mit Trunk und Imbiß bereit, und Herr Wilhelm meinte, indem er kaute:
„Do sänd wir um ein Merkliches geschmäleret von dem Gouchen.“
„Laß guet sin, Bombast.“
Eis streifte wieder die Kleider des Kindes aus, und der Vater fragte, da er fast sein ganzes Frästeli am Ofenreck hängen sah. Sie erzählte ihm das Abenteuer.
Bombast saß auf der Bank, eine Falte zerschnitt seine Stirn zwischen den Brauen, da seine Eheliebste meinte:
„Mir ist nit allerweg heimelich bi dem Kind. Er fraget viel und er luogt ohnbedacht. Ich kunnt nit glouben, daß es mit dem Männli am Orgelchor menschlich sije gewest. Es ist ein heiliger Ort, do solltu nit din Kopf schüttlen. Es kunnt ein Wunder geben, ohn daß einer des gewahret.“
Sie strich verlegen über ihr schlichtes Haar hin und bekräftigte: „Und ist desglichen unter dem heiligen Brunnenstrahl trieben worden. Meinest, dem Bübli sije dasselbig us ihme selbs zuogfallin? Ich gloubs nit. Es war der heilig Strahl! Unser Frästeli ist sunderlich, mir banget umb sinetwillen.“
Sie rührte im Kessel und wagte nicht recht zu ihrem Gatten hinüberzusehen, denn sie offenbarte des Herzens Heimlichkeit nicht gerne, kaum vor dem eigenen Gewissen. Sie war im tiefsten Wesen keusch und jungfräulich. Der Mann befremdete sie und scheuchte sie in sich zurück. Nur ein drückendes Bangen brachte die Worte über ihre Lippen, denn sie erkannte in dem Kinde bereits den Mann. Aber sie hätte auch diese Bangigkeit allein getragen, wenn nicht Bombast auf anderes Sinnen hätte abgelenkt werden müssen und – wenn er nicht seines Zornmutes entladen gewesen wäre. Denn Herr Wilhelm konnte aus der Enge seines Alltags zuweilen gewaltig aufbrüllen, so besonnen und schwergemut er sonst blieb.
Als sie ihn kennen lernte, war er der Fremde überdrüssig und hatte sich die Ruhe des Ochsnerhauses und das gesicherte Leben voll Behagen durch den Leib blühen lassen. Aber nun erschreckte er sie manchmal mit einem Ungestüm, das sie nicht fassen konnte. Nahm er sie dann in seine Arme, preßte er sie und liebkoste sie so wild, als sei er ein Jüngling, wagte sie kaum den Drang zu erwidern und glaubte beinahe, er wollte ihr auch mit seiner Liebe ein Leides tun.
Herr Wilhelm sah finster drein. Er war zu oft durch die Sternnacht geritten. Auch er wußte, daß jene funkelnden Gewalten mit bildender Influenz den Menschenleib durchdrängen, aber er fühlte, daß sie die äußersten Maschen und Knoten seien, darin eines Menschen Leben befangen ist. Der große Gott, dem ein Sternhaufe kaum des Schöpferwinkes wert war, konnte keinen Engel gesendet haben, um das Frästeli zu bewahren. Aber Bombast ließ der frommen Mutter den Glauben unbenagt von Worten, er hielt ihn für einen Trost. Denn er sah, daß ihr der Sohn entwuchs.
Wilhelm Bombast meinte nur:
„Das seh ich wohl, er fallt in dieselb Beschwer dann ich, do ich jung war und ein Kind. Er findt kein Gefährten nit. Und sie wollend ihn nit. Schlahend und schätzen ihn, solang er ist schwach und kann sines Leibs ihrer nit erwehrn. Die Menschen sänd als das Viehe. Was nit alle Siegil und Märk ihrer Art treit öffentlich, das wollend sie erstoßen und zertreten oder sie fliehends als die Pest, und brächt einer das bluetend Herz dar. Ihm müessend die Zeichen manglen der Herd. Wohl dir und wehe, du kleiner Mann! Allein – wirdu allerweg din Muotterle han, so dir dine nassen Kleider wird trücknen?“
Es fielen ihr Tränen von den Wimpern, des Mannes Rede klang schwer. Sie legte ihren Arm um ihn, das tat sie selten. Er fuhr ihr lind übers Haar, doch sah er an ihr vorbei, als stünde die verräucherte Wand nicht vor seinen Augen.
„Elsula, des solltu nit so bekümmert sin. Ich hab in sinen Jahren kein Muotterle ghät und kein Vater. Hab müessen singend gohn und bin dannocht miner Kunst ein Wohlerfahrner worden, daß sie üns ernährt.“
Eis Ochsnerin hielt ihre Tränen zurück, weil sie merkte, daß ihres Mannes Gedanken einen andern Weg flogen. Sie hatte nicht geweint, weil ihr um die Menschenart des Söhnleins bangte, sondern weil ihr manchmal sterbensmüde war und sie vor einem frühen Ende zitterte, das die Ihren verwaisen möchte. Sie schwieg aber und wollte das alte Lied des Bombast nicht hören. Sie hing zu sehr am Ochsnerhaus und an dem Rauschen der Sihl.
Nach dem Pontifikalamte des letzten der drei Festsonntage – der Legat hielt es – wurde die große Engelweih mit eidgenössischen Spielen beschlossen.
Geblieben war nur, wer ein Stück Geld übrig hatte und die Heimfahrt bei bequemer Gelegenheit zu Roß und Sänfte leichter nehmen konnte. Den Wirten lag für diesen letzten Tag ein auserlesener Rest im Keller, und die Küchen dunsteten erquicklicher als an den Tagen des Massenfutters. War auch allezeit tüchtig eingeladen worden, so wußten die Wirte, daß am letzten Sonntage nur im Besten geschlemmt und gedämmt werde, soviel nur die Haut hielt. Zuvor aber eine ehrliche eidgenössische Arbeit.
Die Armbrust- und Hakenschützen zogen unter Pfeifen und Trommeln zu ihrer Zielstatt, weither vom Zürchersee, aus Schwyz, Luzern und St. Gallen waren noch etliche zugestoßen. Und jedem Zug der Männer folgte je einer der Knaben in guter Ordnung mit Armbrust, Spieß und Hellebarde, die Kurzwehr an der Seite. Es gab kleinbeiniges Volk darunter, das gewaltig ausgreifen mußte, um Schritt zu halten, Jungen, die kaum ins achte Jahr sahen, aber gleichwohl trotzig und ihrer Wehr sicher, als wüßten sie eines freien Kriegsvolkes Zukunft in ihren Herzen.
Für diesen Tag war Hans Ochsner seines Harnisches ledig, er trug den langen Spieß und das Schwyzerschwert zu anderthalben Händen. Das war sein Eigentum und sein Bekenntnis. Das blanke Plattenwerk und die silberne Hellebarde gehörten dem Kloster. Er wartete auf die Stunde, da er des Spieles mit Spieß und Schwert ledig wäre, dann sollte er, befreit vom engen Kleide, ein kraftausschöpfendes Schwingen bestehen.
Denn es war der Züricher Wälti Kochenribly aufgefahren und der Cläui Küng von St. Gallen. – Als die beiden ausgewittert hatten, auf wen die Schwyzer zu Einsiedeln sahen, krähten sie den Hans Ochsner an wie junge Hahnen, die dem andern das gackernde Volk neiden. Sie waren vorher untereinander eins geworden und dann zu Hans Ochsner gestoßen, der unter dem Wechseltor lümmelte, die Arme an seiner Hellebarde verschränkt.
„Du sollt der Hans Ochsner sin“, rief ihm Wälti Kochenribly von Zürich zu.
„Sollichs ist mir wohlbekennt und reuet mich gar nit“, war die Antwort.
„Ich bin der Wälti Kochenribly ze Zürch und hie derselb ist der Cläui Küng von St. Gallen. Wir sänd einig und möchtin ein Tanz in der Schwinghos tuen uf dieser Kilby ze Einsiedlen.“
Hans Ochsner maß den Cläui Küng, vom Kochenribly hatte er gehört. Er sagte bedächtig:
„Ihr wollet ein Tanz tuen? Der soll üch nit verwehrt sin.“
„Des gehrend wir kein Urlob nit von dir“, fuhr der kurze Cläui Küng dazwischen.
„Du sollt kein schlechter Einsiedeler Habersack nit sin, den einer umb die Achsel schwinget“, meinte Wälti Kochenribly.
Hans Ochsner lachte.
„Ihr beiden, üch sollet ich wohl in den Dreck riben, daß keiner nit wisset, welicher sije von Zürich und welicher von St. Gallen.“
Der Kochenribly gab dawider:
„Ho, wir händ es wohl vernommen, du hast allbereits ein Büebli niederbracht im Schwingen, das sollt an zehent Jahr gwest sin unde von Zürich. Botz Gouch, sollichs ist vor ein Einsiedeler Böcklifresser nit gar gering! Denselbigen Schwyzer wollet ich langost wälzen.“
„Was bist so hützig, Zürcher“, knurrte Hans Ochsner, „ich will dir dine darmzerrend Wind, so dir ze Kopf steigend, schon usbütelen!“
Damit waren sie einig geworden.
Während die Hakenbüchsen bollerten und die Bolzen der Armbrustschützen um den Hahn pfiffen, lag das meiste Volk auf dem Brühl und sah zu, wie die Männer Stein und Stangen stießen. Hans Ochsner sparte seine Kräfte. Er hatte von St. Gallener Leuten erfahren, daß der Cläui Küng noch nie geworfen sei. Der Kochenribly machte ihm keine Gedanken, dieses Mannes beste Zeit schien um. Man kannte ihn seit zehn Jahren, und seine Rede klang dem Hans Ochsner zu flüssig.
Es waren erfreuliche Schwünge an Stein, Stange und Mann geschehen, als der Wälti Kochenribly mit dem Cläui Küng vortrat und den Hans Ochsner aufrief.
Der Hans saß, da er die Arbeit in den andern Spielen getan hatte, nicht bei den Seinen, sondern umringt von etlichen Einsiedler Männern, nahe den Zürichern. Man wußte, er solle einen harten Kampf bestehen. Der alte Ochsner, die Eis, Bombast und der Knabe lagen am oberen Ende des Platzes.
Die beiden fremden Schwinger waren unter einigem Aufsehen zu den Einsiedlern getreten. Der Hans stand nicht eher auf, bis sie ihn riefen. Er ging zunächst den Cläui Küng an und forderte einen ehrlichen Kampf von ihm. Dann schritten sie ruhig in die Mitte und waren stolz bewußt, daß aller Augen in der Runde auf sie sahen.
Zunächst spielten sie miteinander wie zwei junge Bullen, die ihr Gehörn erfühlen wollen. Bald merkte der Hans, daß der Cläui härter Zugriff, daß er breiter und tiefer wurde. Er hatte scharf auf jede Körperneigung des St.Gallener zu achten, doch sah er, daß er es mit einem heißblütigen Manne zu tun habe. Er mußte ihn anlaufen lassen, um den ersten Angriff leichter zu durchschauen, da der erste Agriff der schwerste sein werde. Dem beschloß er auszuweichen, so gut es ging. Danach würde der kleine, sehnige Küng mit allem Zorn losprellen, und dann wollte er die halbe Kraft des andern zu seiner machen. Er wurde ruhiger. Anfänglich hatte es ihn befangen, als müsse er brusthoch gegen ein reißendes Wasser waten.
Der Cläui Küng spielte alle Neckereien ab wie eine lästige Vorarbeit, er wurde unmutig, daß der Ochsner das Spiel so gründlich nahm, nicht locker wurde, keine Finte durch irgendeinen Griff verriet. Cläui sah ein, daß er auch hier zuerst Farbe bekennen müsse, aber das behelligte ihn weiter nicht, er kannte die Art der Größeren, den Kleineren abspielen zu lassen. Ihn beunruhigte der fremde Boden, und die Hetzrufe der Zuschauer fielen ihm lästig.
Das Spiel dauerte allen zu lang. Die Einsiedler erkannten den Hans Ochsner kaum wieder, der sonst seinen Gegner nach den ersten Griffen packte und Überschwang. Doch Hans Ochsner hatte auf die Hetzrufe gewartet, der St.Gallener sollte an ihnen entbrennen. Er suchte einen Scheingriff anzubringen, den der Gegner ernst nehmen mochte, und wollte ins Spiel zurückfallen, um so den Cläui Küng zum Äußersten zu bringen.
Nach einigem Lauern – Cläui Küng festigte seinen Stand und spannte – gelang dem Hans Ochsner die List. Kaum hatte seine Hand des andern Schwinghosenwulst berührt, versuchte der St.Gallener blitzschnell unterzugreifen, aber Hans entschlüpfte mit einem weiten Satz und schlug ein prachtvolles Rad, daß der weite Kreis von Männern und Frauen vor Freuden aufschrie und Cläui Küng erst seines Gegners Gewandtheit erkannte. Er wurde vor Zorn dunkelrot. Und dahin hatte es Hans Ochsner kommen lassen wollen. Cläui Küng wartete nicht länger und ging ihn breitspurig mit großer Gewalt an.
Hans Ochsner wehrte den Angriff auf sein rechtes Bein glücklich ab. Cläui Küng mußte den Wulst des linken zu fassen suchen. Während nun der St.Gallener seinen Angriff änderte, unterfing der Schwyzer den rechten Arm des Cläui Küng mit seinem linken, erfaßte rechterhand den Schwingwulst, der sich über dem rechten Schenkel des Cläui spannte. So war die Wucht des St. Gallener gebrochen, da er auf derselben Seite angriff wie Hans Ochsner, aber an voller Gewalt seines unterfangenen Armes gehindert war. Hans Ochsner brauchte nur sein Körpergewicht gegen die linke Seite des Cläui Küng wirken zu lassen.
Doch fühlte er bald, daß sein Gewicht kaum genügte. Der St. Gallener stand auf festen Sohlen und wich kaum, wenn der Einsiedler den Lupf versuchte. Hans mußte tiefer unter die Schulter des Gegners dringen, doch der preßte den unterfangenden Arm wie ein Schraubstock. Sie schnoben Wange an Wange und stampften langsam in einem engen Kreise.
Hans Ochsner glühte im Rausche seiner gespannten Kräfte. Er fühlte seinen Körper unter dem Drange des Blutes erhärten. Schon lange hatte er nicht das Glück eines ebenbürtigen Kampfes genossen.
Da sank Cläui Küng und gab stärksten Widerpart. Hans wußte, daß es galt. Der Schraubstock lockerte sich. Hans warf sein Gewicht auf die linke Seite, packte auch mit der Linken den Wulst, kniete, ehe der Gegner zum Knien kam, auf dem rechten Bein. Im Augenblicke war der St. Gallener losgerissen, hing in der Luft, rollte über dem Rücken des langen Hans ins Gras.
Der Sieger erhob sich langsam, taumelnd noch unter der Entspannung seiner Kräfte. Er hörte das Beifallsjohlen durch das Pochen der Pulse kaum. Sein Körper glänzte vom Schweiß. Er strich den Bart bedächtig nach beiden Seiten aus und zeigte die blanken Zähne. Dann waren sie zu ihm gerannt, hoben ihn auf die Schultern. Der Hans Ochsner wurde in weitem Kreise herumgetragen, während der Cläui Küng bei seinen Landsleuten gute Aufnahme fand, da man eingesehen hatte, daß die Einsiedler stolz auf ihren Hans Ochsner sein konnten.
Die Züricher standen dicht um Wälti Kochenribly. Sie wußten wohl, weshalb der Hans zuerst mit dem Cläui Küng angebunden hatte, aber sie waren Leute, die eine Sache geschmeidig zu machen verstanden, wenn es die Freundschaft galt. Ein zweiter Triumph des Einsiedlers über den Wälti Kochenribly, der an diesem Tage noch keine Muskel geregt hatte, wäre für Zürich schmählich gewesen, und man war eines Sieges über den ausgearbeiteten Hans Ochsner nicht genug sicher. Also gingen sie mit trefflichen Manieren auf die Einsiedler zu, die ihren Mann absetzten, und forderten den Hans Ochsner für eine nächste Gelegenheit nach Zürich, da es unbillig sei, von einem Manne doppelte Arbeit zu verlangen. Die Einsiedler dachten, daß die von Zürich anders reden möchten, wenn ihr Hans Ochsner geworfen wäre, aber sie konnten gegen die glatten Zungen der Städter nicht aufkommen. Doch weil die Züricher der Sache anlagen, als wäre sie eine ständische und nicht nur ein Spiel zwischen ihm und dem Kochenribly, ließ Hans Ochsner den ältesten seiner Freunde reden. Und sie vereinbarten ein dreimaliges Schwingen und sicherten den Einsiedlern, die da mitkommen wollten, ein freies, gastliches Geleit und Unterhalt für die drei Tage zu. Daß aber keiner glaube, er sähe den Zürcher Vorschlag für eine besondere Großmut an, packte Hans Ochsner unvermittelt den besten Sprecher am Bauche, riß ihn mit einem Arme hoch und hielt ihn eine Zeitlang in der Luft.
„Nit doß ihr gloubit, großgünstig Herren ze Zürch, ich sije nach dem Cläui Küng ein alte Hur“, sagte er.
Der Aufgerissene war der Heini Escher, ein Sohn des Heinrich Escher, der ehemals zum hürnen Rat gehörte, unter dem der Ritter Hanns Waldmann gefallen war. Er machte gute Miene zum ängstigenden Spiel. Und da er wieder sanft auf den Boden kam, zog er seine Börse und verehrte dem Hans Ochsner drei Gulden. Die wurden zu Dank empfangen.
Von den andern waren die Kämpfe wieder aufgenommen worden, aber man beachtete sie kaum mehr. Erst als zum Schlüsse die Knaben antraten, mit Schwert und Hellebarde fochten, Stein und Stangen stießen, leuchtete es aus den Gesichtern der Männer und Frauen. Man sah manchen, der gegen einen Mann bestanden hätte.
Theophrast brannte vor Verlangen. Er umklammerte seines Vaters Hand. Die Augen standen ihm weit offen, er hätte keinen Laut finden können, sein Herz zu befreien. Da man Hans Ochsner auf den Schultern herumtrug, hatte er mitgejauchzt. Das schien ihm nur natürlich. Bei den Kämpfen der Knaben aber sah er in ein neues Leben.
Bisher war er unter der Willenslast der Großen gestanden. Was er tat, wurde von ihnen gestört oder gebilligt. Kreuzten sie zufällig seinen Weg, so überzählte er seine Sünden und konnte verwundert sein, wenn sie ihn ungescholten ließen. Sie verachteten sein Werk gutmütig, wars auch mit aller Hingebung vollbracht. Und nun sah er die Großen in weitem Kreise sitzen, mit freudigen Mienen, voll Ernst und Anerkennung dem Kampf der Knaben folgen, nicht anders, als sie dem Spiel der Männer gefolgt waren. Das fiel zunächst wie ein unerhörtes Glück auf ihn. Er wußte, daß er bald so weit sein werde wie diese jungen Kämpfer. Und doch umklammerte er seines Vaters Hand. Keiner von den kindlichernsten Streitern hätte nach einer Elternhand gegriffen.
Als die Knaben ihr männliches Spiel beendet hatten und, von frohen Zurufen begleitet, um den Platz marschierten, während sich die Frauen zum Wettlauf schürzten, wurzelte das tiefe Verlangen, ein Kämpfer zu sein, in dem Kinderherzen. Theophrast hatte den Wilhelm Fenkh erkannt, er war vor Scham über seine Torheit rot geworden, da ihm das Seidentüchlein mit den Hellern von einem Mägdlein entrissen worden war. Und ihn traf die Schande zum ersten Male nicht mehr als fremde Bedrängnis. Seine Schwäche brannte ihn. Und doch war er nicht betrübt.
Die Taten der Großen zogen an ihm vorbei wie die Wolkenriesen über den Bergen, an die sich kein Ruf wagt. Unzählige Male hatte er versucht, den Großen gleich zu tun, und immer war seine beste Kraft zuschanden geworden. Aber hier erlebte er, was auch für ihn erreichbar schien. Er konnte sich seiner Schwäche schämen, denn sie galt nicht mehr unüberwindlich vor seinen Augen. Bald werde er sein wie diese: wahrhaft trotzig, von den Großen auf seine Art beachtet.
Nie noch hatte er so lebensmächtig begriffen, was Zukunft sei, eine Zukunft nur für ihn selbst. Eigenstes und nicht bloß das bittere Begehren: zu sein, was die Großen waren. Das war es.
Er löste seine Hand aus der des Vaters.
„Du sollt mir ein Schwert geben, das hülzern, das will ich nimmeh han.“
„Balde, min Büebli. Und dir soll ein Schwert geben sin, nit allein.“
„Ein Halmbard och“, drängte Theophrast.
„Nit ein Halmbard nur. Meh, Büebli!“
„Ein Spieß?“
„Nit ein Spieß. Gringer dann Halmbard und Spieß und dannocht größer als sie beid und gewaltiger.“
„Was solls sin?“
„Wann din Zit ist kummen, werd ich ein Feder in dine Hand geben, ich will dich schreiben lehren. Und will dir also ein Buoch in dine Hand geben, darin solltu lesen.“
„Wann kummt die Zit?“
„Ehender als sie ist diesen jungen Kämpferen ankummen, do sie mit ihrem Gewehr sänd usgerüst’t worden.“
Da erheiterte sich das Gesicht desBombastknäbleins sonderbar, denn es ahnte, daß ihm mehr beschieden sei als allen, deren Wehr in der Sonne funkelte.
Die Sonne sank hinter dem Katzenstrick, da lagen die Männer und Frauen an den dampfenden Schüsseln. Sie luden weinziehenden Fisch und Braten, der im Fette schwamm, Specksuppe und gebackene Eier, um die Leber für den Trunk zu hitzen und einen guten Grund zu legen, der locker sei und leicht gehoben werden könne, wenn der Wirt williger wäre als sein Eingeweid.
Einmütig schnoben und schlangen sie: die Herrenleute, denen im Weißen Wind, im Pfauen und Ochsen aufgewartet wurde, und das schlichte Volk, dem die Wirte der Gasthöfe und Garküchen Schüssel um Schüssel zuschleppten. Allen standen die hellen Perlen auf der Stirn, und allen glänzten Lippen, Kinn, Bart, und ihre Finger tropften. Der merklichste Unterschied im Gebaren der Herren vor dem des schlichten Mannes blieb, daß sie nicht mit Messern und Nägeln zwischen die Zähne fuhren und einander nicht ins Gesicht niesten und husteten, solange sie noch nüchtern waren. Sonst unterschied sie nur die Speise. In den Schenken und Garküchen ging es magenstillender und ersprießlicher zu, während die Herren im Weißen Wind, Pfauen und Ochsen schleckerten und das schlichte Wurst- und Fleischwesen, das bodenständige Gemüse an allerlei gaumenkitzelndes Spielwerk verrieten, um dessentwillen kein Vieh gemästet, kein Wild gejagt, kein Fisch gezogen und die eidgenössischen Sonnenstrahlen und Regentropfen nicht auf den Boden gefallen waren. Sie schmatzten bei jungen Hahnenhödlein und Hahnenkämmen, bei rogenbehangenen Krebsschwänzen, Artischocken und französischem Zeller, Karpfenzungen, Gans- und Entenfüßen im Pfefferlein, Nieren, Hasenhirn, Hechtschwänzen, Parmesanerkäse aus Welschland, Rosenwürstchen, Schlehenkonfekt, Mandeln, Hirschleber, Kalbskopf, Senfgurken, Marzipan, gebratenen Maroni und Krapfen. Ihre Weine mußten alle ein Dutzend Zölle üerstanden haben, sonst schmeckten sie ihnen nicht.
Waren erst die Mägen des Ansturmes wieder entledigt und die Zungen pelzig geworden, konnten die Wirte besser auf ihre Rechnung kommen, und sie machten an diesem letzten Abend einen erfreulichen Zug.
Allenthalben setzten die Schlemmer einander mannhaft zu mit Ganzen und Halben; auch die Frauen verstanden zu schlucken und mancher wurde das Miederleibchen zu enge.
Fiedel, Laute, Flöte und Horn und der Dudelsack drangen mit beizenderen Lauten durch den Nebel der Sinne. Im Pfauen ergötzte ein Portativ. Die Spielleute wußten, auf welche Weisen sie kommen sollten, wenn die Augen glasig wurden.
„Ein Abt, den wölln wir weihen,
Ist aus der Maßen gut.
Ein Kloster wölln wir bauen,
Liegt gar in großer Armut,
Darin manch Bruder sauft kein Geld
Und frißt kein Wein, daß er den Orden hält.
Wohlan, die Hühner gacksen viel,
Die Eier kommen schier,
Und wer die Eier haben will,
Muß gacksen hören viel.
Derhalben pfeiff auf, Bruder,
Ich lieg auch gern im Luder,
Ich saugt’ es von der Mutter,
Die trunk es nur bei Fuder.“
In den Schänken brüllten die Männer, bis sie zu Boden sanken, oder sie gerieten aneinander, und einer ersparte dem andern das Badergeld für Aderlaß und Schröpfbank. Es gab Buschwerk und hohes Kraut ringsum genug für die Weiber und ihre Liebhaber.
Die Herren flüsterten den Damen die kitzligen Erlebnisse ihrer Badenfahrten zu, und die Damen verlangten bald selbst nach dem Tanz. Zunächst hielt man sich an die Steifheit des Reigens, aber bald forderten Blicke und Hände mehr. Man wußte die bauschigen Röcke zu schürzen, und die Nesteln der Vorstecktücher hielten nicht stand. Bald griffen die Herren nach Bauernart zu und schwangen die Frauen hoch zum Ergötzen derer, die nur mehr glotzen konnten und vor Vergnügen blöken. Halb gewollt und halb vom Weine geworfen fielen die Paare unter Lachen und täppischen Griffen. Sie wälzten sich eine Zeitlang in Staub und Unrat.
Es fehlte nicht viel, so hätten Heini Escher und seine Freunde im Saale des Pfauen alle Lichter ausgelöscht, aber der Wirt hatte rechtzeitig davon erfahren.
Ehe der Morgen glühte, ritt Herr Kuonrad, der Ratkelberger, gegen die beiden Mythen. Er pfiff ein Lied, und die Augen blitzten blank. Der Legat war noch am letzten Sonntage abgereist, die Cursetta mit ihm. Man hatte erfahren, daß der Legat zur Not Deutsch verstand. Doch war sein hinterhältiges Wesen nicht ungestraft geblieben. Die Cursetta hatte Gefallen an den harten Jägermuskeln des Fürstabtes gefunden. Herr Kuonrad konnte blitzenden Auges sein Liedlein pfeifen, während die Armbrust seinen Buckel klopfte. Der wällische Pfaff wußte, wie er mit der lockeren Domina gestanden war, aber er hatte nicht gewagt, sein Gift zu entladen, da der Fürstabt ihn von Stund an sehr gemessen behandelte: Deutscher Hochadel, und wer bist du gewesen, Onofrio de Nartia? Vielleicht eines stinkenden Bauern Sohn.
Zur Sextenzeit kam Herr Kuonrad mit einem Fuchs und einem Reh am Sattelknopf zurück. Die abziehenden Kleriker erkannten ihn kaum. Vor dem Frauenbrunnen krachten die Bretterbuden zusammen. Schwere Staubwolken zogen über das Lattenwerk hin.
Die Kirchtore waren geschlossen. Herr Diebold nahm das Prunkgeschmeid von der Holzpuppe auf dem Gnadenaltar. Er versicherte es in einer schwerbeschlagenen Truhe und kleidete das Bild in die schlichten Gewänder und Zierate des Alltags.
Um diese Zeit ritt Frau Eis, den Knaben vorn im Sattel, auf dem Schwabenjörgeli heim, und Wilhelm Bombast ging neben den beiden her. Sie redeten nicht.
Die Sonne brannte schwer nieder. Es lag ein Dunst über dem Moore, der reinigende Wetter verhieß.