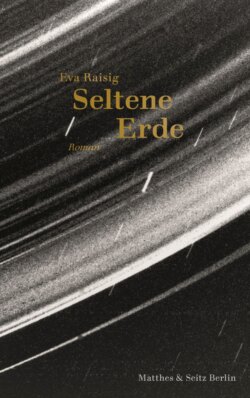Читать книгу Seltene Erde - Eva Raisig - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Am Finnischen Meerbusen auf russischer Seite.
ОглавлениеDas Aufwachen dann auch ein Elend. Abgestanden und pelzig und irgendwie übel. Duschen. Sich abermals erbrechen. In der Welt zurechtkommen. Dann die Luftballons. Als sie aus dem Bad kommt, gerade hört sie hinter der Gastmutter noch die Wohnungstür ins Schloss fallen, ist der Teppichboden in dem Erkerzimmer voll davon. Поздравляю steht mit Filzstift auf einem länglichen Grünen. Sie buchstabiert sich das Wort vor: Alles Gute, herzlichen Glückwunsch, hoch sollst du leben, was soll es schon heißen. Sie schlägt es nicht nach. Zählt die Luftballons durch, dreiundzwanzig, und empfindet etwas. Womöglich ist es Rührung. Über die Gastmutter, kaum älter als sie selbst, die auf welchem Weg auch immer von ihrem Geburtstag erfahren hat und dreiundzwanzig Luftballons aufbläst, bevor sie aus dem Haus stöckelt.
Als Therese in die Küche kommt, schreien in der Wohnung oben wieder die Hunde. Pünktlich morgens und abends um neun. Sie weiß jetzt, dass sie zu spät ist. Vier Anrufe in Abwesenheit. Mutter. Zwei neue Nachrichten.
Eins: Hast du dein Handy aus? Lass uns nachher mal telefonieren. Du meldest dich, ja?
Zwei: Happy Birthday, Mäuschen!
Von der Großmutter nichts, aber damit war auch nicht zu rechnen. Sie schaltet das Handy aus. Auf der Anrichte steht der Topf mit Kascha, daneben die Teekanne, Kandis und zwei Scheiben Zitrone. Ihr wird wieder schlecht. Fett und Salz will ihr Körper, nur keine Zitrone und keine Milchprodukte jetzt. Sie nimmt sich etwas Weißbrot und verlässt das Haus. Pflichtbewusst meldet sie sich in der Sprachschule ab, von den Felixen keine Spur. Die Lehrerin gratuliert zum Geburtstag und zeigt Verständnis für einen Ausflug an diesem besonderen Tag. Экскурсия schreibt sie an die Tafel, eine kleine Lektion soll ihre Schülerin doch noch haben, und Therese liest vor: Ekskursiya.
Haroscho, sagt die Lehrerin, und gute Reise: счастлвого пут.
Das ist kaum zu schaffen in dem Zustand.
Schast-li-vo-go pu-tí.
Sie versucht es noch einmal, aber nichts zu machen. Nur noch ein Paka und dann los.
Wohin an so einem Tag? Der Name Finnischer Meerbusen gefiel. Als würde sie gleichzeitig noch ein anderes Land bereisen. In Russland hält sie so wenig wie an jedem anderen Ort. Zunächst findet sie jenen Finnischen Meerbusen allerdings nicht und irrt durch einen ausgestorbenen Industrievorort. Überall wird gebaut. Das heißt, genau genommen sind nur überall Baustellen, keine Bauarbeiter. Als wäre sie völlig allein auf der Welt. Das kann auch angenehm sein. Aber etwas Zivilisation ist da doch. Ein Riesenrad, das neben einer Baumgruppe steht, ist in Betrieb, es gibt sogar noch zwei weitere Fahrgäste, Oma und Enkel. Halb betrunken eine Runde Riesenrad auf der Suche nach einem Gewässer, das hier irgendwo sein muss, aber sofort wieder der Schwindel, die Spucke im Mund, viel mehr als nötig, da ist die Gondel erst ein paar Meter in der Luft. Therese blickt hinunter auf die Betonplatten, aber das macht es nicht besser. Diese elende Anspannung loswerden. Nicht mehr darüber nachdenken müssen, wie es wäre, wenn ihr Körper da unten auf den Beton knallt.
Tiefenpsychologisch betrachtet, das hatte ihr einer der Klugscheißer im ersten Studiengang in der Mensa erklärt, sei Höhenangst nicht mehr als die innere Unfähigkeit, sich fallen zu lassen. Dabei hatte er aus einem Tablett mit eingelassenen Vertiefungen unterschiedlicher Form verkochte Salzkartoffeln und Erbsen in sich hineingelöffelt. Aber was heißt denn nicht mehr? Was heißt denn da fallen lassen? Und was bitte sehr sollte denn fallen gelassen werden? Die Vorstellung, es könnte alles gut werden? Die Idee eines gelingenden Lebens? Ist nicht jeder Halt besser als der freie Fall? Kurz darauf hatte sie das erste Studium aufgegeben, eine Ausbildung begonnen, sie abgebrochen und ein weiteres Studium angefangen. Einige Semester ging es gut im Sinne von: Sie war ordentlich eingeschrieben und konnte ohne allzu viel Aufwand einen gewissen Schein aufrechterhalten, bis sie sich in eine so sommerliche wie anstrengende love affair hineinsteigerte, und auch wenn klar war, dass es dabei eher um Langeweile als um Leidenschaft ging, reichten die Ausläufer dieses wochenlangen Schauspiels, um Therese endgültig von den Zwischenprüfungen abzuhalten. Einwurf: Sie hatte die nötigen Voraussetzungen schon während des Semesters nicht erfüllt. Als hielte sie etwas ab. Nun, so war es am Ende auch. Was lange Vermutung war, schälte sich zur Erkenntnis: Ich kann das nicht. Das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Eine schöne junge Medizinerin, die den Hausarzt in den Ferien vertrat, sagte ihr, man könne es eine Zeit lang mit einem leichten Antidepressivum versuchen, aber ohne eine begleitende Therapie sei das nicht sinnvoll. Sie könne ihr jemanden empfehlen, Therese solle darüber nachdenken. Auch die Schlaflosigkeit sei womöglich ein Symptom. Bevor die Dinge den Gang gingen, den die Ärztin im Kopf hatte, kam der Hausarzt gut gelaunt aus dem Urlaub zurück, die schöne Ärztin verschwand in irgendeiner Klinik und mit ihr der Gedanke, es könnte wieder anders werden.
Was also stattdessen? Ablenken. Rausrennen und nach Zerstreuung suchen. Die aufdringliche Seele eine Weile auf Abstand halten. Dabei kann die Ablenkung eine mehrtägige Technoparty sein oder eine zeitfressende, wahlweise nervenaufreibende andere Tätigkeit, sogar Lohnarbeit bietet sich unter bestimmten Voraussetzungen an. In diesem Fall unbezahlt und bis der Sprachkurs begann: ein dreimonatiges Praktikum in einer Fotoagentur.
In einer Fotoagentur? Sind wir jetzt unter die Künstler gegangen, ja? fragte der Vater.
Dabei bekam sie von der sogenannten Kunst wenig mit. Sie organisierte Materialien, Veranstaltungen, Models und suchte aus unendlichen Datenbanken passende Versatzstücke für Werbeflyer aus. Das alles nicht nur fünf Werktage, sondern meist auch die Wochenenden hindurch.
Hast du ein Zeugnis bekommen?
Nein, ich mach das für mich, nicht für den Lebenslauf.
Der Vater sah sie an, als wäre sie nun endgültig irre geworden. Aber an etwas gedacht hatte sie in dieser Zeit kaum, immerhin.
Thereses Gondel ist beinah am höchsten Punkt angekommen. Über den Bäumen wird es besser, beim horizontalen Blick in den Himmel, und hinter dem Wäldchen, hinter Rohbauten dann auch tatsächlich ein schmaler Strich Wasser zu sehen, an rauchenden Schloten, an Kränen und Baggern und Bauskeletten. Therese sammelt die Spucke hinter den Zähnen, beugt sich über das Metallgestell und spuckt aus. Im Gesicht des Enkels schimmern Entrüstung, Faszination, Begeisterung auf, alles in schneller Folge. Versuchsweise lässt er einen feinen Spuckefaden aus dem Mund hängen, aber dann der Blick der Großmutter und er saugt ihn schnell wieder zurück. Als ihre Gondel auf vierfünf Uhr angekommen ist, gibt Therese dem Riesenradbetreiber ein Zeichen. Sie winkt mit beiden Armen. Ich möchte bitte aussteigen. Der Riesenradbetreiber winkt zurück. Noch zwei Runden, hier bekommt jeder, was er bezahlt hat.
Endlich wieder unten, schwankt sie in die Richtung, in der sie das Wasser gesehen hat, und gerät dabei immer wieder in zarte Wolken ihres eigenen Schweißes. Zwiebeln mit Restalkohol. Sie kramt nach ihrem Tabak. Alles ist in der Nacht feucht geworden und den letzten Filter hat sie einem der Felixe gegeben. Ohnehin spürt sie ihre Lunge bei jedem Atemzug. Vielleicht sollte sie an dieser Stelle aufhören zu rauchen. Aber jetzt erst einmal: weiter. Weiter. Durch das Kiefernwäldchen, über eine Brache und dann, endlich, an eine verlassene Kartbahn angrenzend: der Kai. Freier Blick, wüst, gleißend. An der Kante zum Wasser hin hocken zwei Angler auf brüchigem Beton. Einer neben einem Haufen Metallschrott, einer vor einer Leiter, die ins Wasser führt. Schräg hinter dem an der Leiter liegt eine in blauer Arktisdaunenjacke auf einer Klappliege mit der Kapuze über dem Kopf. Sie hat die Beine übereinandergeschlagen und den Ellbogen aufgestützt. Die wenige Haut, die zu sehen ist, die Hände, kurz das Gesicht, als sie nach Therese schaut, ist dunkelbraunfaltig wie von vielen Sommern am Kai. Vor ihr auf dem Boden, auf Kopfhöhe, steht ein kleines, sehr lautes Radio mit unverhältnismäßig langer Antenne. Alle paar Minuten dreht sich ihr angelnder Mann um, wilde Augenbrauen über wilden Augen, und schüttelt den Kopf: Immer noch nichts.
Es ist nun wirklich nicht so, dass sie sich mit Angeln auskennen würde, aber sollte man nicht das Radio …?
In einer Lautstärke, die wohl die daunenverdeckten Ohren erreichen soll. Noch hinten bei Therese verzerrtes Geplärre und aufgeregte russische Stimmen, zu schnell für sie, nur die Zahlen erkennt sie, oder sind das Wochentage, und sie stellt sich vor, dass gerade einer den Jackpot –
Und der andere Angler blickt neben seinem Schrott in die Kräne am anderen Ufer und auf den Kai gegenüber, wo alles langsam einrostet und die Gesichtsfarbe der Frau in der Arktisdaunenjacke annehmen wird, während sie wahrscheinlich alle warten, dass endlich mal ein Fisch anbeißt nach all den Jahren am Finnischen Meerbusen auf russischer Seite, um ihn zu braten am Abend zu Hause in etwas Öl und dann mit Zitrone und der Aussicht aufs Meer.
Therese stellt sich zwischen die Angler ans Wasser, die Spitzen ihrer Turnschuhe über der Betonkante des Kais. Sie wippt einmal, zweimal und schaut vor ihre Füße. Manchmal breitet sich die Zukunft so trüb und abgestanden vor einem aus wie das Wasser im Einfuhrbereich eines Hafenbeckens. Brackig, mit Plastikmüll. Ein mehrere Fußballfelder großes Areal der Misslichkeiten, hinter den Kränen langsam in die Ostsee, später in die Weltmeere schwappend. Nur, was willst du machen – den ganzen Tag schreiend durch die Welt laufen? Geht ja auch nicht. Die rotgelben Schwimmer ditschen lautlos. Therese wippt noch einmal an der Kante und geht dann Richtung Mole, die am Ende der Kaimauer in stumpfem Winkel ins Wasser ragt. Sie klettert über die hingewürfelten Betonpoller, unter ihren Füßen schwappt die Brühe und es geht ihr: nun – trotz allem ganz okay. Damit war nach dieser Nacht nicht zu rechnen. Vielleicht hätte sie die andere sonst gar nicht angesprochen.
Auf dem Rückweg von der Mole hört Therese schon aus der Ferne wieder das Radio, die drei alten Bekannten hocken in unveränderter Anordnung und auf der Bank hinter ihnen mit einem Buch dicht vor dem Gesicht: eine dürre Frau in schwarzer Klamotte. Sie sieht aus, als würde sie schon lange hier sitzen, wie sie da die Beine von sich streckt, in ihre Lektüre vertieft, dabei können es erst ein paar Minuten gewesen sein. Sie hat etwas von einem Vogel, einem Raben vielleicht. Therese geht langsamer. Wohin. Ans Wasser, zur Bank? Die Frau sitzt beinah in der Mitte. Wenn sie sich neben sie setzt, ist ein Gespräch unvermeidlich. Als würdest du jemandem in der Wüste begegnen und dann an ihm vorbeigehen, ohne wenigstens die Hand zu heben: undenkbar. Aber was spricht man mit einem mittelalten Raben, der womöglich nicht einmal Englisch kann. Ende dreißig, Anfang vierzig, schätzt sie aus der Ferne. Vielleicht älter. Hallo ich heiße Therese ich komme aus Deutschland. Das geht auf jeden Fall. Sie verlangsamt noch ein wenig mehr, da legt die Frau das Buch zur Seite und geht die paar Schritte zur Betonkante. Die Angler: als würden sie es nicht bemerken. Die Frau blickt über das Wasser, zwischendurch auf ihre Finger, dreht sich eine Zigarette, zündet sie aber nicht an. Ihre schwarzen Flusenhaare mit ein bisschen Grau. Am Hinterkopf eine einzelne weiße Strähne. Therese geht zur Bank, wirft einen Blick auf das Buch, Bulgakow, aber auf Deutsch, und so spricht sie die Frau auch an, als diese zu der Bank zurückkommt.
Tschuldigung: Ich hab Feuer, haben Sie Filter?
Die Frau zieht einen Mundwinkel hoch und greift in die Jackentasche. Sie hält Therese eine Handvoll zerdrückter Filter hin, daran Tabakbrösel, anderes. Bedien dich.
Ein ganz zarter Akzent. Therese nimmt sich einen Filter und nestelt ein klebriges Zigarettenpapier aus der Packung. Der Flaum zwischen Ohr und Kiefergelenk der Frau ist für die dunklen Haare erstaunlich blond. Alles an ihr ist durch und durch mager, der Hals, die Beine, die Handgelenke, und etwas an ihr wirkt ein wenig heruntergekommen, obwohl sich nicht sagen lässt, woher dieser Eindruck kommt. Die schwarzverwaschene Kleidung ist sauber, die Haare sind nicht sonderlich unordentlich, aber irgendwas ist da trotzdem.
Urlaub?
Sprachkurs. Therese inhaliert in ihre schmerzende Lunge und reicht das Feuerzeug weiter.
Ah, sagt die Frau.
Mh-hm. Und Sie?
Urlaub. Quasi.
Dann erst einmal nichts mehr. Schaut nur. In ihrem rechten Auge blinkt es auf, als sie sich die Zigarette anzündet. Und noch einmal. Ein Lichtreflex in ihrer graublauen Iris, der aufscheint, als sie ihren Kopf minimal bewegt und ihre Ausrichtung zum Licht ändert. Therese bleibt diesen einen Augenblick zu lange an ihrem Gesicht hängen, lässt den Moment aber vorüberziehen, als die Frau ihr sehr förmlich die Hand reicht.
Jelena, sagt sie. Oder Lenka.
Therese, sagt Therese und ergreift die kalte Hand. Bei uns gab’s keine Spitznamen.
Ein Nachmittag im Herbst. Eine zufällige Begegnung. Über die brüllende Kulisse eines Radiosenders hinweg ein paar weitere erste Sätze. Über – was? Über Bulgakow. Über die Angler. Was sich hier wohl fangen lässt. Ob man das essen möchte. Dann über dieses und jenes. Was machst du hier, wo kommst du her, was man halt so spricht. Lenka fragt nach der Familie, den Eltern, Therese antwortet knapp, und weil ihr keine andere Frage einfällt, sagt sie: Und Ihre? … Also deine? Obwohl es ihr komisch vorkommt. Ab einem gewissen Alter fragt man nicht mehr nach den Eltern. Bei dieser Frau ist klar, dass Therese auch nicht nach Mann oder Kindern fragen braucht.
Meine Eltern? Die Frau lacht. Die sind in Deutschland.
Was soll man darauf jetzt noch sagen. Meine auch? Sie schweigen. Die Rücken der Angler. Die regungslosen Kräne. Es ist nicht so, dass sie zu irgendeiner Form der Gemeinschaft verpflichtet wäre an dieser Stelle, aber aufstehen und gehen erscheint ebenso unmöglich. Noch eine rauchen. Therese bittet um einen weiteren Filter und sucht sich aus Lenkas Handfläche den saubersten aus.
Was ist denn mit deinen Fingern?
Nichts, sagt Therese. Oder nichts Schlimmes. Nur niedriger Blutdruck.
Es stimmt. Das Zittern liegt bei ihr in der Familie, genauer gesagt in der weiblichen Linie. Alle Frauen mütterlicherseits zittern, besonders morgens. Symptomatische Hypotonie. Ob zuerst das Zittern da war oder erst der niedrige Blutdruck, lässt sich nicht sagen. Aufregung kann eine Rolle spielen. Manchmal hilft ein Glas Saft. Manchmal gutes Zureden.
Ich kann nicht spielen, sagte Therese mit sieben Jahren zu ihrer Mutter, als sie vor dem Musikschulsaal auf den Klappsesseln saßen und warteten, bis das Vorspiel losging. Drinnen das Wüten einer Blockflötengruppe. Ich kann nicht spielen, sagte Therese, ich muss so zittern. Sie hielt ihrer Mutter zum Beweis die Hände hin, die etwas von keinen Aufstand machen murmelte und dann deutlicher sagte: Mäuschen, du wirst es schon schaffen.
Ich kann nicht. Ich glaub, ich muss kotzen.
Dich erbrechen, sagte die Mutter.
Erbrechen, sagte Therese. Jetzt. Und kotzte über den Geigenkoffer hinweg vor den Saal mit den Flötenspielern.
Sie dreht die Zigarette sorgfältiger als notwendig. Die Sonne steht tief und hat doch noch Kraft. Die Angler als Silhouetten vor Hafenkulisse. Therese erzählt von dem Riesenrad, der Odyssee bis hierher, den Nachwirkungen der letzten Nacht und auch wenn Lenka eher spärlich antwortet, kommen sie über die zweite Zigarette doch nach und nach ins Gespräch. Therese hat kein Problem damit, ihrem Gegenüber die Informationen einzeln zu entlocken, eine nach der anderen, ganz vorsichtig und zugewandt, zumindest die groben Eckdaten. Wohnort, Arbeit, das Übliche. Am Ende lässt sich zusammenfassen, dass die Frau, die da neben ihr auf der Bank sitzt, Physikerin ist, wegen einer Konferenz nach Russland gereist, quasi auf Heimatbesuch, weil vor dreißig Jahren von hier aus nach Deutschland ausgewandert, und sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit dem letzten Faktor einer Gleichung beschäftigt, mit der sich die Zahl intelligenter Zivilisationen in der Galaxis abschätzen lassen soll.
?
Ja, gerade habe sie im St. Petersburger Kongresscenter einen Vortrag zur Frage der Lebensdauer technologischer Zivilisationen gehalten.
Was heißt das?
Es geht darum einzuschätzen, wie lange es braucht, bis eine Zivilisation wie etwa die Menschheit untergeht.
Wie etwa die Menschheit?
Wir arbeiten mit der Annahme, dass es möglicherweise noch viele andere Zivilisationen da draußen gibt, mit wahrscheinlich ähnlichen Problemen, Überbevölkerung, Mehrfachvernichtungskapazität, Umweltkatastrophen, Viruspandemien undsoweiterundsofort. Man muss sich also fragen, wie lange eine Zivilisation überlebt und ob technologischer Fortschritt ab einem gewissen Grad nicht zwangsläufig dazu führt, dass sich eine Zivilisation selbst zerstört. Das ist wichtig, wenn es darum geht, mit einer dieser anderen Zivilisationen in Kontakt treten zu können. Vielleicht überlappt sich unsere gemeinsame Lebenszeit einfach niemals. Wahrscheinlich ist das sogar so. Wir haben nur ein paar Tausend gute Jahre, in denen wir potenziell kommunizieren können, und das war’s. Vergleich das mal mit dem Alter des Universums.
Therese besieht sich die Hinterköpfe der Angler und macht ein unbestimmtes Geräusch. Die Suche müsste viel gezielter betrieben werden, sagt Lenka. Früher haben sie das zumindest noch versucht. Sie haben Radiobotschaften ins All geschickt und mit den wenigen Mitteln, die sie hatten, den Himmel abgehorcht. Und diese Raumsonden mit irgendwelchen Plaketten und vergoldeten Schallplatten an Bord – gut: Die waren natürlich eher eine Botschaft für die Menschen als für andere Welten. Aber immer verknüpft mit dieser Hoffnung, dass irgendwer sich an uns erinnert.
Sollte Thereses Ratlosigkeit über den Verlauf des Gesprächs sichtbar sein, lässt sich Lenka davon zumindest nicht aus der Ruhe bringen. Sie sagt: Selbst wenn noch jemand übrig sein sollte hier auf der Erde, um die Antwort auf eine dieser Botschaften zu empfangen, können wir nicht davon ausgehen, dass noch irgendwer weiß, was wir da Tausende Generationen vorher losgeschickt haben. Schon in zehntausend Jahren ist wahrscheinlich von keiner heutigen Sprache mehr der kleinste Rest übrig, der Auskunft über die Vergangenheit geben könnte. Oder über irgendeine Form von Erinnerung, die wir uns erhoffen. Man wird uns vergessen, sagt Lenka. Wie wir einander auch immerzu vergessen.
Therese fällt nicht einmal ein Einwand ein. Sie sagt deshalb nur: Okay. Und was genau ist jetzt dein Job?
Ich habe versucht, Szenarien zu entwickeln, wie lange man im besten Fall durchhalten kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es ab einem gewissen Punkt immer darauf hinausläuft, sich zugrunde zu richten. Man müsste schon sehr weitsichtig sein, um die Gefahren und Möglichkeiten einer fernen Zukunft zu erkennen. Das sind wir nicht. Oder wir handeln nicht danach. Wir schaffen es ja nicht einmal, paar Jahrzehnte über uns und unser eigenes Leben hinauszublicken, der Klimawandel ist nur ein Beispiel. Aber das Problem bei dieser Art der Forschung ist, dass wir unser einziger Datenpunkt sind. Wir haben einfach keinen Vergleich. Wir kennen ja nur die Erde und uns als einzige Zivilisation. Und die Menschheit erweckt mir nun nicht gerade den Eindruck, als würde sie es durch die nächsten Jahrtausende schaffen. Oder? Schau sie dir doch an. Sie macht eine vage Handbewegung. Die Frau auf der Klappliege hat sich umgebettet, liegt nun auf dem Rücken, die Handflächen gen Himmel gedreht.
Das wahrscheinlichste Szenario ist: Die Welt wird vergehen und nichts wird bleiben.
Therese lächelt. Warum gefällt ihr das jetzt so.
Später fahren sie gemeinsam zurück in die Stadt. Auf dem Rückweg vom Kai, an der Bude bei der Bushaltestelle, werden sie gleich als Fremde erkannt. Ah Berlin! ruft die Alte hinter der Theke. Deutschland, sagt sie, sagt dann: Muttervatergroßmuttergroßvaterbitteschöngutentagaufwiedersehen, sieht Therese an, zeigt auf Lenka, fragt: Mama? Sie weiß vermutlich, dass das nicht stimmt. Njet, sagt Therese ziemlich laut, na bitte, die Reflexe funktionieren schon auf Russisch, aber warum ist sie überhaupt so empört. Dagegen Lenka: Lässt den Blick über die etwas erbärmliche Auslage schweifen, gräuliche Würstchen in Öl und schrumpelige Paprika, und sagt, ohne die Alte anzusehen, sehr ruhig und bestimmt und auf Deutsch: alte Freunde. Die Frau schaut sie lange an: Mit denen stimmt doch was nicht. Reicht dann Käseplini und Salat Vitamini über die Theke, wie bestellt. Wie alt bist du denn, fragt Lenka, als sie auf den Bus warten, und dann lacht sie und sagt: so jung. Genau doppelt so alt wie Therese ist Lenka. Das passiert in ihrer Konstellation genau einmal. Aber was heißt das schon.
Es gibt da dieses Fest, sagt Lenka über ihre Schulter hinweg, als sie in den Bus steigen. Ein Stadtfest. Am Samstag. Ein Kollege habe ihr zwischen zwei Vorträgen davon erzählt. Vom Kongressgebäude aus sei es gut und gerne in zwei Stunden zu erreichen, aber für solche Sperenzchen, habe der Kollege gesagt, bleibe wahrscheinlich keine Zeit, oder?
Vielleicht sollte das eine Einladung sein, sagt Therese.
Lenka zieht wieder den einen Mundwinkel hoch: Dann muss ich sie wohl überhört haben. Jedenfalls: Vielleicht fahre ich da hin.
Therese wartet, ob noch etwas kommt.
Hättest du Interesse? fragt Lenka beiläufig und etwas distanziert.
Warum denn nicht, sagt Therese. Ist ja nicht so, dass sie hier besondere Verpflichtungen hätte.