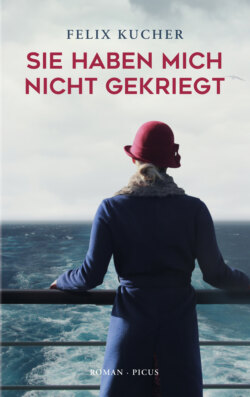Читать книгу Sie haben mich nicht gekriegt - Felix Kucher - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1911
Оглавление»Ich mache da nicht mit. Das ist zu gefährlich!«
»Tina, wir müssen etwas tun. Nur weil wir Frauen sind, kann uns Raiser nicht so behandeln.«
Sie sitzen mit zwanzig anderen Frauen in einer Ecke der Halle, einen eigenen Raum für ihre Mittagspause gibt es nicht. Wer hier miteinander spricht, flüstert, raunt, damit die anderen nicht mithören. Die paar Stücke Salsiccia und das ölige Brot sind schnell aufgegessen, nun sitzen sie beieinander und schauen immer wieder zu den anderen.
»Lies doch lieber ein Buch, um dich abzulenken. Ich kann dir aus der Leihbücherei etwas mitbringen.«
»Du mit deinen Büchern. Es nützt dir ja doch nichts. Glaubst du wirklich noch, dass du wieder in die Schule einsteigen kannst?«
Cinzia legt den Kopf schief. Zarter Spott.
»Ich bin ja noch jung. Wenn ich genug Geld habe, gehe ich nach Amerika. Dort besuche ich dann eine englische Schule. Ich muss noch so viel lernen!«
Sie sagt nicht, dass es ihr kaum gelingt, etwas zu sparen, die paar Lire, die sie für die Fabrikarbeit bekommt, reichen gerade dafür, dass die sechsköpfige Familie über die Runden kommt. Und dass Vater noch immer kein Geld geschickt hat.
»Sei nicht dumm. Du bist fünfzehn. Du wirst in keine Schule mehr gehen. Was willst du denn noch lernen. In zwei, drei Jahren wirst du heiraten, Kinder kriegen und das war’s dann. Wir sind Arbeiter, schon vergessen? Die Arbeiterklasse. Die bleibt unter sich, genauso wie die anderen Klassen.«
Sie will noch erwidern, dass das Unsinn ist, dass es immer eine Möglichkeit gibt, aber die Klingel schrillt, Ende der Mittagspause.
Es ist vier Uhr nachmittags, noch drei Stunden bis zum Ende des Arbeitstags, als der Vorarbeiter zum Webstuhl tritt. In seiner Begleitung ist eine Frau, die Tina nur vom Sehen kennt, die Falten in ihrem hageren Gesicht wirken wie mit Kohle nachgezogen.
Der Vorarbeiter deutet wortlos: Du, komm mit. Du, übernimm ihre Arbeit. Tina ist verwirrt. Was ist los? Der Mann verschwindet mit Cinzia, die namenlose Frau stellt sich an den Webstuhl. Sicher ist es wegen des Streiks, der noch gar nicht stattgefunden hat. Sie muss sie fragen, wenn sie zurückkommt. Aber Cinzia kommt bis zum Ende der Schicht nicht zurück.
Sie trifft sie am Tor, mit roten Augen.
Tina ahnt es, trotzdem fragt sie. »Was ist los?«
Cinzias Blick ist glasig. »Gefeuert. Gleich fünf auf einmal. Dabei haben wir ja noch gar nicht gestreikt. Aber irgendwer hat Raiser das gesteckt.«
»Aber in der Produktion brauchen sie doch jede Einzelne.«
»Kindchen, für die fünf Posten warten schon fünfzig Mädchen. Und du hast es ja auch schnell gelernt, schon vergessen?«
Drei Jahre ist es her, dass Cinzia ihr den Webstuhl erklärt hat. Drei Jahre haben sie mit kleineren Unterbrechungen zusammengearbeitet.
»Ich werde auch gehen«, murmelt Tina, und sicher weiß auch Cinzia, dass es eine Lüge ist.
»Ich bin Betty.«
»Marie. Marie Rosenberg. Von der Buchhandlung in der Schwabacher Straße.«
Natürlich hätte sie es einer Gleichaltrigen gegenüber nicht dazusagen brauchen, aus welcher Familie sie stammt, aber es ist ihr herausgerutscht. Sie hat es gelernt, sich so vorzustellen. Jeder Erwachsene in Fürth ordnet ein Kind sofort einer Familie zu, was oft gleichbedeutend mit einem Betrieb oder einem Amt ist. Luise, ihre beste Freundin in der Grundschule, ist nicht mehr in der Klasse. Sie hat sich immer mit »die Tochter des Postvorstehers« vorgestellt. Alice und Fanny kennt sie noch, die sitzen auch wieder nebeneinander in der ersten Reihe, wie schon in der Grundschule. Blöde Gören. Die dicke Josefine ist auch da und schaut erwartungsvoll Richtung Tür. Alle sind sie neugierig, welcher Lehrer wohl als Erster hereinkommen wird. Bis auf die drei gibt es für Marie in dieser Klasse nur neue Gesichter. Sie ist verzweifelt gewesen, als sie den Klassenraum betreten, sich gesetzt und bemerkt hat, dass keine Freundin da ist. Dafür blickten sie dreißig Augenpaare misstrauisch und neugierig an. Zumindest kam ihr das so vor. Aber jetzt hat sie eine Banknachbarin, die nett aussieht. Betty.
»Mein Vater arbeitet am Gericht, aber er ist kein Richter.«
Ein ebenso eingelernter Satz. Es kommt Marie seltsam vor, dass sich zwei Gleichaltrige so vorstellen, wie sie es sonst immer Erwachsenen gegenüber tun. Das passt nicht für Kinder. Es ist ein Reflex.
Marie weiß nicht, was sie erwidern soll.
»Ich habe dich schon einmal gesehen«, sagt Betty. »Und deine Familie. Beim letzten Jom Kippur.«
Sie ist also auch Jüdin, und zwar eine von den frommen. Sonst würde sie nicht so reden.
»Wir gehen nicht so oft, nur zu den Feiertagen.«
Sie muss daran denken, wie ihr Vater immer freundlich, aber bestimmt die Einladungen ablehnt, die Bekannte zu jüdischen Festen aussprechen. Manchmal spricht er beim Essen den Kiddusch, wobei sie immer das Gefühl hat, dass es ihm peinlich ist. Über die Arbeitsverbote am Schabbat macht er sich immer wieder lustig. »Nur zu den Feiertagen« war nicht ganz richtig. Nicht öfter als zehnmal ist sie mit ihren dreizehn Jahren in der Synagoge gewesen, meistens zu Jom Kippur. Außer im Religionsunterricht in der Volksschule hat sie mit der Religion nie etwas zu tun gehabt.
An der Tür ertönt ein Geräusch, die Gespräche in der Klasse ersterben sofort, als ob jeder schon neben dem Reden halb hingehört und nur darauf gewartet hätte, bis der Lehrer käme. Ein Mann mit streng zurückgekämmtem schwarzem Haar, Schnurr- und Spitzbart tritt ein und schließt die Tür hinter sich. Mit einem kollektiven Rums! stehen alle auf, während der Lehrer zum Pult schreitet.
Es ist totenstill.
»Setzen! Ich bin euer neuer Klassenlehrer und werde euch in Geografie, das ist Erdkunde, unterrichten. Ihr seid jetzt im Lyzeum und hier gibt es viele Fächer, die ihr bisher nicht hattet. Mein Name ist Heinrich Zink. Ihr werdet mich mit Herr Professor Zink ansprechen. Wir werden viel lernen.«
Er nickt langsam, als würde er sich selbst bestätigen, und schaut von Schülerin zu Schülerin. »Viel lernen, und ich erwarte mir, dass ihr euch durch Fleiß und Wohlbetragen auszeichnet.«
Viel lernen. Ich will viel lernen, denkt Marie, lernen, lernen, lernen. Ich werde Vater keine Schande machen. Ich werde das Abitur machen, auch wenn er mich lieber in der Buchhandlung sehen will. Es reicht doch, wenn Walter dort arbeitet.
»Wer von euch ist auf Sommerfrische gewesen?« Die Stimme des Lehrers. Was er zuvor gesagt hat, hat Marie nicht gehört. Aber ja, ihre Familie war im Sommer eine Woche im Salzkammergut, im Österreichischen. Sie zeigt auf.
»Ja, das stimmt, drüben im Österreichischen, bei den Erbfeinden«, – Demetrio lacht auf – »die haben keinen Zwölfstundentag mehr für Mädchen in deinem Alter. Die sind schon weiter. Aber wir kämpfen auch dafür, da kannst du dir sicher sein. Ist es wegen der Hände?«
Tina schüttelt den Kopf.
Sie ist mit Onkel Demetrio am Tisch sitzen geblieben, die Mutter macht sich mit dem Geschirr im Spülstein zu schaffen, die Geschwister sind im Hof und spielen wahrscheinlich mit Holzreif und Ball.
»Schau, meine Finger haben schon so viel Hornhaut, da spüre ich nichts mehr. Es sind die Aufseher, die so …«
Sie vollendet den Satz nicht. Demetrio weiß ohnehin, wie es zugeht. Die Schikanen, wenn sie etwas auf den Boden werfen, das ein Mädchen aufheben muss. Wie sie ihnen an die Hinterbacken greifen und sie zusammendrücken wie eine Zitrone, ein Zeichen, dass der Aufseher einen mag. Die Lohnabzüge, wenn eine sich eine halbe Stunde hinlegen muss, weil sie Krämpfe hat oder Fieber.
»Hat es sich nicht gebessert?«
Tina schüttelt den Kopf.
»Die Burschen drüben in der Papierfabrik verdienen viel mehr als wir und die Arbeit ist nicht schwerer und außerdem ist dort nicht so ein Lärm. Warum tut deine Partei nichts für die Frauen?«
»Sie tut etwas, sie tut etwas«, brummt Demetrio. Er holt seine Pfeife hervor und klopft sie aus. Er stopft sie und zündet sie an. Tina mag den süßlichen Geruch.
»Aber es geht nur langsam. Du weißt, dass Frauen in unserer Partei gleichberechtigt sind. Du solltest auch mitmachen. Zumindest Mitglied des Syndikats könntest du werden.«
»Bei uns hat Raiser zwei sofort entlassen, die Werbung für das Syndikat gemacht haben. Es ist so ungerecht.«
»Ich weiß. Aber hab Geduld. Es bessert sich überall etwas. Langsam. Wenigstens seid ihr nicht eingesperrt in der Halle.«
»Eingesperrt? Das wäre ja noch schöner!«
Demetrio Canal zieht dreimal kurz an der Pfeife, jedes Mal schmatzt er dabei.
»Hast du nicht gehört, was im März in New York passiert ist?«
»Nein. Ich lese keine Zeitung.«
Dafür Bücher, zumindest versuche ich es abends, aber ich schaffe nur drei Zeilen, bis mir die Augen zufallen, will sie sagen, aber sie schweigt.
»Eine Hemdenfabrik hat gebrannt. Wahrscheinlich hat jemand eine Zigarette auf einem Stoffballen vergessen. Die zweihundert Mädchen, die in der Halle dicht aneinander an den Nähmaschinen saßen, gerieten in Panik.«
»Warum haben sie das Feuer nicht gelöscht?«
»Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gab kein Wasser. Jedenfalls waren die Türen geschlossen, als das Feuer um sich griff. Hundertfünfzig von ihnen sind verbrannt.«
Rauch kringelt aus seiner Pfeife. Tina spürt Übelkeit aufsteigen.
»Aber … warum hat niemand die Türen aufgemacht? Und warum sind sie nicht aus dem Fenster gesprungen?«
»Kind, in New York sind die Häuser höher als hier. Die Halle war im achten oder neunten Stock. Zwanzig oder dreißig sind tatsächlich gesprungen. Sie waren sofort tot. Warum die Türen nicht aufgingen, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie geklemmt.«
Tina würgt. Gleich muss sie sich übergeben. Demetrio pafft eine beißend-süßliche Wolke. Seine Stimme klingt trocken.
»Man fand die verkohlten Leichen an ihren Nähmaschinen sitzend. Die Mädchen hatten Angst vor Strafe, wenn sie ihren Arbeitsplatz verließen. Die Feuerwehr kam zu spät.«
Tina denkt an die Seidenweberei, an die vertraute Fabrikhalle, um die Übelkeit zu vertreiben. Bei Raiser arbeiten alle Frauen im Erdgeschoß. Wenn im ersten Stock Feuer ausbräche, würden eher Raiser und die Leute in den Büros verbrennen, nicht die Arbeiterinnen.
Sie würgt die Übelkeit hinunter, im Magen ist immer noch ein flaues Gefühl. Sie sieht die Mädchen, die weinen und schreien, die sich im Sitzen an ihre Nähmaschinen klammern, die durch das Gas ohnmächtig werden, vornüberkippen und dann wie Puppen von den Flammen erfasst werden. Alle sind betäubt, keine schreit mehr.
Sie mag Onkel Demetrio nicht ansehen, sie blickt an die Wand neben sich zum Kalender, es ist ein Jahreskalender auf einem Blatt, an die Wand geheftet mit einer Reißzwecke, für jeden Tag steht klein gedruckt ein Heiliger im Kalender. Tina kann die Namen nicht lesen, die Buchstaben verschwimmen vor ihren Augen. Warum helfen diese Heiligen nicht, wenn man sie braucht?
Die Buchstaben verschwimmen vor ihren Augen. Wer soll sich all die Vokabel merken?
Sie lässt das Buch sinken und blickt aus dem Fenster.
Noch kein Schnee Anfang Dezember, aber draußen ist es so kalt, dass sich jede Nacht Eisblumen an den äußeren Fenstern bilden.
Kirchenglocken läuten, Sophie und die anderen christlichen Mitschülerinnen sind sicher schon auf dem Weg in die Kirche.
Marie blickt sich im Zimmer um. Sie hat ihr Bett gemacht, das von Helene ist noch so, wie sie es beim Aufstehen hinterlassen hat. Aber trotzdem ist Helene immer die brave große Schwester. Sie ist ja auch mit den Eltern spazieren gegangen und sammelt wieder Gutpunkte, während Marie nichts von den langweiligen Spaziergängen im Stadtpark hält, vor allem jetzt im Winter. Den Park kennt sie in- und auswendig. Sie wird es wohl nie schaffen, ihre Schwester von ihrem Favoritenplatz zu verdrängen. »Mein kleiner Widerborst«, hat der Vater sie neulich genannt. Marie hat das als Lob gesehen.
Sie versteht nicht, dass man mit elf Jahren so viel lernen muss. Turmrechnungen, dreistellig, vierstellig, fünfstellig, wer ist als Erster fertig, hat der Lehrer gerufen. Lateinische Vokabel, jeden Tag eine neue Lektion. So viele Fachausdrücke in Erdkunde und in Geschichte. Wer soll sich das alles merken?
Das Schulgebäude ist ja schön und neu und liegt gleich um die Ecke, aber am ersten Tag hat sie sich trotzdem fast verlaufen. »Mädchenlyzeum«, steht in großen Buchstaben über dem Eingang, »Höhere Töchterschule Oststadt« klein darunter.
Sie fragt sich, ob sie fehl am Platz ist. Sie ist doch keine höhere Tochter. Und die Klassen heißen so komisch. Sie war jetzt in der Sexta, obwohl es die fünfte Klasse ist. Der Bruder war in der Untertertia, die die achte ist, Helene in der Quinta, die die sechste ist, obwohl sie gerade gelernt hat, dass quinta fünfte heißt!
Sie gleitet von ihrem Sessel, gleitet aus dem Mädchenzimmer und klopft an Walters Tür. Er will das seit Neuestem, die kleine Schwester muss seine Privatsphäre respektieren, hat er gesagt.
»Was willst du denn schon wieder«, sagt er, als er die Tür öffnet. Er wirkt verschwitzt, als ob er gelaufen wäre.
»Kannst du mich Vokabel abprüfen?«
»Ach, Marie. Später. Oder vielleicht hat ja Vater dann Zeit oder Helene, wenn sie zurück sind.«
Sie wirft einen Blick in sein Zimmer. Zwei Hanteln liegen auf dem Boden. Offenbar hat der Bruder gerade trainiert. Er hat die Hanteln zum Geburtstag bekommen, alle seine Freunde haben so etwas, sie wollen Muskeln haben, die sie beim Turnen vorzeigen können.
Sie zieht eine Schnute.
»Hör mal«, sagt er, »du musst jetzt selbständig sein, du wolltest ja unbedingt auf diese Schule. Mir hat auch niemand geholfen.«
Sie versucht, Tränen hinauszudrücken, es kommen keine.
»Später, einverstanden?«, sagt der Bruder. Sie trottet zurück in ihr Zimmer. Die Spaziergänger würden sicher erst in einer Stunde kommen.
Mit ihrer Schwester war sie bis vor zwei Jahren unzertrennlich gewesen. Sie spielten gemeinsam, seit sich Marie erinnern kann. Sie hatten keine Geheimnisse voreinander, Marie trug ihre Kleider nach, sie war ihre beste Freundin. Aber das Lyzeum hat Helene vor zwei Jahren mit einem Mal verwandelt. Keine Zeit mehr für Kindereien. Die große Schwester hat Freundinnen, bei denen sie sich unterhakt und mit denen sie in der Altstadt zwischen den Fachwerkhäusern, wo sich Geschäft an Gasthaus reiht, herumspaziert, herumkichert und Geheimnisse hat, die sie mit Marie nicht mehr teilt. Vielleicht wird es ja jetzt besser, wenn Marie auch im Lyzeum ist.
Sie setzt sich wieder an ihr Tischchen und nimmt ihr Vokabelheft.
Walter wird sicher wieder vergessen, dass er zugesagt hat. Nach dem Mittagessen wird Vater Zeit haben. Genau das, was sie vermeiden wollte. Bei jeder nicht gewussten Vokabel wird der Vorwurf im Raum stehen: Du hast es nicht notwendig. Lass es sein. Geh an eine andere Schule, in drei Jahren trittst du sowieso die Lehre in der Buchhandlung an. Aber sie wird sich anstrengen, und der Vater wird nachgeben müssen. Sie wird ab jetzt auch ganz brav sein, nicht mehr frech zurückreden und ihr Kleid nicht mehr so oft schmutzig machen.
Nur das Kleid nicht schmutzig machen. Nicht aufsehen. Zumindest bis die Delegation vorbei ist. Langsamer arbeiten, es soll ja niemand den Eindruck bekommen, dass ihr schuften müsst, hat der Aufseher gesagt. Die drei Kleinen haben heute frei, nur Mädchen über zwölf sind in der Halle.
Auch die Maschinen rattern heute leiser, Tina hat keine Ahnung, wie die Mechaniker das geschafft haben. Trotzdem versteht man schon die Arbeiter, die fünf Meter entfernt stehen, nicht mehr. Und so kann sie auch nicht hören, ob die Herren schon da sind. Auf den Eingang der Halle sieht sie von ihrem Platz aus auch nicht. Nach einer Viertelstunde Arbeit spürt sie die Unruhe, die sich wie eine Welle unter den Arbeiterinnen ausbreitet, auch wenn sie nichts sieht oder hört. Die Delegation ist da. Direktoren von Spinnereien aus Österreich, dem Kronland Vorarlberg, wo angeblich die Hälfte der Einwohner an Webstühlen arbeitet, hat ihnen der Aufseher letzte Woche erzählt.
Die sechs dicken Männer bewegen sich durch die Halle, Raiser erklärt hin und wieder etwas, man sieht ihm an, dass er sich anstrengen muss, den Lärm zu übertönen. Die Herren nicken, sie sehen übernächtig aus. Am Webstuhl vor Tinas Arbeitsplatz bleiben sie stehen, Raiser spricht. Als sie an ihr – Gott sei Dank – vorüberziehen, läuft es ihr kalt über den Rücken. Nur nicht aufblicken, bedächtig die Arbeit tun.
Ein Geräusch lässt sie dennoch aufsehen. Etwas Silbernes liegt auf dem Boden, eine Taschenuhr, ein Mann, der sich von der weiterziehenden Gruppe abgewandt hat, steht davor und macht Anstalten, sich zu bücken. Tina gibt das Schiffchen in die Endposition, dreht sich um, bückt sich, gibt dem Mann die Uhr.
»Danke«, sagt er auf Deutsch.
»Bitte sehr, der Herr«, antwortet sie ebenfalls auf Deutsch.
Der Mann zieht die Brauen hoch.
»Du sprichst Deutsch?«
Tina senkt den Kopf, nickt Richtung Boden.
»Wo hast du denn das gelernt?«
»In der Schule. Ich bin in Österreich zur Schule gegangen.«
»Eine Arbeiterin, die Deutsch kann. So eine könnte ich brauchen.«
Er zuckt die Achseln, als wollte er sagen: Es ist ohnehin nicht möglich.
Sie sieht ihm noch ein wenig nach, wie er aufschließt zu den anderen, dann wendet sie sich wieder ihrem Webstuhl zu.
Wieder in die Schule gehen. Bücher lesen. Neue Worte lernen, Buchstabe für Buchstabe. Sie denkt an die Formen der Buchstaben auf dem Fabriksgebäude, den Bogen des »R« von »Raiser«. Warum gibt es überhaupt Buchstaben? Wie sie wohl entstanden sind? So viel dumme Gedanken, während das Schiffchen hin und her saust.
Mittwochnachmittag darf sie das erste Mal allein zu Betty. Als sie mit ihr vor dem Spiegel steht und beide Grimassen schneiden, wird ihr während des Lachanfalls klar, wie verschieden sie sind: Betty ist mager und hat eine Haut wie aus rosa Papier. Ihr dünnes blondes Haar, das ständig von einem perlmuttfarbenen Haarreif zusammengehalten wird, trägt sie offen. Neben ihr kommt sich Marie pummelig vor. Ihre Haut ist dagegen fast ledrig, ihr drahtiges dunkelbraunes Haar nur mühsam gebändigt. Während Betty schnell das Interesse an einer Sache verliert und gleich zur nächsten geht, bleibt Marie länger bei einem Spiel und hat größere Mühe, sich umzustellen. Dafür ist sie schnippischer, Betty drückt sich oft umständlich aus.
Auch die Wohnung von Bettys Familie ist so anders als ihr Zuhause in der Gabelsberger Straße. Nicht, dass es zu Hause hässlich wäre. Aber die elterliche Wohnung ist nichts Besonderes, und die meisten Wohnungen, die Marie bisher gesehen hat, sehen ähnlich aus: Möbel aus blank poliertem Eichenholz, gepolsterte Stühle, eine Vitrine für das gute Geschirr, eine Anrichte für das gewöhnliche; Kunstdrucke und echte Bilder an den Wänden.
In Bettys Wohnung sind die Räume höher, im Wohnzimmer stehen pechschwarz lackierte glänzende Möbel mit Messingbeschlägen, die zu groß für den Raum scheinen und Marie an Afrika denken lassen.
Betty ist heute wie eine Puppe gekleidet, ein Kleidchen mit Tülleinsatz und falscher Spitze am Saum. In ihrem engen Zimmer ist kaum Platz für ihr weiß lackiertes Eisenbett. In den Regalen stehen Spielsachen und Kinderbücher. Sie hat auch einen vier Jahre älteren Bruder, Isaak, der das Kabinett neben ihr bewohnt, er besucht das jüdische Gymnasium. Auch Isaak ist dünn wie eine Bohnenstange, hat ein spitzes Kinn und dunkelbraune, immer unfrisiert aussehende Haare – das Gegenteil von seiner blondschimmernden Schwester. In seinem Zimmer hängen Zeichnungen von Flugzeugen. Er erzählt den Mädchen von den neuen Wasserflugzeugen, die es jetzt gibt, und dass die Berliner Morgenpost jeden Tag frisch von der Druckerei nach Frankfurt an der Oder geflogen wird. Dann schwärmt er von seiner Schule und dass er dort neben Latein auch Hebräisch lernt. Angeber.
»Ich will das auch lernen«, sagt Marie.
»Das ist nichts für Mädchen. Die müssen kochen und nähen lernen, wenn sie einen Mann finden wollen. Aber nicht Hebräisch.«
»Ich werde nie kochen«, sagt Marie laut. »Ich werde eine Köchin haben so wie die reichen Leute, oder einen Mann, der kocht. Die modernen Frauen sind jetzt anders. Du wirst schon sehen.«
Isaak lacht.
Marie beginnt: »Aleph, Bet, Gimel, …«
»Schon gut«, sagt er, »ich glaub’s dir ja. Das kann aber jeder.«
Isaak atmet tief durch.
»Geht jetzt wieder spielen. Ich muss lernen.«
Marie schmollt, sie will kein kleines Kind mehr sein, das sich so einfach abspeisen lässt. So viel wartet darauf, entdeckt zu werden. Isaak ist um nichts besser als die Erwachsenen, die ihr nichts zutrauen. Sie wird diese Sprache auch lernen. Das Alphabet, das Aleph-Bet kann sie schon. Ist sie nicht auch Jüdin, auch wenn sie nur einmal im Jahr ins Bethaus gehen? Sie wird es ihm schon zeigen.
»Da war ich noch nie drin.«
»Obwohl du so nahe wohnst?«
Tina zuckt mit den Achseln.
»Bist du jetzt fromm geworden?«
»Meine Mutter hat mich immer mitgenommen, als ich klein war. Natürlich mussten wir hinten stehen, aber ich habe schöne Erinnerungen.«
»Was ist dann passiert?«
»Das, was auch in deiner Familie passiert ist, Dummerchen. Alle sind Kommunisten geworden.«
Cinzia schiebt die schwere Holztür auf. Tina ist froh, dass sie vorbeigekommen ist und sie abgeholt hat. Seitdem Cinzia nicht mehr bei Raiser arbeitet, vermisst Tina die Gespräche, den Klatsch und Tratsch, die Vertrautheit. Vor zwei Wochen hat sie an die Tür in der Via Caiselli geklopft und nach Tina gefragt. Sie fiel ihr um den Hals. Sie erzählte ihr, dass sie als Näherin arbeitete und sich manchmal mit einem Burschen treffe, der in einer Druckerei arbeite und immer schwarze Finger habe. Sie verabredeten sich für Sonntag zum Herumspazieren.
Sie betreten den düsteren Raum, nur durch die Obergaden fällt Schlaglicht wie von Scheinwerfern auf die Säulenkapitelle. Es riecht nach Weihrauch und Putzmitteln. Vor ihnen ein Schachbrettboden aus Marmor.
»Nur auf die Schwarzen!«, flüstert Cinzia und hopst los. Tina blickt sich um. Das ist sicher verboten. Sie tapst von Feld zu Feld, dann bleibt sie stehen und blickt nach oben. Eine riesige Kuppel wölbt sich über dem Hauptschiff, übervoll bemalt: Auf einen goldenen Hintergrund hat der Maler Wolken gesetzt, die unterhalb, in der Kirche, zu schweben scheinen, daneben schwerelose Engel und vermutlich Heilige. In der Mitte der Kuppel ist eine elliptische Öffnung gemalt, durch die der Himmel sichtbar wird, auch vor dem Blau schweben Engel und in der Mitte ein Mann, wahrscheinlich Jesus. Alles schwebt, ist leicht, golden, funkelnd.
Noch nie war sie hier, und es erscheint ihr wie eine Märchenwelt, so stellt sie sich den Palast eines Königs vor.
»Komm schon, was schaust du?«
»Ich komme!«
»Ich muss dir was Grausiges zeigen, die Reliquien.«
Zu Hause vor der dünnen Milchsuppe fragt sie Onkel Demetrio, warum Kommunisten nicht in die Kirche gehen. Die zehn Gebote sind doch nichts Schlechtes und Liebe auch nicht.
»Die zehn Gebote«, sagt Demetrio und leckt den Löffel ab, »die zehn Gebote sind ein Zeichen der Unterdrückung.«
Tina versteht überhaupt nichts. Sicher, es gibt andere Fünfzehnjährige, die in der Gewerkschaft sind und mehr wissen. Aber wie können Regeln wie »Du sollst nicht töten!« ein Zeichen der Unterdrückung sein?
»Schau nicht so verdattert, es ist wirklich so.«
Die Mutter trägt das Geschirr zur Spüle, jetzt kommt sicher wieder die Belehrung durch Onkel Demetrio.
»Ich finde es schade, dass wir da nicht hingehen. Der Raum ist so schön und die Messen sind es sicher auch: Es wird gesungen und die Orgel spielt.«
»Ja, und damit vernebeln sie den Menschen das Gehirn«, sagt Demetrio. »Marx hat geschrieben, dass Religion das Opium des Volkes ist. Das heißt, die armen Leute, die sich kein Opium leisten können, nehmen stattdessen die Religion als Beruhigungsdroge. Die Kirche hilft den Arbeitern nicht. Sie sagt: Im Himmel wird alles besser. Die halten zu den Reichen, nicht zu uns. Und außerdem stellen sie jede Menge Gebote und Regeln auf, die sie selbst nicht einhalten.«
»Die Sozialistenfrauen bei uns in der Fabrik reden die ganze Zeit von Syndikat und Revolution«, sagt Tina. »Alles muss zerstört werden. Das kann doch auch nicht gut sein. Wenn man den Reichen alles wegnimmt, sind eben andere dann reich.«
Demetrio lacht.
»Nein, das ist anders. Im Sozialismus wird alles anders. Wir Proletarier werden eine neue Welt schaffen, du wirst es noch erleben. Eine Gesellschaft, in der alle gleich sind. Wo es keine Großgrundbesitzer und Fabrikdirektoren gibt. Wo alles allen gehört. Die Syndikate sind der Anfang der neuen Gesellschaft. Alles wird von den Arbeitern selbst verwaltet, wir werden dann keine Direktoren mehr brauchen.«
Er nimmt die Zeitung, die neben ihm auf der Bank liegt, und legt sie vor Tina.
»Schau, da: In Pordenone gibt es ein neues Syndikat. Und da: Streik in der Schuhfabrik. Du solltest mehr Zeitungen lesen in deinem Alter, nicht diese lächerlichen Romane.«
Er blickt auf die Taschenuhr, steht auf, setzt seinen Hut auf, fasst Tinas Mutter von hinten an den Hüften und küsst sie auf den Nacken.
»Ich treffe mich noch mit Giovanni. Danke für die Suppe. Kann später werden.«
Er tippt mit der Hand auf die Hutkante. »Tina. Wir reden morgen weiter.«
Vaterersatz. Nein, Vater hat sich nie am Abend herumgetrieben.
Eine Woche später, beim nächsten Besuch, fragt Marie Isaak Löcher in den Bauch. Sie hat die ganze Woche Fragen gesammelt, die sie dem Vater nicht stellen will, weil sie weiß, dass er nichts davon hält. Hat Moses die Torah geschrieben? Ist das Aleph wirklich das Symbol eines Rinderkopfs gewesen? Sind das die ältesten Buchstaben der Welt? Isaak weiß auf viele Fragen keine Antwort.
»Warum fragst du nicht den Religionslehrer? Der ist doch dafür da!«
»Der nimmt uns Mädchen doch nicht ernst.«
»Unseren kann man alles fragen. Tja.«
Isaak erzählt von Professor Kissinger, der viel lebendiger unterrichtet und ganz andere Sachen durchnimmt als der Lehrer an der Mädchenschule.
»Er weiß immer eine Antwort«, sagt Isaak. »Aber wir müssen auch viel lernen.«
Marie kann niemanden fragen. Religion ist ihren Eltern egal. Und Herr Löw sagt immer »Später!« und behandelt die Fragen doch nie.
»Haltet ihr diese Schabbatgebote eigentlich ein? Stimmt es, dass sogar Spazierengehen am Schabbat als Arbeit gilt?«
»Hängt davon ab«, sagt Isaak.
Isaak doziert, die beiden Mädchen hören zu, Marie interessiert, Betty gelangweilt. So hat sie sich den Freundinnenbesuch nicht vorgestellt. Sie sieht zum Fenster hinaus und zur Decke und schnaubt immer wieder kräftig.
Aber Isaak hat Geduld, er redet sich warm. Marie spürt, dass er sich bemüht, gut zu erklären. Ein kleiner Rabbi.
Als er vom Schabbesgoi erzählt, der jeden Samstag kommt, glaubt sie es zunächst nicht.
Marie kennt das alles nicht. Was ihr Vater dazu sagen würde?
»Das meiste macht man ohnehin vorher. Wenn die Glut im Ofen ausgeht über Nacht, das passiert nicht so oft, dann kommt Herr Noack und macht das Feuer wieder an, weil uns Feuer machen am Schabbes verboten ist, zum Beispiel. Oder wenn etwas kaputtgeht, dürfen wir das nicht reparieren. Dann kommt Herr Noack.«
Marie weiß nicht, was sie davon halten soll. Oder binden sie ihr einen Bären auf und werden gleich loslachen?
»Komm jetzt«, sagt Betty. »Wir wollten doch noch die Hausübung machen.«
Später gibt es Quarkbrote mit Schnittlauch, der Vater ist inzwischen zu Hause. Marie nimmt sich ein Herz und fragt ihn nach dem Schabbesgoi. Er sieht Marie etwas länger an, bevor er spricht. Sie weiß, was er denkt: Eine jüdische Familie, die die Bräuche nicht einhält und an Religion völlig uninteressiert ist.
»Wir beten am Schabbes für alle mit, die nicht in der Synagoge sind«, sagt er, und es klingt nicht streng, eher heiter.
»Weißt du, meine Frau kocht am Freitag vor, wir bringen das Essen dann zum Bäcker nebenan, der hält es in seinem Backrohr oder neben dem Ofen warm, und Herr Noack bringt uns das dann am Schabbes, denn für uns wäre das Arbeit.«
Marie nickt und beißt in ihr Quarkbrot. Sie würde am liebsten weiter fragen, aber sie traut sich nicht. Es gibt so viel, das sie nicht weiß. Aber was bedeutet »jüdisch«, wenn man sich nicht an die Gebote hält? Ist sie dann überhaupt Jüdin? Vielleicht wird sie das nächste Mal fragen. Jetzt will sie Betty nicht verärgern.
Als sie sich später verabschiedet, steht sie mit Betty noch vor der Tür am Flur.
»Bis nächste Woche.«
»Du redest ja nur mit meinem Vater und meinem Bruder. Kommst du überhaupt noch wegen mir?«
Ein Stich ins Herz.
»Aber natürlich! So ein Unsinn. Entschuldige, bitte, Betty.«
Die Freundin presst die Lippen zusammen.
»Was hast du nur auf einmal mit der Religion? Ich habe gedacht, du wirst mich ein bisschen ablenken von diesen Sachen.«
Marie treten die Tränen in die Augen.
Betty schiebt die Unterlippe vor.
»Und überhaupt. Tust auf fromm und hast doch gar keine Ahnung von Religion. Willst du dich einschmeicheln bei meinem Vater?«
»Aber nein, Betty, nie im Leben. Mich interessiert das wirklich. Ich verspreche dir, das nächste Mal spielen wir nur.«
Betty nickt langsam.
»Das Leiterspiel?«
»Ja, und Quartett!«
Betty nickt wieder, auch in ihrem Auge sieht Marie eine Träne. Sie umarmen einander. Marie fröstelt, noch ehe sie auf der Straße ist.
Sie beschließt, Betty nächstes Mal ein Geschenk mitzubringen. Eine Kleinigkeit. Ein Tuch oder einen Schal oder Handschuhe, irgendetwas, das man im Winter gut brauchen kann. Sie wird sich bestimmt freuen und der Zwist wird vergessen sein.
»Zwanzig ist viel zu wenig.«
»Fünfundzwanzig, mehr ist der nicht wert.«
»Na kommt schon«, sagt Tina.
Sie sitzen im Speiseraum, die Blechbüchsen, aus denen die Frauen zu Boden blickend ihr Mittagessen verzehrt haben, sind leer. In den meisten Büchsen findet sich jeden Tag dasselbe: eine Schnitte Polenta, ein Stück Käse, bei manchen rohe Zwiebeln. Noch fünf Minuten, bis der Klingelton die Mittagspause beendet.
»Dreißig. Mehr wirst du für den nicht kriegen.«
»Zum Ersten … zum Zweiten … und zum Dritten!«, sagt Tina theatralisch und gibt Delia den Schal, die ihn gierig entgegennimmt.
Sie kramt nach den Münzen und gibt Tina das Geld. Die Aufmerksamkeit flaut ab, die Frauen reden wieder leise in Grüppchen.
Ihr blauer Schal. Dreißig Lire. Das reicht für drei Wochen Brot und Käse, vielleicht einen Monat. Im Frühling wird es dann schon wieder leichter.
Der blaue Schal war vor zwei Jahren ein Geschenk von Tante Veronica. Sie hat die Tante, die in Turin wohnt, seitdem nicht mehr gesehen. Ein Schal, drei Wochen Essen für sieben.
Drei Wochen kein Weinen der kleinen Geschwister, wenn sie sich abends hungrig zu dritt in ihrem Bett zusammenkauern. Drei Wochen kein Blick der Mutter, unter deren Augen die Tränensäcke immer größer werden, während sie selbst immer schmächtiger wird. Yole hätte so gerne eine richtige Puppe, Benvenuto ein Schaukelpferd. Ein paar alte Lappen, mit Spagat zu einem Körper gebunden und ein Baumstumpf vor ihrem Haus müssen genügen.
Die Frauen gehen wieder an die Arbeit. Noch sechs Stunden.
Daheim wird Demetrio sicher wieder diskutieren wollen. Zuletzt hat er immer wieder gegen die Kirche und die verlogenen Pfaffen gewettert. Die Religion hat keine Zukunft. Sie wird aussterben. Die Kirchen werden abgeschafft.
Die Mutter wird sie fragen, wo der schöne blaue Schal geblieben ist.
Ach, er hat mir nie gefallen, wird sie antworten, und beide werden sich an den Moment erinnern, als sie ihn geschenkt bekommen und die Tante umarmt hat.
Beim nächsten Besuch vermeidet Marie es, über Religion zu reden. Das Spielen ist ohnehin lustiger. Und Betty hat sich so über den Schal gefreut, dass sie sie lange an sich gedrückt hat.
Sie haben Bettys Ausschneidepuppen entdeckt. Die richtigen Puppen sind ja längst Kinderkram. Sie gehen schließlich ins Mädchenlyzeum und sind schon elf. Aber da gibt es die farbigen Kartonbögen mit den Puppenfiguren und Kleidern zum Ausschneiden. Betty hat sogar eine Serie von Bögen mit kleinen Kindern und Kleidern zum Selbstausmalen. Sie malen und spielen Modeschau, die neueste Kollektion. Nur kein Wort über Religion.
Aber beim nächsten Besuch ist das Thema wieder da. Als sie sich verabschiedet, lädt Bettys Vater sie zum Leil Schabbat am Freitagabend ein. Als Marie sagt, dass sie allein sicher nicht kommen darf, sagt Herr Blum: »Na, dann laden wir deine Eltern auch ein.« Er greift zum Telefon und wählt die Nummer der Buchhandlung. Marie würde sich am liebsten unter dem Tisch verstecken. Sie hört Herrn Blum sprechen, er lacht, brummt, legt auf. Maries Vater hat die Einladung angenommen.
So sitzen sie am Freitagabend zu acht um den großen Tisch im Salon der Blums. Sie beobachtet ihre Eltern genau, als Frau Blum die Schabbatkerzen anzündet und Herr Blum den Bracha spricht. Walter und Helene werfen einander bedauernde Blicke zu. Aber sie staunen genauso wie Marie, als sie sehen, wie die Eltern alle Rituale mitmachen: Sie werfen Münzen in die kleine Schachtel in der Mitte, Tzedakah heißt das, flüstert Betty, sie sprechen die Gebete mit und murmeln die Antworten an den richtigen Stellen. Sie haben es als Kinder gelernt, es ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen, aber sie haben es nicht weitergegeben, die Tradition ist abgerissen.
Den ganzen Abend sind die Blums wie immer herzlich, Marie kommen ihre Eltern zurückhaltend vor, peinlich darauf bedacht, nirgendwo anzuecken, kein politisches oder religiöses Thema anzusprechen. Auch die Gastgeber scheinen jedes Thema zu vermeiden, das mit dem Judentum zu tun hat. Sie reden über Fürth, die neuesten Fabriken und Geschäfte.
»Wir schätzen Ihre Buchhandlung sehr«, sagt Bettys Vater. »Zu Oerter gehe ich nicht so gerne.«
»Ja, Oerter, der alte Anarchist. Aber seine Leihbücherei geht gut. Er macht etwas für die, die sich keine Bücher leisten können. Die sind aber nicht meine Kundschaft.«
»Natürlich nicht. Ich stehe diesen politischen Strömungen auch skeptisch gegenüber. Er soll sich ja selbst als Schriftsteller betätigen.«
»Ja. Wie gesagt, nicht meine Welt. Ich habe zwar große Sympathien für die Rechte der Arbeiter, aber Anarchismus, nein.«
Marie versteht wenig von der Unterhaltung. Herr Oerter soll ein Anarchist sein, fast nur noch anarchistische Bücher haben, außerhalb der Buchhandlung ist er immer nur mit seinem Leiterwagen zu sehen, auf dem er Lithografieplatten für irgendwelche Drucke nach Muggenhof bringt. Manchmal zieht auch die Frau den Leiterwagen, immer hat es den Anschein, als würde etwas Geheimes transportiert werden.
Als sie später ihren Vater fragt, was Anarchist und Lithografie bedeuten, sagt er: »Das ist einer, der keine Ordnung anerkennt. Keinen Kaiser, keinen Bürgermeister, keinen Polizisten, keine Gesetze, keinen Staat. Das sind so Menschen, die wollen eine Welt, wo jeder macht, was er will. Aber so kann man nicht leben. Das sind einfach Spinner, Marie. Die nimmt niemand ernst. Und das mit der Lithografie erkläre ich dir morgen. Ich habe ein Buch darüber in der Buchhandlung.«
Aber am nächsten Tag macht Marie lieber einen Abstecher in die Altstadt – sie liebt die putzigen Fachwerkhäuschen mit den Schieferschindeln – und schleicht durchs enge Pfarrgässchen, um an dem schmalen Haus von Herrn Oerter, das wie ein Schiffsbug aussieht, vorbeizugehen. An der Tür, die sich an der Schmalseite befindet, hängt eine große Glocke. Sonst nichts Auffälliges.
Eine Welt ohne Gesetze, wo jeder macht, was er will. Nein, das kann nicht gut gehen. Sie denkt an ihre Klasse. Wenn da jede machen würde, was ihr in den Sinn kommt, gäbe es wohl keinen Unterricht.
Am Abend liegt sie wach im Bett und verscheucht die Gedanken, die hochsteigen. Eine Welt, in der alles erlaubt ist. Keine Regeln. Alle sind frei, das zu tun, was sie wollen. Irgendwie klingt es ja schön. Dass es sogar Erwachsene gibt, die davon träumen! Aber es ist wohl Zeitverschwendung. Sie muss lernen, lernen, lernen, wenn sie mehr werden will als bloß die Nachfolgerin des Vaters, auf ewig gefangen in der kleinen Buchhandlung in der Industriestadt mit den Tausenden Spiegeln. Marie fragt sich, warum die Leute auf die Spiegelfabriken stolz sind. Fürth, die Spiegelstadt. Fürth, die Stinkestadt müsste es heißen. Sie weiß sogar, wie der Stinkestoff heißt: Ammoniak. Das riecht wie die verweste Maus, die Marie einmal am Dachboden gefunden hatte. Der Vater hat erzählt, dass die Leute, die dort arbeiten, bald zu husten beginnen und früh sterben wegen dieses Ammoniaks. Aber noch immer besser als das Quecksilber früher, hat der Vater gesagt.
Nein, hier in der Stinkestadt will sie nicht bleiben. Sie will Ärztin werden, weit weg gehen, am besten als Urwaldärztin nach Afrika. Mit dem Gedanken an den Dschungel und an exotische Blumen schläft sie ein.
Der Geruch des Flieders wirft sie fast um.
Über Nacht ist es Frühling geworden, nach einer Woche Regen sind die Blüten explodiert. An diesem strahlenden Samstagnachmittag sieht sie erst die vielen Farben, riecht den Jasmin und den Flieder, überall Flieder. Unter der Woche ist sie zwölf Stunden in der Fabrik, am Samstag acht. In der Morgendämmerung bei Regen außer Haus, in der Abenddämmerung der Heimweg.
Und jetzt diese Explosion. Sie geht den Wassergraben entlang, überall Farben, schreiend gelbe Forsythien, es tut ihren Augen fast weh. Sie könnte tanzen, was für ein lächerlicher Gedanke, sie ist viel zu müde, kommt sich vor wie ein Höhlenmensch, dessen ganze Armseligkeit im grellen Licht allen, die ihr entgegenkommen, offenbar wird.
Schon wieder ist in der Fabrik von Streik die Rede gewesen, in ganz Friaul wollen sie nächste Woche die Arbeit niederlegen, haben die Frauen gesagt, die heimlich zu den Treffen der Gewerkschaft laufen. Den Zehnstundentag wollen sie erkämpfen. Was macht das für einen Unterschied, hat sie zu Delia gesagt. Die Finger sind so oder so geschwollen, die jungen Frauen bekommen ohnehin bald Kinder, bei den älteren Frauen gehen die aufgedunsenen Beine auch nie mehr weg.
Sie muss lächeln, als sie Yole und Benvenuto in der Tür stehen sieht. Als sie die große Schwester erblicken, laufen sie ihr entgegen, umarmen sie, sie ist ihre Heldin, die sie am Leben erhält, zu der sie in der Nacht ins Bett kriechen können, wenn ihnen kalt ist. Sie ziehen sie ins Haus hinein, wollen, dass sie mit ihnen spielt.
Aber nicht jetzt. Erst ausruhen. Mutter hat ihr ein Stück Polenta aufbewahrt, sie isst es mit Milch und Gerstenkaffee und legt sich dann hin.
Das Geld des Schals wird demnächst aufgebraucht sein, aber bald ist Sommer, dann ist es leichter, die ersten Frühäpfel auf den Streuobstwiesen im Süden der Stadt werden für gutes Apfelkompott sorgen.
Sie isst und denkt an gar nichts, da ist nur Leere. Nach ein paar Minuten steht sie wieder auf, doch ihre Geschwister sind verschwunden, spielen draußen. Sie nimmt die Zeitung, die auf dem Tisch liegt. Die gestrige Ausgabe von Il Lavoratore. Die politischen Sachen interessieren sie nicht, Streik, Karl Marx über Triest, Abdruck eines Artikels, den der Mann mit dem weißen Rauschebart schon 1856 geschrieben hat. Sie blättert weiter, da: der Roman in Fortsetzungen. Der Onkel bringt die Zeitung nicht jeden Tag mit, aber der Roman ist wohl mit Vorsatz so geschrieben, dass man der Handlung jederzeit folgen kann. Dass der halbseitige Text immer im spannendsten Moment aufhört, lässt sie jeden Tag der Fortsetzung entgegenfiebern.
Wenn sie diesen Roman liest, so hat sie vor ein paar Tagen zu Delia in der Fabrik gesagt, vergesse sie alles um sich her. Während der Akkordarbeit klammert sie sich an Sätzen fest, die ihr im Gedächtnis geblieben sind, hängt an einzelnen Wörtern, und so übersteht sie den Tag. Wie die Alten mit ihren Heiligen, hat Delia gesagt und davon erzählt, dass einige ältere Frauen in der Fabrik zwischendurch in ihre Schürzentasche greifen und ein Heiligenbildchen umklammern, das ihnen Hoffnung gibt.
Sie blättert weiter. Eine Annonce für einen Englischkurs. Es wäre nicht schlecht, vielleicht könnte sie Geld dafür zusammensparen. In Amerika würde sie Englisch brauchen.
Amerika.
Als sie an ihren Vater denkt, steigen ihr die Tränen in die Augen. Warum hatte er verdammt noch mal immer noch nicht genug Geld, um sie nachzuholen? Spart er nicht? Kann er nicht rechnen?
Sie schlägt die Zeitung zu.
Sie muss weg!
Beim nächsten Besuch machen sie nur die Hausübung. Immer noch Turmrechnungen, diesmal mit Multiplikation und Division. Ihr schwirrt der Kopf. Auch Betty ist müde.
»Von mir aus kannst du heute ruhig noch mit Papa über Religion reden. Ich setze mich dazu und mache am Webrahmen weiter.«
»Wenn du meinst«, sagt Marie. »Aber ich werde nicht mehr so lange bleiben.«
»Dann schauen wir, ob wir Papa wieder stören können«, sagt Betty und nimmt den Webrahmen und die Wolle.
Marie folgt ihr. Gott sei Dank hat sie die Hausübung aus Handarbeiten schon erledigt.
Im Wohnzimmer fragt Marie Herrn Blum, ob ein Buch wirklich heilig sein kann. Es besteht doch nur aus Papier, Druckerschwärze und Leder. Sie hat gestern den halben Tag darüber gegrübelt.
»Du stellst gute Fragen. Aber darüber könnte man lange reden«, sagt Bettys Vater. »Ich weiß nicht, ob ich das kurz erklären kann. Du weißt ja, dass unsere Religion eine Religion des Buches ist. Die Torah ist das Kostbarste im Judentum. Es ist das Wort von Gott, gepriesen sei sein Name. Die Torah ist heilig. Wir haben noch andere heilige Bücher, aber keines reicht an die Torah heran. Weder die Propheten noch die anderen Schriften. Es sind einfach Gottes Worte. Jeder Satz, jedes Wort, jeder Buchstabe darin ist heilig. So heilig, dass wir den hebräischen Urtext lesen und nicht irgendeine Übersetzung. Wie du weißt, fassen wir die Torah auch nicht mit bloßen Händen an. Und deswegen schätzen wir Bücher generell vielleicht mehr als Angehörige anderer Religionen.«
»Auch die Bücher, die nicht zur Religion gehören?«
»Ja, auch die. Jedes gedruckte Wort ist Ausdruck von Kultur, auch wenn sie oft nicht mehr so sichtbar ist. Wo es keine Bücher gibt, herrscht Barbarei.«
Marie versteht nicht ganz, was Herr Blum meint. Aber es klingt gut. Als sie zu Hause dem Vater diese Worte wiederholt, wiegt er den Kopf.
»Mit der Barbarei hat Herr Blum schon recht. Aber jedes Buch würde ich nicht für kostbar halten. Herr Blum hat wahrscheinlich keine Ahnung, wie viel Schund es gibt. Es gibt leider immer mehr davon. Nein, nein, in unserem Laden gibt es das nicht. Weißt du, Marie, ich achte darauf, dass die Bücher ein gewisses Niveau haben. Du verstehst vielleicht noch nicht, was ich meine, aber du musst früh genug lernen, das Wertvolle von dem Wertlosen zu unterscheiden. Die Kunden werden es dir danken.«
Die letzten Worte sind wieder wie Stiche auf der Haut. Sicher hat Vater sie aufmunternd gemeint. Aber für Marie bedeuten sie schon wieder eine Einengung. Der Vater merkt es gar nicht mehr. Er rechnet damit, dass sie ihm nachfolgt. Aber sie weiß, was sie werden will. Keine Buchhändlerin. Sondern Ärztin. Sie wird Medizin studieren, Englisch lernen und weit weg gehen.
Noch immer muss sie lachen.
Die anderen haben nichts verstanden.
Dabei hat sie mit Delia nur geblödelt, banale Sachen gesagt, nur die ersten Worte des Kurses wiederholt. How do you do? Thank you, I’m fine.
Die anderen Frauen haben misstrauisch geschaut und sich an die Stirn getippt. Ihr mit eurer Geheimsprache. Mehr Aufmerksamkeit bekamen sie nicht.
Schließlich beginnt jede hier einmal durchzudrehen, ob sie vor sich hin summt, Selbstgespräche führt oder sinnlose Silben von sich gibt. Es gibt auch immer wieder Frauen, die zu trinken beginnen, billigen Fusel. Sie lassen bald in der Leistung nach und werden schnell gekündigt.
Aber Delia und sie machten sich einen Spaß! Sie haben die englischen Worte bedeutungsvoll ausgesprochen und immer wieder lachen müssen, als die anderen Frauen müde böse Blicke auf sie warfen.
Mutter sagt kein Wort, als Tina beim Abendessen davon erzählt und immer wieder lacht. Auch Yole und Benvenuto bleiben ernst. Die Polenta will ihr nicht schmecken. Was hat sie schon wieder falsch gemacht? Darf man nicht einmal ein bisschen Spaß haben?
Später, als sie mit ihren Geschwistern auf der Bank vor dem Haus sitzt, kuschelt sich Yole an sie.
»Sei nicht traurig. Mutter hat nichts gesagt, weil sie dir nicht wehtun wollte«, sagt Yole.
»Sie hat wieder kein Geld.«
»Aber ich habe …«, beginnt Tina und rechnet nach. Drei Wochen ist es her, dass sie der Mutter ihren Lohn abgeliefert hat. Und den Englischkurs hat sie sich vom Mund abgespart. Sie hat alles genau berechnet.
Kein Geld mehr? Vermutlich diese Inflation, von der in der Fabrik alle redeten. Die Sachen werden immer teurer.
Sie löst sich aus der Umklammerung ihrer kleinen Schwester und geht ins Haus. Stimmt das wirklich? Muss sie auf ihren Englischkurs verzichten, den ein arbeitsloser, alkoholkranker Lehrer jede Woche in einem Kellerlokal ein paar Arbeiterkindern gibt, die vom Auswandern träumen? Sie muss Mutter sofort fragen. Als sie die Schwelle überschreitet, hält sie inne. Nein. Es wäre zwecklos. Mutter würde es nicht zugeben, würde sie beschwichtigen, sie anlügen. Sie stampft mit dem Fuß auf den Lehmboden des Laubengangs. Wann hört diese Armut endlich auf? Ist die Familie dazu verdammt, immer arm zu sein und zu hungern? Gibt es wirklich keinen anderen Weg als Streik und Revolution, um aus diesem Jammer herauszukommen?
Sie dreht um und nimmt Yole wieder in den Arm. Sie streicht ihrer Schwester übers Haar.
»Ich werde den Kurs nicht mehr besuchen, dann haben wir wieder zu essen. Delia kann mir ja bei der Arbeit beibringen, was sie in der letzten Stunde gelernt hat. Es ist so lustig, in der Fabrik in der Geheimsprache zu reden!«
Der Kloß im Hals geht nur langsam weg.
Anfang Dezember beginnt sie Hebräisch zu lernen, aus einem Buch, das ihr Bettys Bruder geborgt hat. Auch Betty lernt mit, obwohl sie zunächst weniger interessiert war. In der Schule schicken sie einander Briefchen mit hebräischen Buchstaben, die deutsche Wörter wiedergeben sollen. Es ist ihre Geheimschrift, die die Buben, die solche Briefchen oft abfangen, nicht entziffern können.
Als sie das nach zwei Wochen ihrem Vater erzählt, ist er weniger überrascht, als sie erwartet hat.
»Ist ja gar nicht schlecht, dass du das lernst«, sagt er. »Vielleicht haben wir auch einmal Judaica, die sollen immer besser gehen. Da ist es ganz gut, wenn eine Buchhändlerin weiß, was sie verkauft. Vernachlässige nur die Schule nicht.«
Marie nickt. Sie weiß nicht genau, was der Vater meint, aber eines ist ihr klar: Wieder denkt er nur ans Geschäft und an ihre Zukunft als Buchhändlerin.
Er erklärt ihr, dass es immer mehr Bücher auf Hebräisch gibt, auch in Deutschland werden welche gedruckt. Es gebe wieder viele Juden, die die Sprache ernsthaft lernen, sicher eine Mode, die vorübergehen werde.
Als sie ihm von den Briefen erzählt, die sie Betty schreibt, lacht der Vater.
»Ihr habt da etwas erfunden, das es so ähnlich schon gibt. Ihr schreibt deutsche Worte mit hebräischen Buchstaben, habe ich das richtig verstanden?«
Marie nickt. Und sie dachte, sie wären die Ersten!
»Du kennst doch die Familie Moskowitz, die die Milchhandlung hinterm alten Ludwigsbahnhof betreibt. Die stammen aus Polen. Du weißt ja, wie die reden.«
Marie erinnert sich, dass sie einmal dort Milch holen war, als der Milchladen um die Ecke geschlossen hatte. Die Moskowitz redeten ein seltsames Deutsch.
»Das ist Jiddisch oder Mameloschen, wie sie sagen, das reden sie im Osten. Es gibt immer mehr Autoren aus Polen und Russland, die Bücher in diesem Dialekt schreiben, also auf Jiddisch. Mit hebräischen Buchstaben, so wie ihr. Es gibt sogar Zeitungen, die so gedruckt sind.«
Marie ist ein wenig enttäuscht. In ihrem Zimmer steht sie dann lieber am Fenster und schaut durch die kohlenrußige Scheibe auf die Bahnhofsanlagen und die dahinterliegenden qualmenden Fabrikschlote. Eines Tages möchte sie weg von hier.
Das Fuhrwerk des Kohlenhändlers hat einen Berg Kohle auf die Straße gekippt, ein Arbeiter schaufelt die schwarzen Brocken durch ein Fenster in den Keller des Nachbarhauses. Aus seinem Mund dampft der Atem. Er legt die Schaufel beiseite, nimmt eine Harke und verschwindet in der Tür.
Jetzt!
Die Kinder laufen los. Eine Minute haben sie, mehr nicht, während der Arbeiter innen unter dem Fenster den Kohleberg mit der Harke abflacht, damit Platz für die nächsten Schaufelvoll ist. Die drei Kinder laufen zum schwarzen Haufen, Tina hat einen Eimer, Yole und Benvenuto alte Milchkannen. In Windeseile stopfen sie die Kohlebrocken in ihre Gefäße, die Hände sind sofort schwarz, Tina will lachen, aber sie müssen schnell machen, keine Zeit zu blödeln. Jedes Stück bedeutet ein bisschen mehr Wärme, ein bisschen weniger frieren. Tina weiß, dass es nicht recht ist, was sie tun, aber der Nachbar hat genug Kohle für zwei Winter! Sie hören den Mann im Keller mit dem Rechen hantieren, fluchen und ausspucken. Der Kohlenstaub. Als es still wird, macht Tina ein Zeichen, die Kinder laufen zurück, Benvenuto stolpert, Tina hilft ihm auf, hinein ins Haus. Hoffentlich hat sie niemand gesehen. Tina lugt aus der Tür hervor. Der Mann hat ein schwarzes Gesicht, er spuckt mehrmals aus und macht sich wieder ans Schaufeln.
Sie begutachtet die Beute. Alles zusammen eineinhalb Eimer. Benvenuto hat schwarze Streifen im Gesicht, Yole lacht. Tina versucht ein Lächeln.
»Wir gehen noch mal«, sagt sie zu den beiden. »Dann haben wir es schön warm.«
Sie werden sparen mit der Kohle, immer nur ein kleines Stück dazu zum Holz, dann werden sie länger auskommen. Zu Weihnachten werden sie etwas mehr in den Ofen tun. Der Winter hat gerade erst angefangen.
In den Weihnachtsferien ist sie wieder bei Betty. Die Blums haben Besuch, Familie Feistmann, Vater, Mutter und der kleine Rudi. Marie stellt sich vor, gibt den Erwachsenen die Hand. In der Wohnung der Blums ist es heiß, Bettys Vater heizt, was das Zeug hält. Erst seitdem sie zu Betty geht, fällt ihr auf, dass ihre Eltern nie Besuch bekommen, sie sind auch nie wo eingeladen. Ein paarmal sind sie bei Verwandten in Halle gewesen, wo sich Marie nur gelangweilt hat. Im Vorjahr hat der Vater seinen Bruder in Turin besucht, Onkel Hugo, aber allein. Haben ihre Eltern Freunde? Es gibt den Lesekreis der Buchhandlung einmal im Monat, aber sind das Freunde? Und die Mutter geht zwar einkaufen, redet mit der Bäckerin und der Gemüsefrau, aber sonst bleibt sie zu Hause, kümmert sich um den Haushalt und macht die Buchhaltung. Dass sie Besuch von einer Freundin bekommen hätte, daran kann sich Marie nicht erinnern. Nein, jemanden einladen und eingeladen werden, das gibt es im Hause Rosenberg einfach nicht.
Die Erwachsenen trinken Kaffee, Betty und Marie müssen sich um den kleinen Rudi kümmern. Betty kann den Kleinen nicht leiden, er ist für seine fünf Jahre völlig ungezogen. Was immer ihm die Mädchen sagen oder verbieten, er gehorcht nicht. Seelenruhig räumt er Bettys alte Spielzeugtruhe aus und wirft die Puppen auf einen Haufen. Auf Bettys Mahnung hin schaut er sie nur frech an und macht weiter.
»Sein Opa ist neulich gestorben, er konnte sich nicht einmal am Grab ordentlich benehmen«, sagt Betty.
Erst als er einen alten Baukasten mit Holzklötzen ausgrabt, beginnt er zu bauen und ist für eine Weile still. Marie freut sich, dass sie mit Betty wenigstens eine Partie Pachisi spielen kann.
Später wird zum Abendessen gerufen, die Mädchen sitzen mit Rudi an einem eigenen Kindertisch, den der Vater aus einem kleinen Tisch und einer darübergelegten Platte improvisiert hat.
Später, als Mutter Feistmann mit dem quengelnden Rudi ins Nebenzimmer geht und die beiden Mädchen allein am Tisch sitzen, sagt Betty: »Sie gehen nach Berlin. Gott sei Dank, ich kann diesen Frechdachs nicht ausstehen.«
»Nach Berlin?«
»Ja, in die Hauptstadt. Papa hat gesagt, die Leute dort trinken mehr Kaffee.«
Marie versteht überhaupt nichts. Betty erklärt ihr, dass Rudis Vater eine kleine Fabrik betreibt. Aus getrockneten Wurzeln von Blumen und Salatpflanzen stellt er Kaffee-Ersatz her. »Den dürfen die Kinder auch trinken und er ist auch nicht so bitter. Und nicht so teuer, deswegen kaufen ihn die ärmeren Leute.«
Marie mag keinen Kaffee, aber davon hat sie schon gehört. Kaffee-Ersatz.
»Manche sagen Muckefuck dazu«, sagt Betty.
»Muckefuck, Muckefuck«, sagt Marie so lange, bis Betty einstimmt und sich beide vor Lachen krümmen. Die Väter, die am Tisch verblieben sind, drehen sich zum Kindertisch, lächeln.
»Jetzt werden die Berliner den Muckefuck trinken«, flüstert Betty und wieder müssen sie beide lachen.
Sie schreit, auch Yolanda vor ihr kreischt, Benvenuto, ganz vorne, hält sich mit der rechten Hand an der hohen Kufe fest, mit der linken bedeckt er seine Augen und lacht. Die Rodel saust die Arkaden entlang, hinter ihnen folgt die nächste, drei Burschen.
Sie haben sich den Schlitten ausgeborgt, gleich müssen sie ihn wieder zurückgeben, die Buben warten schon, als sie unten an der Piazza ankommen.
Da stehen auf einmal zwei Männer neben ihnen. Sie halten die Buben an den Köpfen fest, Tina sieht zuerst nicht genau, was sie tun. Als Tina von der Rodel steigt, erkennt sie den einen: Es ist der Kastellan vom Schloss oben, dort, wo ihre Rodelpartie begonnen hat. Sie weiß, dass es verboten ist, am Aufgang zum Castello zu rodeln, aber sonntags ist der Kastellan für gewöhnlich nicht da. Haben die Buben gesagt. Seit das Castello ein Museum ist, seit vier Jahren, ist am Wochenende niemand mehr da.
Die Männer ziehen die Buben an den Ohren, die Armen stehen schon auf den Zehenspitzen, sie beginnen zu stöhnen. Zack, eine Ohrfeige, zugleich lässt der Kastellan den einen Buben los, der fällt in den Schnee.
Als er Tina und die beiden Kleinen sieht, funkelt er sie an.
»Lumpenpack, schert euch weg. Dreckskinder!«
Der zweite Bub bekommt zwei Ohrfeigen, er taumelt, bleibt aber stehen.
»Weg mit euch!«, sagt der Kastellan. »Arbeiterkinder haben hier nichts verloren.«
Yole und Benvenuto drücken sich an Tina, die zusammenzuckt, sich duckt, sich wegschleicht, die Buben, den Kastellan und seinen Helfer zurücklassend, schnell in die Seitengasse, die dunkle, kalte. Sie wohnen Gott sei Dank gleich ums Eck, am Fuß des Burgbergs, im immerfeuchten, immerkalten Haus. Yole ist neun, Benvenuto zehn, was wird aus ihnen werden, was wird aus ihr werden, was ist das für ein schlimmes Leben, warum sind wir nicht reich, wann wird das endlich ein Ende haben, die Kälte, das Hungern, das Verzichten, das Beschimpftwerden.
Sie beuteln den Schnee von der Kleidung und öffnen die Tür zum Laubengang. In der Wohnung ist es warm, Mutter hat den Kohleofen eingeheizt, vormittags heizt ja nur der Herd.
Tina hält die Hände über den Ofen. Morgen ist sie wieder in der Fabrik, die drei Weihnachtsfeiertage sind vorüber.
Wie lange wird sie das noch aushalten? Hoffentlich holt sie der Vater bald nach. Sicher kommt bald der Brief, er muss kommen, der Vater hat schließlich versprochen, dass sie die Nächste ist.
Yole stellt sich neben sie und streckt die Hände aus. Alles macht sie nach, die kleine Schwester.
Hand in Hand gehen sie auf den Gänsberg, es ist der Silvestertag. In dieses Stadtviertel geht sie sonst nie.
In der Oststadt, wo sie wohnt, stehen neue hohe Mietshäuser, die alle gleich aussehen, die Straßen sind gerade und kreuzen sich im rechten Winkel.
Im schönen Teil der Altstadt stehen kleine, schmucke Fachwerkhäuser, manche von ihnen haben Fassaden aus Schieferschindeln und sehen aus wie ein Fisch mit Schuppen. Marie kennt die Gegend um die Gustavstraße, die Gasthöfe und Kaffeehäuser. An manchen Sonntagen geht sie mit den Eltern und Geschwistern hierher essen, im Sommer sitzen sie auch öfter draußen und spazieren dann zum Park und zum Fluss hinunter. Aber hinein in die Gänsbergsiedlung, die links von der abfallenden Königstraße liegt, sind sie nie gegangen.
Sie hat sich immer ein wenig vor diesem Viertel gefürchtet, aber mit Betty hat sie keine Angst. Was ist es, das ihr hier Angst macht? Die Häuser sind aus denselben Sandsteinquadern gebaut wie die übrige Stadt. Doch sie stehen so eng zusammen, als ob ihnen kalt wäre, und wirken dunkler und bedrohlicher. Sie bemerkt auch, dass die Fassaden keinen Schmuck tragen und die Dächer steiler aufragen als in der übrigen Stadt. Von der einzigen Straße des Viertels, der Bergstraße, die sie jetzt bergan steigen, zweigen enge und engste Gassen ab, die völlig im Dunkeln liegen. Trotz der Kälte riecht es hier nach Exkrementen, Schmierseife, Rauch und Salmiakgeist. Auch so steil ist es sonst nirgendwo in der Stadt. Sie bleibt stehen. Nein, hier war sie wirklich noch nie.
»Da rodeln die Kinder, wenn genug Schnee ist«, sagt Betty. »Komm!«
Am Eingang zu einer Gasse stehen ein paar Männer mit schwarzen Hüten zusammen. Am Eingang zur nächsten schmalen Gasse biegen zwei junge Männer in schwarzen Anzügen um die Ecke. Sie reden leise miteinander und gestikulieren umso deutlicher. Als Marie ein paar Worte aufschnappt, versteht sie auf einmal: Hier wohnen fast nur Juden. Nun weiß sie auch, warum Betty herwollte. Sie halten vor einem dreiteiligen Tor, dessen Haupteingang vergittert ist, dahinter verliert sich eine Gasse im Dunkeln. »So ein Tor kenne ich!«, sagt sie. »Da bin ich schon durchgegangen. Aber das steht doch woanders.«
»Rate mal: Es gibt zwei davon. Wahrscheinlich bist du von der anderen Seite gekommen.«
Sie zieht Marie durch die enge Gasse auf einen kleinen Platz. Ja, hier war sie schon. Sie kennt den Platz nur von der anderen Seite her. Das Gebäude da ist die Altschul, die Synagoge, gegenüber die Neuschul.
»Dort drüben habe ich dich zum ersten Mal gesehen«, sagt Betty.
»Ja, wir waren ein paarmal da zu Jom Kippur. Gibt es da nicht einen alten und einen jungen Rabbi?«
Betty lacht. »Du kennst dich wirklich nicht aus. In der eigenen Stadt! Pass auf!«
Und sie beginnt eine Führung. Sie zeigt ihr noch die Mikwa, die jüdische Schule und das Waisenhaus, das auch eine Synagoge hat, und Marie merkt zum ersten Mal, dass es so etwas wie ein jüdisches Dorf gibt, mitten in der Stadt. Die Gasse hinter der Mikwa ist noch enger, fast ein Spalt, auch Betty traut sich nicht hinein. Sie flüstert etwas von einem Schlachthaus, das es hier gibt, und der Lehrstube, wo die Buben aus dem jüdischen Waisenhaus den Talmud studieren.
Betty schubst sie weiter, mit einem Mal sind sie wieder draußen, vor ihnen der Fluss.
»Warum hast du nie erzählt, dass es in Fürth ein jüdisches Dorf gibt?«, fragt sie ihren Vater beim Abendessen.
Ihre Geschwister sehen sich an: Nicht wieder dieses Thema. Judentum hier, Torah da. Jetzt muss einmal Schluss sein, sagt Walters Blick. Helene schaut mitleidig. Marie hält den Blicken stand.
Der Vater schluckt den Bissen hinunter und räuspert sich. »Du sollst dich dort nicht herumtreiben. Das ist keine gute Gegend.«
»Aber wir sind doch auch Juden.«
Ihr Vater nickt. Walter und Helene sehen sich an und rollen mit den Augen. Die Mutter sammelt die Suppenteller ab und verschwindet in der Küche.
Der Vater tupft sich den Mund mit der Serviette ab.
»Ja, wir sind Juden. Und Walter und Helene, hört mit dem Gefeixe auf. Wir sind Juden, aber mit denen am Gänsberg haben wir nichts mehr gemeinsam. Die Großeltern, du hast ja nur noch Großvater gekannt, die haben noch so gelebt. Jetzt ist eine andere Zeit. Wir sind inzwischen Deutsche, wir haben eine andere Kultur. Wir lesen Goethe und Schiller und glauben nicht mehr, dass Moses die Torah geschrieben hat. Was nicht heißt, dass wir unsere Wurzeln vergessen haben.«
Marie glaubt zu verstehen. Mit den ärmlichen Gestalten am Gänsberg hat sie ja wirklich nichts gemein. Die sind auch keine Kunden in der Buchhandlung. Trotzdem ist da noch etwas, das sie nicht zufriedenstellt, aber sie kann es nicht in Worte fassen.
Die Mutter kommt mit einem dampfenden Topf zurück, den sie in die Mitte des Tisches stellt. Der Vater will etwas sagen, Walter und Helene tuscheln schon wieder. Er räuspert sich und bedenkt sie mit einem strengen Blick. Wenn er redet, haben alle zuzuhören.
»Ich sage ja nicht, dass Religionen schlecht sind. Die Religionen haben die Menschen jahrhundertelang getröstet und ihnen Halt gegeben.«
Die Mutter teilt das Essen aus, Saucenfleisch, es duftet herrlich, der Vater spricht einfach weiter.
»Wir haben aber jetzt ein neues Zeitalter. Die Technik entwickelt sich so schnell. Die Menschen fahren in Automobilen, fliegen in Flugzeugen und Luftschiffen und telefonieren in fremde Länder. Wenn das jemand vor zwanzig Jahren gesagt hätte, hätte man ihn für verrückt erklärt. Der Fortschritt ist jetzt die neue Religion. Es wird nicht mehr lange dauern und der Rest, der von den alten Religionen übrig ist, wird sich auflösen. Diese abergläubischen Reste haben in der modernen Zeit nichts mehr verloren. In zehn, zwanzig Jahren wird man darüber lachen. So, und nun essen wir.«
Marie versteht überhaupt nichts. Sie isst schweigend. Walter erzählt von einem Freund, der seit neuestem Boxunterricht nimmt.
Marie hört nicht zu. Ihre Schulfreundinnen werden nicht mehr in die Kirche und in die Synagoge gehen, wenn sie erwachsen sind? Vielleicht hat der Vater recht. Die Buben, die sie kennt, reden von nichts anderem mehr als von Automobilen und Flugzeugen. Bei Flugzeugen muss sie an Bettys Bruder Isaak denken.
»Darf ich noch etwas fragen?«
»Du kannst es ohnehin nicht lassen«, sagt der Vater grinsend und schöpft sich einen Nachschlag in den Teller.
»Isaak hat erzählt, dass sich zurzeit so viele junge Leute für den Glauben interessieren. Und es gibt sogar einige, die nach Palästina gehen, um dort ein neues Land aufzubauen.«
Der Vater schluckt den Bissen hinunter.
»So eine Schnapsidee. Man nennt sie Zionisten. Die glauben, sie können in der Wüste zurück zum alten Israel. Das sind Spinner, Marie. Wir sind Deutsche, reden Deutsch, lesen Deutsch, verkaufen deutsche Bücher. So wird es immer bleiben. In zwanzig Jahren wird keiner mehr wissen, dass wir Juden sind, es wird auch keine Rolle mehr spielen. Wir leben in einer Zeit der Toleranz, auch wenn es noch einige radikale Verrückte gibt. Die Welt entwickelt sich weiter. Wie schon gesagt, der Fortschritt ist die neue Religion.«
Marie nickt und blickt zu ihrem Bruder, der sie mitleidig ansieht. Ihre Geschwister halten nichts von dem Gerede über Religionen.
Die Mutter bringt den Nachtisch, Kirschkompott in einer Glaskugelschüssel. Marie löffelt, spuckt die Kerne aus und legt sie auf den breiten Rand der Kompottschale. Sie wird weiter Hebräisch lernen. Das Abitur machen. Und dann Ärztin werden, jüdische Ärztin. Nicht Buchhändlerin. Nicht Hausfrau. Nicht Sekretärin.
Plötzlich prustet ihr Bruder los, die Schwester lacht mit. Sie hat nicht gehört, was sie gesprochen haben.
Sie blickt zu ihnen, dann löffelt sie weiter.
Und sie will auch nicht so werden wie ihre Geschwister.