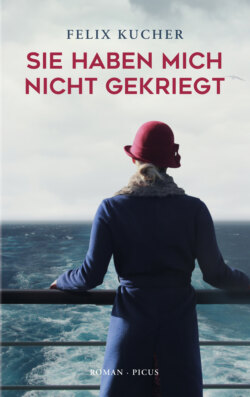Читать книгу Sie haben mich nicht gekriegt - Felix Kucher - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1902
ОглавлениеSie sitzt auf den Schultern des Vaters. Viele Menschen stehen um sie herum, sie betrachtet sie verwundert von ihrem Hochsitz. Sonst sieht sie nackte Knie oder abgewetzte Hosen, Schürzensäume, Wälder aus Beinen, alles um sie ragt hoch auf. Und jetzt ist sie über ihnen, sieht auf sie hinunter. Sie reden laut, rufen etwas, dann singen sie gemeinsam und rufen wieder. Sie schwenken kleine Fahnen. Die lauten Stimmen machen ihr Angst. Auch ihr Vater singt, sie spürt die Vibrationen. Aber bedrohlich ist es dann doch nicht, die Menschen sind fröhlich.
Dann sind alle ruhig. Jemand redet, weit weg. Die Stimme klingt seltsam. Die Leute rufen Worte im Chor, singen wieder laut. Sie versteht die Worte nicht, es ist eine andere Sprache, wird ihr Vater später sagen, du wirst sie später in der Schule lernen. Vater, lass mich runter.
Baracken, dazwischen schlammige Erde, es hat geregnet. Offene Feuer brennen, darüber sind riesige Pfannen. Frauen rühren in den Pfannen Polenta, da, koste, sagt die Mutter und reicht ihr mit dem riesigen Holzlöffel einen Brocken. Sie schreckt zurück, heiß dampft es weg von dem gelben Kloß. Die Mutter bricht ein Stück ab, bläst darauf und reicht es ihr. Der noch immer heiße Kloß schmeckt süßlich, heute ist Sonntag, es gibt genug zu essen, da tut der Bauch am Abend nicht so weh.
Viel später weiß sie, dass das Bauchweh Hunger heißt.
Der Vater isst am Abend nie mit. Ich habe schon in der Fabrik gegessen, sagt er, als die Mutter ihm eine Kartoffel oder einen Polentakloß anbietet.
Sie spürt, dass etwas nicht stimmt. Jahre später wird ihr die Mutter erzählen, dass der Vater gelogen und zugunsten der Kinder auf das Abendessen verzichtet hat.
Einzelne Bilder, Worte, kurze Szenen.
»Mama, warum hat uns der Junge Polentafresser genannt? Ein anderer hat Katzelmacher gesagt.«
»Warum schauen die Menschen uns so an, wenn wir einkaufen gehen?«
Wieder auf den Schultern des Vaters. Erster Mai heißt der Tag. Ein neues Jahrhundert.
»Schau, Tina, so viele verschiedene Menschen. Deutsche, Italiener und Slowenen. Aber wir sind alle Arbeiter. Wir sind alle Brüder, wie gefällt dir das? Ist das nicht herrlich?«
Sie freut sich für ihren Vater, er vibriert unter ihr, ruft immer wieder Worte in die Menge. Rot-schwarze Fahnen überall. Und wieder lauter Gesang. Immer wieder dieselbe Melodie. Sie versteht nicht, was die Menschen singen. Die Menschen haben Zettel in ihren Händen. Die Internationaa-le er-kä-mpft das Mee-nschenrecht. Dann wird die Melodie noch einmal gesungen, sie versteht wieder nichts, obwohl es diesmal die Sprache ist, die ihre Eltern zu Hause mit ihr sprechen.
Dann wieder: Polentafresser! Katzelmacher!
»Mama, warum rufen uns die Buben das nach?«
»Wir essen eben Polenta, sie meinen das nicht böse.«
»Warum wohnen wir nicht in einem richtigen Haus wie die anderen?«
»Wir werden bald in eine richtige Wohnung ziehen. Die Holzbaracken sind nur für die, die noch nicht so lange hier sind.«
Polenta gibt es jetzt öfter, am Sonntag mit Zucker und Zichorienkaffee. Die Tage mit Brot heißen Montag, Mittwoch und Freitag.
Der Vater bekommt die Polenta in der Firma. Er macht Fahrräder aus Bambus. Der Chef ist Herr Kollitsch.
»Kollitsch Kollitsch Kollitsch«, sagt Tina. Was für eine lustige Sprache. Die Menschen in den Baracken reden alle verständlich, die Menschen in der Stadt versteht Tina nicht.
»Du wirst die Sprache noch lernen«, sagt Mama, »das ist Deutsch. Vielleicht können wir hierbleiben. In Österreich gibt es Arbeit.«
Einmal ist ein Gast da. Papa hat ihn mitgebracht, von der Arbeiterversammlung im Hotel Grömmer in Klagenfurt, Herr Pittoni aus Triest.
»Onkel Demetrio ist auch da, du kennst doch noch deinen Onkel? Er ist dein Taufpate, obwohl er Kommunist ist, aber das verstehst du ja noch nicht. Wenn die Kommunisten gewinnen, müssen wir nicht mehr hungern. Jetzt nehmen uns die Reichen noch alles weg. Wo ist denn Trina?«
Trina. Ihre Puppe.
Onkel Demetrio lacht und gibt ihr ein Geldstück.
»Giosuè, der Nachbar, hat sie geschnitzt«, sagt ihre Mutter, »ich habe ihr dann ein Kleid aus einem Stoffrest gemacht.«
Mit sieben dann die erste Klasse. In der Volksschule St. Ruprecht bei Klagenfurt sind die Hälfte der Kinder Italiener, sie verstehen fast kein Wort des Lehrers. Katzelmacher!, hört sie noch vor Beginn der ersten Stunde. Slowenenkinder sind auch da, sie sind ganz still.
Aber sie ist vorbereitet. »Ich bin seit meinem ersten Lebensjahr in Österreich«, sagt sie auf die Frage des Lehrers, warum sie so gut Deutsch spricht. »Und mein Vater hat viele deutsche Freunde.«
Sie denkt an die Männer, die Vater manchmal besuchen und mit denen er diskutiert. »Papa, was heißt: Arbeiter? Was ist ein Proletarier? Wann gehen wir wieder zurück?«
Wenigstens gibt es in der Schule ein Essen, Schulspeisung, endlich für kurze Zeit satt sein, die Wurst ist köstlich, manchmal gibt es sogar Kekse.
Und wieder ist Erster Mai. Die Straßen sind geschmückt, Leute marschieren, singen. Sie horcht hin, die Redner sprechen Deutsch, dann auch Italienisch und Slowenisch. Revolution. Rivoluzione. Revolucija.
Eines Abends kommt der Vater spät nach Hause, er ist verärgert.
»Papa, was ist denn, wir waren doch ganz brav?«
»Es ist nicht wegen euch, es ist wegen der Arbeit.« Er trinkt zwei Becher Wein, sie haben noch immer keine Gläser, nur die Becher aus glasiertem Ton. Er geht früh schlafen.
»Mama, was ist denn?«
Dreimal am Tag bekommen sie zweihundert Gramm Polenta und Käse, von sechs in der Früh bis vier Uhr am Nachmittag, das wird ihnen noch vom Lohn abgezogen. »Ach Tina, das verstehst du doch nicht. Papa findet das nicht gerecht, wie die Arbeiter behandelt werden und er möchte das ändern.«
»So wie Onkel Demetrio?«
»Genau, Tina. Alles wird sich ändern. Es kann nicht mehr so weitergehen. Wenn du groß bist, wird es keine Ungerechtigkeiten mehr geben. Alle werden gleich viel haben. Die Revolution wird kommen, das verstehst du noch nicht.
Vielleicht gehen wir auch nach Amerika. Alle zusammen. Mercedes, Tina, Valentina, Gioconda, Yole und der kleine Benvenuto.« Die Mutter streichelt den Kopf des Jüngsten, den sie gerade stillt. Die anderen sitzen auf dem großen Diwan um sie herum, Mercedes ist elf, Tina acht, beide helfen der Mutter und wickeln ihre jüngeren Geschwister, helfen bei der Wäsche und in der Küche.
»In Kalifornien scheint immer die Sonne. Dort ist es nie so feucht wie hier in der Baracke, alles ist trocken. Dort können auch die Armen etwas werden. Jeder hat eine Chance. Dort gibt es keine Grafen und Großgrundbesitzer.«
Mercedes sagt: »Tina, dort werden wir auf Pferden reiten. Vater wird als Erster gehen, das wird schon nicht so schlimm. Wir sind ja noch zu klein. Aber dann kommen wir nach und werden in einem schönen Haus wohnen, ganz aus weißen Brettern.«
Tina schaut auf die Holzbohlen, die die Wand der Baracke bilden. Sie sind sägerau, immer wieder zieht sich ein Kind einen Speil ein. Ein Haus aus weißen Brettern kann sie sich nicht vorstellen.
Es ist ihr zweiter Geburtstag. Sie sitzt auf einem Stuhl, der mit einem Tuch verhüllt ist.
In Wirklichkeit sitzt sie auf dem Schoß ihrer Mutter. Der Fotograf hat eine große Decke mit Blumenmuster über sie geworfen, Marie sitzt auf dem Schoß ihrer unsichtbaren Mutter. Sie kann sich nicht mehr erinnern, aber ihre Mutter hat es ihr oft erzählt. Ich bin bei dir, hab keine Angst, hat sie gesagt. Der Fotograf hat das Bild dann so zugeschnitten, dass die Zweijährige vor einem endlosen Blumenstoff erscheint. »Hidden mother photography« nennt man das, wird sie viel später lernen, in einem anderen Land, in einer anderen Sprache.
Nein, Erinnerungen hat sie nicht mehr viele an diese Zeit. Der Großvater hat noch gelebt, er hatte einen nach allen Richtungen abstehenden weißen Bart und immer etwas Süßes für sie in der Tasche seines Bratenrocks. Die Möbel sind immer dieselben gewesen, sie kann sich nicht erinnern, dass es einmal andere Stühle oder eine andere Anrichte gegeben hätte. Der Vater geht jeden Tag zur Arbeit in die Buchhandlung. »Wenn du groß bist, wirst du auch arbeiten«, sagt die Mutter.