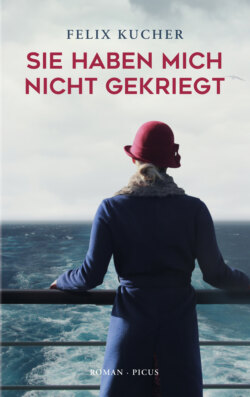Читать книгу Sie haben mich nicht gekriegt - Felix Kucher - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1918
ОглавлениеDer Zug ruckelt und wird langsamer. Sie blickt aus dem Fenster. Wenigstens der Fürther Bahnhof sieht aus wie immer, die fahlen Steinblöcke, aus denen die halbe Stadt erbaut ist, schimmern in der Abendsonne. Kein anderer Zug steht auf einem Gleis, die Bahnsteige sind leer. Die gesamte Fahrt von Halle an der Saale bis Nürnberg ist wie eine Fahrt in der Geisterbahn auf der Kirmes gewesen. Auf eintönig graue Felder und blätterlose Bäume folgten überfüllte Bahnhöfe, auf deren Perrons sich Soldaten drängten, zerlumpte Gestalten mit Kopfverbänden und Krücken, ausgemergelt, müde, verzweifelt. Der Krieg ist verloren, seit vier Tagen offiziell beendet. So viele Wochen und Monate haben alle das Ende herbeigesehnt, haben Unterhändler sich bemüht, aber der Kaiser wollte nicht einlenken. Und nun ist er abgesetzt, geflohen in die Niederlande.
Langsam rollt der Zug ein. Dort, wo der junge Mann ihr im Abteil gegenübergesessen ist, ist noch eine Vertiefung im Polster zu sehen. Vielleicht bildet sie sich das aber auch ein. Sie hat ihm zuerst zögernd, dann umso bereitwilliger über ihre Zeit in Halle erzählt: Ihre auswärtige Lehrzeit ist zu Ende, sie kehrt heim. Ein halbes Jahr bei Kompitz in Halle. Nach eineinhalb Jahren in der väterlichen Buchhandlung war es endlich ein Ortswechsel. Sie hatte sich so gefreut, aus Fürth hinauszukommen, und war in einer Stadt gelandet, die zwar auch nicht so groß, aber viel städtischer war als Fürth. Die Menschen waren hier etwas behäbig, aber aufgeschlossener, die Stadt hatte auch ihre Fabriken und sogar ein Salzbergwerk, war aber viel sauberer und aufgeräumter. Die Geschäfte waren eleganter und spezieller und es gab einen riesigen Wochenmarkt. Schließlich konnte sie bei Verwandten wohnen, der Cousin ihrer Mutter war hier verheiratet und kinderlos. Der Buchhändler Kompitz war ein Geschäftsfreund ihres Vaters, die Buchhandlung eine der ältesten in der Stadt. Kompitz hatte sich gefreut, ein wenig Esprit in seinen Laden zu bekommen, wie er sich ausdrückte. Doch sie war anfangs still gewesen, kaum außer Haus gegangen und lächelte immer nur verlegen, wenn Kompitz einen Scherz versuchte. Erst mit der Zeit erkundete sie die Umgebung und wurde gesprächiger. Der alte Mann war sicher zufrieden mit ihr, sonst hätte er ihr schließlich nicht dieses Zeugnis ausgestellt.
Das alles hat sie dem schweigsamen, freundlich nickenden jungen Mann gegenüber erzählt. Ob das zu viel gewesen ist?
Zum Schluss schwiegen sie.
Das Erzählen hat auch eine Erinnerung wieder wachgerufen, die sie dem Fremden nicht erzählt hat: die Erkenntnis, dass Halle letztendlich auch keine Großstadt ist. Auch dort verkaufte sie nur Bücher und, was ein wenig Abwechslung brachte, Musiknoten. Dreimal hat sie in den eineinhalb Monaten Leipzig besucht und ist traurig nach Halle zurückgekehrt: Warum war sie nicht in dieser wunderbaren Buchstadt gelandet, sondern in dem langweiligen Anhängsel? Leipzig wurde zu Recht die Buchstadt genannt: So viele Druckereien, Verlage, Buchbinder, Buchläden, Papierhandlungen und Antiquariate hatte sie noch nirgendwo gesehen. Es gab einen Stadtteil, der »Graphisches Viertel« genannt wurde, auch der Sitz des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler war da und die Deutsche Bücherei, in der es von jedem Buch, das in Deutschland erschien, ein Exemplar gab. Es tat ihr jedes Mal leid, als sie am Abend nach Halle zurückkehren musste.
Der Zug hält mit einem Ruck. Fürth Hauptbahnhof, schnarrt eine Stimme. Nächster Anschluss nach Würzburg.
Sie nimmt ihren Koffer aus dem Netz, im Gang stehen einige Leute. Sie beschließt, noch nicht aufzustehen. Auf dem Bahnsteig gestikulieren zwei Menschen, irgendwer ruft einen Franz. Das Zugfenster kommt ihr einen Moment vor wie eine Kinoleinwand. Der Film, der draußen spielt, ist nicht wirklich.
Oh Gott, wie soll sie das jetzt noch hinkriegen. Um zehn Uhr ist das Vorsprechen im Studio. Sie wollte sich vorher noch hinlegen, aber daraus wird nichts mehr werden. Ihre Hand ruht auf dem ungeöffneten Brief, der vor ihr auf dem Tisch liegt.
Der Agent hat sie nach der Vorstellung angesprochen, ob sie nicht Interesse hätte, in einem Film mitzuspielen, keine Hauptrolle natürlich, aber auch nicht als Komparsin, davon hätten sie genug. Aber Typen wie sie brauche man, ausdrucksstarkes Gesicht, weibliche Formen, am Dienstag um elf also. Nie hätte sie gedacht, dass sich ein Mann von den Studios zu dieser Theatervorstellung verirren würde. Und ausgerechnet zu der experimentellen Truppe La Moderna, zu der sie vor ein paar Monaten gewechselt hat, nachdem sie genug von den italienischen Melodramen bekommen hatte. Die Vorstellung war eine Pantomime mit Musik, große Gesten, bizarres Mienenspiel.
Sie sitzt am Küchentisch und betrachtet ihre Hand und den Brief, der darunter liegt. Als wollte sie ihn davor bewahren, wegzufliegen. Aber in der Küche weht kein Wind.
Die Fenster sind beschlagen, sie sollte noch einmal lüften, noch immer stinkt es nach Rauch, die letzten Gäste sind erst um vier Uhr gegangen, Robo hat sich schlafen gelegt, sie hat noch zusammengeräumt und wollte sich gerade niederlegen, als sie den Postboten hörte. War es schon sechs? Sie hat die Schrift auf dem Umschlag gleich erkannt.
Nach so vielen Monaten des Schweigens endlich ein Brief von der Mutter. Nach so vielen Monaten ohne Antwort. Ab Mitte 1917 ist keine Antwort mehr auf ihre Schreiben gekommen.
Dabei hat sie ihr so viele wichtige Dinge geschrieben: Ich habe geheiratet! Einen Adeligen! Wir leben als Künstler in Los Angeles! Ich spiele Theater und nähe daneben noch ein bisschen! Es geht mir gut! Ich kann kaum erwarten, dass ihr nachkommt! Hier ist es nie so kalt wie in Udine!
Sie tastet den Umschlag ab. Es müssen mehrere Blätter sein. Sie nimmt das Messer, jetzt wird sie ihn öffnen, doch sie verharrt in dieser Stellung, Messer in der einen, Brief in der anderen Hand.
Nur durch Zeitungsberichte hat sie erfahren, wie es Italien in den letzten Monaten ergangen ist. Hunderttausende Gefallene in Caporetto, am Isonzo und an der Piave, fast eine Million Italiener gestorben im Kampf gegen die Österreicher für ein paar Landstriche in Friaul und Tirol. Dazu Zehntausende Tote durch die Spanische Grippe, die auch hier wütet. Alles Zahlen, unter denen sie sich nichts vorstellen kann. Wo sind die Gräber dieser Menschen? Ist ganz Friaul zum Friedhof geworden? Endlich ist der Krieg seit zwei Wochen vorbei. Nicht nur, dass das Schlachten ein Ende gefunden hat, in allen Ländern sind die Sozialisten und Kommunisten stark geworden. In Russland hat es die Revolution gegeben, von der alle träumten, bald werden andere Länder folgen. Endlich die Arbeiter an der Macht!
Sie streicht über das raue Papier. Ob Schlimmes drinsteht? Ob jemand gestorben ist? Hoffentlich kommen Mutter, Valentina, Yole und Benvenuto bald nach. Das Geld dafür hat ihr Vater inzwischen beisammen, aber während des Krieges war eine Überfahrt undenkbar.
Sie schneidet den Umschlag auf und liest.
Kein Wort von Helden, von Toten, von Sieg und Niederlage. Der Krieg ist zwar nicht nach Udine gekommen, dafür aber Tausende Soldaten, die durchzogen, plünderten, vergewaltigten. Dazu einheimische Banden, die Leute überfielen und Geschäfte ausräumten. Am schlimmsten die Faschisten, die schon während des Krieges immer wieder randalierten, die Parteilokale der Sozialisten verwüsteten und die Vereinshäuser der Nichtitaliener beschmierten.
Und dann, im letzten Absatz, wie beiläufig, schreibt die Mutter von Valentina. Neunzehn ist sie jetzt, rechnet Tina schnell nach. Es ist ein Soldat aus den Abruzzen, in den sie sich vor einem Jahr Hals über Kopf verliebt hat. Sie ist im Januar mit ihm nach Chieti gegangen, hat dort einen Sohn namens Tullio zur Welt gebracht. Der Kindsvater musste gleich wieder an die Front im Norden, er gilt als vermisst. Valentina ist wieder in Udine mit dem kleinen Tullio, es geht ihr nicht gut, sie hat keine Arbeit, die Leute sind böse.
Tina beißt die Zähne zusammen. Warum ist sie nicht hier, hier in diesem freien Land, in dem eine unverheiratete Mutter zwar nicht das größte Ansehen genießt, aber bei Weitem nicht so geächtet wird. Sie will sich nicht ausmalen, wie sie gemeinsam hausen in der Via Pracchiuso, im Schatten des Burgbergs.
Wir kommen bald nach, schreibt die Mutter dann am Schluss, danke für das Geld, das ihr geschickt habt. Sie sei inzwischen eine fleißige Arbeiterin geworden und würde sich in den USA leichttun.
Tina kämpft mit den Tränen, faltet den Brief zusammen. Sie sollte sich wenigstens für zwei Stunden niederlegen. Aber ihr ist es, als ob die Zeit stehen geblieben wäre, sie bleibt sitzen, bliebe am liebsten ewig so sitzen, bis sich alles zum Besseren wendet.
Nur noch ein wenig sitzen bleiben, nicht aussteigen müssen hinein ins alte Leben. Augen schließen, die Zeit anhalten. Viel zu früh ist sie jetzt wieder zurück, bis Weihnachten hätte sie in Halle bleiben sollen. Aber in den ersten Novembertagen ist das Chaos ausgebrochen. Der Matrosenaufstand in Kiel, dann Aufstände in allen Städten. In Bayern und Franken wurde eine Räterepublik ausgerufen, was immer das sein mochte, König Ludwig ist abgesetzt worden.
Zwei Tage später gab es in Berlin eine Revolution, überall wehten rote Fahnen, ein Wahnsinn, erzählte der Briefträger, der es in der Früh im Telegrafenamt aufgeschnappt hatte.
Sie hat die Entwicklung in den Zeitungen verfolgt, die alle paar Stunden in Sonderausgaben ausgetragen werden. Am Tag, an dem der Kaiser abdankte, wurde in Berlin zweimal ein neuer Staat ausgerufen, einmal durch Scheidemann eine deutsche, dann durch Liebknecht eine sozialistische Republik. Am nächsten Tag hieß es dann, dass ein Rat der Volksbeauftragten die Regierung übernehme.
An diesem Tag jagte eine Meldung die andere, die Kunden in der Buchhandlung erzählten sich die verrücktesten Dinge. In München sei die totale Anarchie ausgebrochen, dort hätten Dichter die Macht übernommen. Am 11. November war auch der Krieg offiziell zu Ende, obwohl die letzten Tage ohnehin nicht mehr gekämpft wurde. Alle Herzöge, Fürsten und Grafen wurden abgesetzt. Es gab keinen Adel mehr. Sie fragte sich, wie das gehen sollte: Ein Graf sollte plötzlich kein Graf mehr sein? Das blieb er doch auch ohne Titel!
Jeden Tag liefen Leute mit roten Fahnen durch die Straßen, in die Buchhandlung verirrten sich nur wenige.
Sie war nicht erstaunt, als ihr Kompitz schon am 13. November das Zeugnis ausstellte.
»Wer weiß, was jetzt kommt. Jeden Tag ein neuer Staat, der morgen schon wieder weg sein kann. Wie es aussieht, werden die Kommunisten Revolution machen wie in Russland. Es ist besser, du bist daheim, wenn’s losgeht. Denn das wird ohne Kampf nicht gehen.« Der Alte strich ihr übers Haar wie einem kleinen Kind, sie fühlte sich nicht wohl dabei. Und doch hatte sie in diesem Moment zum ersten Mal das Gefühl, dass die Entscheidung für den Buchhandel und gegen das Studium vielleicht nicht so schlecht gewesen war. Bücher würden immer gekauft werden. Als Ärztin bekäme sie jetzt jeden Tag Verstümmelte zu sehen, Menschen ohne Unterkiefer, ohne Beine, ohne Augen.
Die Leute auf dem Gang setzen sich in Bewegung, sie steht auf, nimmt ihren Pappkoffer und reiht sich ein. Ein Geruch von Kohle, Karbol und Eisenspänen dringt vom Bahnsteig herauf. Sie steigt die Stufen hinunter, stützt sich auf dem Koffer ab. Es ist der erste Waggon hinter der Lok, ein Schwall Wasserdampf zischt von rechts heran. Da links stehen ihre Eltern, sie wirken älter, kleiner, die Haare des Vaters sind grauer, die Falten der Mutter tiefer geworden. Sie umarmt beide, und obwohl sie froh ist, die vertrauten Gerüche zu riechen, die Stimme der Mutter zu hören, die ihr sagt, wie hübsch sie geworden ist, kommen sie ihr vor wie Menschen, die sich zurückentwickelt haben, während sie weitergeschritten ist.
»Gut siehst du aus«, sagt auch der Vater.
Die Mutter redet auf sie ein. Sie hört die Phrasen nicht, die sie umschwirren. Eine Unruhe liegt in der Luft, selbst hier in der Bahnhofshalle.
Sie treten auf den Vorplatz, der Zentaurenbrunnen ist noch da. Der Vater ruft einen Dienstmann. Sie wohnen ja so nahe, dass er sie bis vor die Haustür begleiten kann. Die Stadt ist in den Monaten ihrer Abwesenheit noch grauer geworden, die Häuser wirken noch wuchtiger, die Dächer noch steiler. Und so klein und nah ist alles, ein paar Straßen, und man ist am Ende der Stadt.
Auch ihr Mädchenzimmer kommt ihr düsterer vor – war in Halle wirklich alles heller, freundlicher?
Mutter erzählt ihr, dass Walter und Helene erst zu Weihnachten kommen werden. Walter hat Probleme im Studium, er hat eine große Prüfung zum zweiten Mal nicht bestanden. Ein halbes Jahr hat er noch, dann ist er fertiger Jurist. Hoffentlich.
Am nächsten Tag steht sie wieder in der Buchhandlung, das Fräulein Marie ist wieder da, küss die Hand, das Fräulein Marie, wie schön. Wie war’s bei den Hallensern, Halloren und Halunken?
Es sind wenige, die in diesen Tagen Bücher kaufen. Die Straßen sind voll von Menschen, auch in Fürth versammeln sich jeden Tag Leute zu Kundgebungen und Sitzungen. Keiner weiß genau, wie es politisch weitergeht, überall wird diskutiert, selbst in die Buchhandlung kommen viele Kunden nur, um über Politik zu disputieren. Marie kann das Wort »Revolution« nicht mehr hören. Ihr Vater sagt den Lesekreis ab, der sich jede Woche mittwochabends in der Buchhandlung trifft.
Als sie am Nachmittag allein in der Buchhandlung steht, fragt sie sich, wann sie Betty wiedersehen wird. Sie hat nicht geschrieben, obwohl ihr Marie die Adresse in Halle gegeben hat. Betty wird am Ende dieses Schuljahrs ihr Abiturzeugnis in Händen halten, ihre Eintrittskarte für die Universität. Und sie selbst, seit zwei Jahren Buchhändlerin, wird nächstes Jahr die Lehrzeit beenden.
»Wenn du jetzt nicht mitarbeitest, kann ich den Laden zusperren«, hat ihr der Vater vor zwei Jahren gesagt. Und obwohl sie das Schuljahr gut abgeschlossen hatte, musste sie die Lehre beginnen, es gab keine andere Möglichkeit.
Leute kommen ins Geschäft, bringen jede Stunde Neuigkeiten. Die Räte haben die Macht in Bayern übernommen. Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten, man stelle sich das vor! Aber angeblich gibt es das Parlament auch noch. Eine Stunde später: Nein, die Kommunisten sind doch nicht dabei, nur die Sozis. Weil der neue Regierungschef Eisner vom Kommunistenführer Liebknecht in Berlin eine Abfuhr bekommen hat, machen die Kommunisten in Bayern nicht mit.
Am nächsten Tag heißt es, dass am nächsten Tag die kommunistische Revolution losgeht und der große Umsturz kommt. Dann doch nicht. Die Sozialisten wollen den Sozialismus nur ohne Revolution durchsetzen, die Kommunisten nur mit. Jeden Tag gibt es Abspaltungen, ein Kommunist namens Levien ruft den Spartakusbund ins Leben, ein anderer, Mühsam, gründet die Revolutionären Internationalisten. Marie wundert sich, dass so viele Schriftsteller an dieser seltsamen Revolution beteiligt sind: Kurt Eisner ist Theaterkritiker, Oskar Maria Graf hat eben ein Büchlein mit modernen Gedichten herausgebracht. Gustav Landauer kennt sie durch seine Übersetzungen von Oscar Wilde und Shakespeare, Erich Mühsam schreibt für den Simplicissimus. Was treibt diese Menschen der Literatur bloß an, sich in eine radikale Politik zu stürzen? Sie richten doch nur Chaos an! Dann besser Buchhändlerin sein in der sicheren Buchhöhle.
»Nicht schon wieder. Diese Demonstrationen bringen doch nichts.«
»Irgendwann kommt er frei. Er ist unschuldig.«
»Ich verstehe trotzdem nicht, dass du dich für diesen Bomber einsetzt.«
»Er hat keine Bombe gelegt!«
»Aber oft genug angekündigt. Auch wenn er es diesmal noch nicht selbst gemacht hat.«
»Na und. Marx sagt selbst, dass die Gewalt die Lokomotive der Geschichte ist. Manchmal geht es eben nicht anders.«
»Oho, hast du wieder im Kapital gelesen? Du solltest mehr Pazifisten lesen. Die gibt es schließlich auch unter den Linken.«
»Aber durch Nichtstun geht nichts weiter.«
»Wen hast du gelesen, sag schon!«
Tina beißt sich auf die Lippe. Nein, von den Anarchisten und Pazifisten hat sie wirklich kaum eine Ahnung. Alles, was sie weiß, hat sie von Robo, seinen Büchern und den Büchern seiner Freunde. Nach wie vor vergräbt sie sich stundenlang in den Seiten. Wenn bei den wöchentlichen Runden, die sich bei ihnen einfinden, ein Zitat fällt, muss sie es am nächsten Tag nachschlagen, wenn ein Autor genannt wird, sofort nachlesen, jede Woche ist sie in der Leihbibliothek und gräbt, will alles belegt wissen, den Grund, den Ursprung von all den vielen Theorien und Facetten der Ideologien, die herumgeistern. Sie weiß so wenig, sie weiß gar nichts.
»Marx war Theoretiker«, sagt Robo. »Oder hat er irgendeine Revolution gemacht? Es ist schon ein Unterschied, ob man nur darüber schreibt oder zur Tat schreitet. Schriftsteller oder gar Poeten waren in der Praxis nie gute Revolutionäre.«
»Aber die in Russland machen alles richtig. Und hier in Amerika kommt das auch noch, du wirst sehen. Die Arbeiter werden sich die Macht erkämpfen. Die Herrschaft des Kapitals muss gebrochen werden!«
»Ach Tina, du redest wie Marx persönlich.«
Sie ist schon in den Mantel geschlüpft, zieht sich die Schuhe an.
Robo wird sie von ihrer Meinung nicht abbringen, das wäre noch schöner. Sie liebt seine Belesenheit, seine Geistesschärfe, seine idealistische Weltfremdheit, seine vorsichtige Zärtlichkeit, seine kindlichen Gefühlswallungen. Aber nie hat er mit eigenen Händen entfremdete Arbeit verrichtet, nur gemalt und geschrieben, was ihm eingefallen ist.
»Ich bin am Abend zurück. Dann koche ich dir etwas Schönes. Einen Risotto nach Udineser Art, in Ordnung? Bis später«, sagt Tina, nimmt den Kopf des vor ihr Sitzenden in beide Hände, küsst ihn auf die hohe Stirn, öffnet die Tür und ist weg.
Essen! Alles Revolutionsgerede ändert nichts daran, dass die Mutter immer noch Lebensmittelmarken lösen muss und Fleisch noch immer selten auf den Tisch kommt. Als ob der Krieg noch nicht zu Ende wäre.
Am nächsten Tag liest Marie im Abendblatt, dass Bayern ab sofort ein sozialistischer Freistaat ist. Man schreibt es jetzt mit i, Baiern, weil es nichts mehr mit dem alten monarchistischen Bayern zu tun haben soll. Sie weiß nicht, ob sie das ernst nehmen soll oder ob es sich um eine Satire handelt.
Tags darauf steht in der Zeitung, dass die Räteregierung vorhat, den Achtstundentag einzuführen. Alle Fabrikdirektoren sollen abgesetzt werden, die Arbeiterräte sollen die Fabriken selbst verwalten. Gut für die Arbeiter, die in den Fabriken schuften, denkt Marie. Aber ob das wirklich klappt? Sie hofft, dass sie die Buchhandlungen in Ruhe lassen. Oder werden die jetzt auch verstaatlicht?
Sie freut sich, als sie liest, dass das Frauenwahlrecht kommt. Die Wahlen werden für 12. Januar angesetzt. Zum ersten Mal wählen! Das ist schon längst überfällig, die Diskussion lief ja schon Jahre.
Kunden erzählen ihr, dass es in einigen Städten keine Bürgermeister und Gemeinderäte mehr gibt – Arbeiterräte haben die Macht übernommen. Angeblich soll das auch in Fürth passieren. Sie fragt ihren Vater, ob er etwas weiß. Er zuckt nur mit den Schultern.
Nach einigen Tagen gibt sie es auf, den Ereignissen zu folgen, es ist zu mühsam. Alte Herren werden abgesetzt, neue kommen, das war immer so in der Geschichte. Sie glaubt nicht an eine neue Gesellschaft, das funktioniert vielleicht in Russland oder Amerika, aber sicher nicht in Bayern, schon gar nicht mit den rückständigen Leuten auf dem Land. Früher oder später werden die Grafen und Fürsten wieder in ihre Schlösser zurückkehren und alles wird beim Alten sein, da ist sie sich sicher.
Während dieser Tage, die in der Buchhandlung ruhig verlaufen, nimmt sie sich die Buchhaltung vor. Es gibt so viel, das in Ordnung gebracht werden muss. Der ganze Bestellvorgang, wie ihn ihr Vater abwickelt, ist umständlich, statt drei reicht ein Zettelkasten, außerdem kann man bei vielen Verlagen jetzt telefonisch bestellen, was das Buch viel schneller in die Buchhandlung bringt. Wenn sie in Halle etwas gelernt hat, dann wie man eine Buchhandlung modern organisiert.
Und warum nicht Noten anbieten wie Kompitz? Das brachte in Halle einige Kunden. In Fürth gab es zwar ein Musikgeschäft, das eine kleine Auswahl von Instrumenten hatte, die von Schülern der örtlichen Musikschule am häufigsten gespielt wurden: Flöten, Violinen, Gitarren, Zithern, zwei Klaviere. Daneben verkauften sie ein paar Lehrbücher und Noten für Anfänger. Aber um richtige Partituren zu kaufen, mussten die Leute nach Nürnberg oder gar München fahren. Und es gab so viele moderne Stücke, die leicht zu spielen waren und lustig klangen. In Fürth hat sich zwar noch niemand beschwert, die Leute hier nehmen alles einfach so hin, aber wenn sie etwas Neues geboten bekämen, würden sie sicher zugreifen.
Am nächsten Tag ruft Betty in der Buchhandlung an, sie verabreden sich für den Abend bei ihr. Fast ein halbes Jahr haben sie sich nicht gesehen. Das Gespräch kommt nur schleppend in Gang. So lange hat Marie darauf gewartet, in so vielen Briefen angekündigt, wie sehr sie sich freuen würde, sie wieder zu sehen, und jetzt ist da nur frostige Freundlichkeit. Betty lebt in einer anderen Welt. Sie hatte keine Zeit zu schreiben, keine Zeit, neue Bücher zu lesen, über die sie diskutieren könnten, da sie die ganze Zeit lernen muss. Angeblich.
Sie reden über Alltägliches, über Wetter und Lebensmittelmarken, über Mode und Steckrüben, über die neuesten Liaisonen in Fürth. Marie erzählt von den Buchhandlungen in Halle und Leipzig, merkt aber bald, dass das Dinge sind, die Betty nicht interessieren.
Betty erzählt von einem Verehrer, der sie mit Blumen und Gedichten bedrängt, sie hält ihn noch auf Distanz.
»Du musst die Männer ein bisschen zappeln lassen«, sagt sie und lacht.
Marie nickt und versucht zu lächeln.
Betty seufzt und zeigt auf ihren Schreibtisch. Bücher über Bücher.
Marie fragt, ob sie die Woche einmal Zeit fürs Kino hat.
Betty schüttelt den Kopf, sie hat so viel zu lernen.
»Ist ja das letzte Jahr.«
Natürlich. Betty wird in acht Monaten das Abiturzeugnis in der Hand halten und im Herbst auf die Universität gehen, nach München, sie möchte Journalistin werden oder Schriftstellerin.
»Schriftstellerin. Dann kann ich deine Bücher verkaufen«, sagt Marie und lacht, es klingt nicht echt.
Zu Hause wirft sie sich aufs Bett und schluchzt, bis der Polster an ihrer Wange klebt. Wenn sie nur ein wenig Hilfe gehabt hätte damals, wenn sie nicht diese dumme Lehre angefangen hätte, dann … Sie tupft sich die Wangen mit einem Taschentuch ab und setzt sich kerzengerade vor den Spiegel. Fräulein Rosenberg, Buchhändlerin. Ich kenne die Kataloge von Rowohlt und Reclam auswendig. Ein kurzes Auflachen unter den trockenen Tränen. Es hat auch gute Seiten, sie darf nicht ungerecht sein. Wie viele Bücher sie kennengelernt hat! Wie viele zu lesen sie die Gelegenheit und die Zeit hat, während andere klagen, gerne lesen zu wollen und die Zeit nicht zu finden. Und die sichere Arbeit jetzt, wo so viele Menschen arbeitslos sind. Aber trotzdem – ein ganzes Leben graue Maus hinterm Tresen sein, eintrocknen wie eine Pflanze, die man vergessen hat zu gießen – nein! Das würde sie nicht aushalten. Sie könnte nach Abschluss der Lehre wieder mit der Schule beginnen, in Nürnberg gibt es Abendkurse für Arbeiter, sie könnte dann das Abitur für Externisten machen. Ihr muss nur noch etwas einfallen, um den Vater günstig zu stimmen. Und um den Verkauf anzukurbeln. Sie muss zeigen, dass sie gut ist. Vielleicht verkaufen sich die Werke der Dichterrevolutionäre nun besser. Eine Revolutionsbuchhandlung einrichten? Aber die Revolutionäre von heute können morgen schon wieder gestürzt sein. Dann doch lieber Musik.
Am nächsten Tag schlägt sie dem Vater vor, eine Abteilung für Musikalien einzurichten. Bei Kompitz haben sich Noten gut verkauft und in Fürth gibt es eine Marktlücke. Der Vater ist zuerst erstaunt, freut sich dann aber fast zu schnell. Sie glaubt, seine Gedanken lesen zu können: Meine Tochter möchte etwas Neues ausprobieren, sie weiß, was nachgefragt wird, sie geht mit der Zeit, genau das habe ich mir gewünscht. Und wenn sie auch keinen Erfolg hat, so zeige ich doch meine Freude.
Vielleicht interpretiert sie auch zu viel in sein Verhalten hinein. Sie wird etwas Neues machen und er freut sich einfach. Etwas, das sie noch fester in der Buchhandlung verwurzelt. Aber dafür steigt sie in der Wertung des Vaters.
Müsste sie sich nicht eher ungeschickt anstellen, um dem Vater zu zeigen, dass diese Arbeit nicht die richtige für sie ist? Nein, es gibt derweil kein Entkommen. Die Lehrzeit noch abschließen, die drei Monate, die noch bleiben, dann wird sie sehen, was sich machen lässt.
Vorerst bestellt sie Noten, sie weiß noch, welche sich in Halle gut verkauft haben: Klavier, Blockflöte, Violine, Gitarre.
Der Vater runzelt die Stirn, als sie ihm die Liste vorlegt.
»Mach nur. Wenn wir nur nicht darauf sitzen bleiben.«
»Wir werden noch darauf sitzen bleiben!«
»Nur ruhig, wir müssen ja nicht davon leben.«
»Ja, weil ich noch immer Hemden nähe.«
Tina faltet den Umhang vorsichtig zusammen. Dieses schöne Muster in Blau und Gold! Sie erinnert sich noch, mit welcher Mühe sie die Wachsornamente draufgepinselt hat. Sie nimmt den nächsten Kaftan, grün-gold, faltet ihn zusammen und legt ihn in die große Pappschachtel.
Robo steht noch am Tisch und strahlt die letzten Marktbesucher an, die geschäftig vorübereilen.
Ganze zwei Saris haben sie verkauft auf dem Künstlermarkt, der jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit in dieser Halle stattfindet. Indische Sachen kaufen die Leute, aber Kaftans, Tuniken, Schals und Foulards in javanischer Batiktechnik, ausgeführt von einem verträumten Bohemien und seiner Arbeiterbraut, erregen zwar Aufmerksamkeit, werden aber nicht gekauft.
»Komm schon«, sagt Tina. »Die anderen packen auch schon zusammen.«
Robo zieht seine dünnen Augenbrauen hoch und fuchtelt schweigend mit den Händen herum, als dirigierte er den Schlussakkord für ein unsichtbares Orchester. Schließlich hilft er ihr, die Schachteln zu schließen und aufeinanderzustapeln. Jetzt müssen sie nur noch auf George warten, der ihnen die Sachen wieder nach Hause transportiert, Automobil haben sie keines.
Tina setzt sich auf eine Box und zündet sich eine Zigarette an. Robo holt sein Notizbuch und kritzelt herum, er hat die Augen zusammengekniffen und erinnert Tina an ein Nagetier.
Wie viel Arbeit sind diese Stoffe gewesen!
Die meisten Leute denken, batiken könne jedes Kind. Und viele machen es sich ja einfach: schnüren Stoffe mit Kreppbändern zusammen oder patzen primitive Muster mit Wachs darauf und tunken sie danach in Farbe.
Robo hat sich die aufwendige Technik von einem Künstler aus Java abgeschaut. Mit der Zeit hat sich auch eine Arbeitsteilung herausgebildet: Robo zeichnet das Muster auf Papier, Tina überträgt es mit Grafitstift auf den Stoff. Dann nimmt sie dieses seltsame Instrument, das aussieht wie eine Rauchpfeife mit einem kleinen Abflussrohr vorne, stopft Wachs hinein und hält es über eine Kerze. Stundenlang zeichnet sie dann die Muster mit Wachs nach. Das Färben übernimmt wieder Robo. Nach dem Trocknen dann die nächste Schicht, neue Muster, Färben, Trocknen. Diesen Vorgang wiederholen sie meistens zwei- oder dreimal, manchmal gibt es bis zu sechs Durchgänge – vierzehn Tage, bis ein Tuch fertig ist.
»George sollte schon längst da sein«, sagt Tina, drückt ihre Zigarette aus und schnippt sie weg. Rundherum lärmen die anderen Markthändler, die Jadeketten, Holzschnitzereien und Flechtgürtel in Schachteln verstauen.
Robo nickt, während er weiter im Stehen in seinen Notizblock kritzelt.
Tina steht auf, packt ihn an den Schultern, er dreht sich um und sieht sie entgeistert an.
»Das geht nicht so weiter, hörst du. Ich werde nächste Woche wieder zu Paramount gehen. Griffith produziert wieder wie am Fließband, sie brauchen ständig Komparsen.«
»Aber da hast du ja so lange Stehzeiten, hast du das letzte Mal gesagt.«
Tina legt den Kopf schief.
»Wenn ich die Stunden rechne, die ich für die Tücher aufwende, die wir nicht verkaufen … für die bekomme ich gar kein Geld.«
»Aber wir arbeiten zusammen. Du bist bei mir«, sagt Robo. Sein Blick wie der eines Hundes.
Sie fasst seine Hände, streckt sich und küsst ihn auf den Mund. »Du schaffst es schon allein«, sagt sie.
Ein gellender Pfiff reißt sie aus der Vertraulichkeit. Vom Ende der Halle nähert sich ein breitbeiniger Mann mit Schiebermütze und Knickerbocker, hinter ihm zwei bullige Männer.
»George«, sagt Robo. »Gott sei Dank hat er die Träger wieder mitgebracht.«
»Du könntest auch was anderes tun«, sagt Tina.
»Und was?«
»Du spielst doch ziemlich gut Klavier. Du könntest Barmusik machen.«
»Tina, ich bitte dich. Ich denke nicht, dass die Leute in der Bar Chopin hören wollen. Mit diesen Ragtime-Sachen kann ich nun wirklich nichts anfangen, das weißt du. Und außerdem bin ich völlig außer Übung. Hallo George, hierher!«
Er winkt, George winkt zurück.
»Mit Musik lässt sich schon Geld verdienen. Wenn man will«, murmelt Tina.
Drei Wochen später bringt der Schildermaler ein neues Schild an. Es ist schon Advent, viele Schaufenster sind dekoriert, aber Schnee liegt noch keiner auf dem grauen Pflaster. Marie ist überrascht, der Vater hat es geschafft, den Auftrag vor ihr geheimzuhalten.
»Es musste sowieso erneuert werden«, sagt er. Marie fällt ihm um den Hals.
Neben »Bücher – Rosenberg« steht in derselben modernen Schrift »– Musikalien«.
Binnen einer Woche sind die Noten ausverkauft, sie muss die Kunden auf die Zeit nach Weihnachten vertrösten. Obwohl nach dem beendeten Krieg viele hungern und jeden Pfennig umdrehen, geben sie doch Geld für Musik aus, vielleicht um zu vergessen, vielleicht weil so vieles in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist.
In den Inventurtagen zwischen Weihnachten und Silvester spioniert sie in Musikalienhandlungen in Nürnberg und München. Wie viel wertloses Zeug es für Anfänger gibt! Sie beschließt, nur bei den besten Musikverlagen zu bestellen. »Wir bestellen ab sofort vor allem bei Edition Peters in Leipzig und bei Doblinger in Wien«, sagt sie nach ihren Besuchen, der Vater nickt anerkennend. Wieder beißt sie sich auf die Unterlippe: Es macht ihr Freude, besser zu sein als die Konkurrenz, Freude, gute Sachen zu verkaufen, zugleich weiß sie, dass sie diese Freude wieder einen Schritt weiter weg bringt von ihrem Traum, von dem sie immer weniger weiß, ob er es noch wert ist, geträumt zu werden.
Sie besucht Betty, sie gehen gemeinsam die Pegnitz entlang. Marie spricht über ihre Noten, über Musikverlage, Betty über einen Rudi, der ihr den Hof macht. Marie will nicht froh werden. Jede monologisiert für sich, die andere hört aus Höflichkeit zu. In den letzten Jahren haben sie sich immer zu Silvester getroffen und sind herumgebummelt. Nun sind sie zwei junge Frauen, die im frostigen Park spazieren und nur noch Floskeln austauschen.