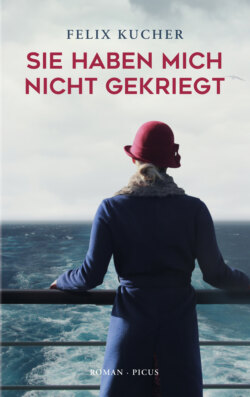Читать книгу Sie haben mich nicht gekriegt - Felix Kucher - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1916
Оглавление»Rosenberg … leider nicht ausreichend.«
Das Klassenarbeitsheft klatscht auf ihr Pult, der Lehrer ist schon bei der nächsten Schülerin, ebenfalls nicht ausreichend, die Hälfte der Klasse ist negativ. Einige Mädchen kichern, hinter sich hört sie leises Schluchzen. Sie beißt sich auf die Lippe und blickt auf die Tafel, die Zahlen, weiß auf grün, verschwimmen, eine Träne tropft auf das Heft. Sie will es gar nicht öffnen.
Es ist Anfang Juni und sie fragt sich, wann sie die »Ungenügend« noch ausbessern soll. Bei ihr ist es nicht nur Mathematik. Auch in Französisch steht sie schon seit einigen Monaten auf der Kippe. Aber wann hat es angefangen?
Vielleicht hätte sie schon im Sommer durchgehend lernen sollen. Sie hat sich ja ein paarmal hingesetzt, auf die Zahlen gestarrt und das Buch dann wieder zugeklappt. Lieber ging sie mit Betty baden oder verkroch sich in der kühlen Buchhandlung. Gerlachs Jugendbücher haben in diesem Sommer Platz gemacht für Lagerlöf und Hesse, oh, wie sie Hesse liebt! Sein Indienbuch hat sie gleich zweimal gelesen. Nun ist sie fest entschlossen, später als Ärztin nach Indien zu gehen, es gibt gar keine Alternative. Bei der Lektüre von Gertrud und Roßhalde konnte sie die Tränen nicht zurückhalten. Sie war ganz aufgewühlt, eine Regung, die ihr neu ist. Die bedingungslose Hingabe, das Opfer der Liebenden in den beiden Büchern, haben in ihr eine bisher unbekannte Saite angeschlagen.
Endlich ist sie in der Untersekunda, drei Jahre noch bis zum Abitur!
Es ist das erste Jahr völlig ohne Geschwister, allein sitzt sie mit den Eltern jeden Abend am Tisch und lässt sich die Worte darüber, wie es heute in der Schule war, aus dem Mund ziehen.
Helene hat sich im Herbst verabschiedet, wie Walter studiert sie nun Jura in Berlin. Nie hat sie darum betteln müssen, immer brav alle Aufgaben gemacht, still, angepasst, so anders als Marie. Nie stand zur Debatte, dass sie die Buchhandlung übernehmen sollte. Auch sie ist in den Sommerferien immer fremder geworden. Anfangs spielte sie sogar noch mit Marie, sie gaben einander Rätsel auf wie früher, aber Helene redete jetzt über Jungen und übers Küssen, wovor Marie ekelte. Sie erzählte ihr immer weniger. Marie wusste bis zu Helenes Abreise nicht, ob sie einen Verehrer hatte oder nicht.
Das Thema Buben bestimmte auch den Schulanfang. Die Jungen, mit denen sie früher zwanglos gespielt hatte, gebärdeten sich nach den Ferien widersprüchlich. Mal taten sie wie junge Männer, versuchten, höflich zu den Mädchen zu sein, und machten ihnen Komplimente, aber auf der Straße standen sie lässig in Gruppen zusammen und riefen einem freche Worte nach. Einige pfiffen, wenn die Mädchen vorübergingen, als ob sie Gassenjungen aus den Arbeiterbaracken wären. Sie war froh, im Mädchenlyzeum und von dieser seltsamen Spezies getrennt zu sein.
Zwei Wochen nach Schulanfang war die Michaelis-Kirch-weih gewesen, die Kärwa. Weil Krieg war, feierten die Fürther, als gäbe es kein Morgen, als gälte es, die Tausenden Soldaten zu vergessen, die an Marne und Somme starben. Die Erwachsenen betranken sich und grölten lauter als sonst, die Marktschreier kreischten sich die Seele aus dem Leib. Die Mädchen jauchzten am Drliczek-Riesenrad, die Burschen ließen an den Schießbuden die Büchsen knallen. Marie sah ihren Freundinnen zu, die in der Schiffschaukel am Zenit stehen blieben. Ihre Kleider flogen hoch, begleitet von den Blicken der Burschen.
Als sie sah, wie Betty sich von Emil, einem Jungen, der zwei Jahre älter war, auf die Wange küssen ließ, wandte sie sich ab und lief hinunter zur Pegnitz, wo über Grillrosten Heringe brutzelten. Sie blickte über den braunen Fluss auf die sumpfige Aulandschaft. Von allen Seiten war die Stadt von Hindernissen umgeben, dachte sie. Zwei Flüsse, ein Sumpf, im Süden die Eisenbahnschienen und Fabriken. Immer mehr Fabriken wurden es, die die Flüsse verschmutzten und Rauch in allen Farben in die Luft bliesen. Sie ging durch den Park und stieg die Treppe zum Stadttheater hinauf. Sie stapfte die Königstraße hinunter, ihre Traurigkeit ein Bollwerk gegen den Kirmestrubel. Je weiter sie die betrunkenen und aufgekratzten Menschen hinter sich ließ, desto sicherer war sie, dass sie wegwollte von hier, weg von dieser rußigen Stadt, wo die Menschen in den Fabriken wie Maschinen funktionierten, deren Lebenswille sich einmal im Jahr in dieser Kirmes entlud.
Der Lehrer hat inzwischen begonnen, die Verbesserung an die Tafel zu schreiben. Eine kleine Genugtuung, dass sie auch die sehr guten Schülerinnen abschreiben müssen. Marie ist sich sicher, dass sie Mathematik im Leben nie wieder brauchen wird.
Die Schule, die ihr am Anfang so hell und freundlich erschienen ist, erinnert sie mittlerweile nur noch an ein Gefängnis. Die Fenster im Erdgeschoß sind vergittert, die Mauern einen halben Meter dick, die Insassinnen von Jahr zu Jahr freudloser.
Auch die Lehrer sind anders geworden in diesem Schuljahr. Sie fordern mehr, sind mürrischer und gereizter. Vielleicht liegt es am Krieg, der schon eineinhalb Jahre dauert, obwohl alle gesagt haben, dass er bald aus sein würde.
Verbesserung. Zweites Beispiel. Während des Schreibens ärgert sie sich, so dumme Fehler gemacht zu haben. Was ein falsches Vorzeichen ausrichten kann!
Das Quietschen der Kreide verstummt. Der Lehrer hält inne, nimmt seine Brille ab und studiert seine Zettel.
Die Mädchen tuscheln.
Alice legt ihre Hand auf Maries Linke.
Marie versucht ein Lächeln.
»Schon in Ordnung«, sagt sie. »Kann mich eh noch ausbessern. Das Schuljahr ist ja noch nicht aus.«
»Und so viele sind ungenügend. Das wird sicher noch. Er muss euch eine Prüfung geben.«
»Sicher«, sagt Marie. Alice hat leicht reden, sie hat immer sehr gute Noten.
Marie drückt lange herum, ehe sie dem Vater die Note gesteht. Sie weiß, was nun kommt.
»Du weißt, was das heißt. Wenn du reprobiert wirst, dann ist es vorbei mit der Schule. Vielleicht siehst du es dann endlich ein. Ich brauche dich in der Buchhandlung, es ist wichtig, dass jemand von der Familie drinsteht.«
Das ist das Schlimme: Dass er weder schimpft noch sie anspornt, die Note auszubessern. Es passt ihm in den Kram, dass sie scheitert. Aber das wird sie nicht!
»Ich gehe da hin!«
»Und wofür oder wogegen wirst du demonstrieren?«
Tina schnaubt.
»Da fragst du noch? Für seine Freilassung natürlich!«
»Damit er dann wirklich eine Bombe legen kann?«
»Was … was fällt dir ein!«
»Tom Mooney, meine Liebe, hat schon öfter in Reden von Bomben und Gewehren geredet. Wer sagt dir, dass er nicht wirklich eine zündet, falls er freigelassen wird?«
»Na und! Die Revolution muss mit Gewalt erfolgen.«
»Ach so? Aber soviel ich weiß, sind da nicht einmal alle Sozialisten dieser Meinung. Du solltest nicht nur Marx lesen, sondern auch Liebknecht, der den Militarismus richtig verabscheut. Gewalt ist stumpfsinnig, oder so ähnlich schreibt er.«
Tina sagt nichts. Wie auch? Wieder hat Robo ihr in seiner überheblich dozierenden Art gezeigt, wie wenig sie weiß. Seit über einem Jahr leben sie zusammen, jede Woche hat er ihr ein anderes Buch zu lesen gegeben: Nietzsche. Kropotkin. Marx. Proudhon. Tagore. Freud. Zwischendurch stundenlange Erklärungen. Dazwischen lieben sie sich. Auch hierin ist sie eine Nichtwissende, beflissen, alles zu lernen, was er ihr anbietet.
Die Sätze in den Büchern hat sie zuerst überhaupt nicht verstanden. Alles, was sie nach ihrem vierzehnten Geburtstag noch gelernt hat, sind die Handgriffe in der Fabrik, alles, was sie gelesen hat, die Arbeiterzeitungen und ein paar Fortsetzungsromane. Geduldig erklärten ihr Robo oder einer seiner Freunde, die ihn in seinem Atelier besuchten, die fremden Ausdrücke, oft saßen sie stundenlang zu dritt oder zu viert und debattierten.
Wie wenig sie weiß! Sie kennt die Parolen der Arbeiterbewegung, die Pamphlete in den Parteizeitungen. Erst jetzt sieht sie, wie viele komplizierte Gedanken hinter all dem stecken, was Onkel Demetrio immer wieder erwähnt hat, wie tiefgreifend Marx die wirtschaftlichen Verhältnisse analysiert hat, wie viele Denker sich mit der sozialen Frage beschäftigt haben. Sie verschlingt die in klarer Sprache abgefassten Schriften Engels’ zu Privateigentum, Familie und Staat, weint über den erschütternden Romanen Upton Sinclairs und träumt sich nach Indien, als sie die Gedichte von Rabindranath Tagore liest.
Und immer, wenn sie glaubt, über eine Sache Bescheid zu wissen, stößt sie Robo auf etwas Neues, immer weiß er noch mehr als sie, auch wenn er nicht alles selbst gelesen hat.
Und nun will er ihr verbieten, zur Demonstration für die Freilassung von Tom Mooney zu gehen, der zu Unrecht verurteilt worden ist und für den schon wochenlang Demonstrationen veranstaltet werden.
»Tina, ich wollte eigentlich mit dir reden.«
»Wegen der Tücher?« Sie zuckt mit den Achseln. »Kein einziges diese Woche.«
»Nein, es ist nicht wegen der Tücher. Obwohl sie sich dort sicher besser verkaufen.«
»Dort?«
»Du weißt, dass ich Freunde in Los Angeles habe. Ich wollte dich fragen, ob du nicht Lust hast, mit mir eine Zeit lang dorthin zu ziehen. Du wohnst ohnehin schon mehr bei mir als bei deinem Vater. Und Hemdenfabriken gibt es dort sicher auch. Und italienische Theatergruppen.«
»Du meinst … du willst einfach so übersiedeln?«
»Nur einmal versuchsweise. Wenn es mir, wenn es uns dort gefällt, können wir ja bleiben.«
Sie überlegt.
»Und wenn ich keine Arbeit finde? Beide können wir nicht vom Batiken leben und vom Geld deiner Mutter.«
Robo richtet sich auf und reckt die Nase in die Höhe.
»Madame Modotti, Sie können sich sicher sein, dort einen Arbeitsplatz zu finden, der Ihren Fähigkeiten entspricht. Außerdem werde ich persönlich dafür sorgen, dass Ihr Vorrat an Lektüre sich niemals erschöpft.«
Tina lacht. Ihr Adeliger. Aber sie muss sich eingestehen, dass ihr die Bücher inzwischen sehr wichtig geworden sind. Die Welt der Buchstaben erschließt ihr die Welt außerhalb der Bücher völlig neu.
Sie küsst ihn und wirft ihn dabei fast um.
»Jetzt muss ich aber zur Kundgebung.«
Sie sitzt in ihrem Zimmer und überträgt die Verbesserung aus dem Heft. Noch einmal dasselbe, noch einmal über diesen dummen Fehlern sitzen. Sie nimmt ein Blatt und schreibt einige hebräische Wörter. Sie hat das Studium dieser Sprache vor einem Jahr aufgegeben, es war zu anstrengend geworden. In den letzten Monaten war sie oft mit Bettys Eltern in der Synagoge, der Vater hat sich abgefunden. Aber dann ist ihr der Gottesdienst von Mal zu Mal leerer vorgekommen. Die alten Männer, die ständig hin und her wippten, lächerlich. In der Altschul war es noch skurriler. Die paar Greise, die sich hier noch zum Gebet einfanden, wippten beim Lesen in alle Richtungen. Es kam ihr vor wie im Mittelalter oder einer Komödie. Die Buchstaben malt sie hingegen noch gerne, ihre Geheimschrift mit Betty.
Sie ist fertig mit der Verbesserung. Heft zu. Jetzt noch Französisch. Sie atmet durch. Kein Bruder mehr da, den sie nach der richtigen Aussprache fragen kann. Walter hat zwar viel gemault, aber ihr doch immer wieder aus der Patsche geholfen. Daneben wartet noch das Erdkundebuch. Sie malt das hebräische Alphabet fertig und schlägt dann Erdkunde auf. Zahlen und Buchstaben.
Bettys Vater hat ihr vor einigen Wochen vom Buch Sefer Jetzira erzählt.
»Das ist nicht so heilig wie die Torah«, hat er gesagt und gelacht. »Es ist auch viel später entstanden. Aber vielleicht interessiert dich als Leseratte ja, was in diesem Buch berichtet wird.« Und er erzählte ihr von der seltsamen Geschichte, dass Gott die Welt aus Buchstaben erschaffen hat. Die zweiundzwanzig hebräischen Buchstaben und die zehn Ziffern, die Sefiroth heißen, sind die Bausteine des Kosmos.
»Die Welt, sie ist aus nichts anderem als Buchstaben gebaut. Die Welt besteht aus dem Alphabet.«
Marie verstand gar nichts.
Bettys Vater strich seinen Bart und lächelte.
»Das kann man auch nicht so verstehen wie Mathematik oder Erdkunde. Es ist Mystik. Vielleicht wirst du es lesen, wenn du älter bist. Es hat nur ein paar Seiten. Und es gibt leider keine Übersetzung.«
Daran denkt sie, als sie auf die Zahlen und Buchstaben im Mathematikbuch starrt. Buchstaben und Zahlen bilden die Welt. Die Welt der Bücher, Bibliotheken, ja die väterliche Buchhandlung – jedes eine Welt für sich und jedes zugleich Teil des großen Buchstabenuniversums.
Also los, Kubikwurzel.
Es klopft.
»Marie, kannst du mir noch etwas helfen? Die Lieferung von heute Nachmittag ist noch einzusortieren.« Der Vater spricht durch die geschlossene Tür.
Sie klappt das Buch zu.
»Ich komme.«
Während sie die Treppe hinuntersteigt, überlegt sie, ob sie ihm sagen soll: »Dafür bekomme ich noch eine Chance.«
Aber sie weiß, dass es vergeblich ist.
Das Sortieren ist schnell erledigt, viel ist nicht eingetroffen. Der Vater hätte es leicht allein erledigen können. Sie weiß: Er will einfach, dass sie sich schon als Buchhändlerin sieht. Nicht als Schülerin, als Studentin oder gar als Ärztin.
Er dreht den letzten Karton um, als ob er zeigen wollte, dass die Schachtel leer ist.
»Das war alles. Mein Gott, es erscheint so viel Mist«, sagt der Vater.
Marie ist erstaunt, dass der Vater ihr gegenüber so einen Kraftausdruck verwendet.
»Wieso Mist?«
»Weil es Kriegsliteratur ist. Hetze, mit der noch mehr Leute in den Tod getrieben werden. Ich sollte das nicht verkaufen, aber die Leute lesen es gerne. Da, die Österreicher sind besonders arg. Der neue Rosegger, der neue Kernstock: nur Kriegspropaganda. Das wird massenhaft gedruckt. Die wirklichen Dichter, Marie, die, denen der Krieg ein Gräuel ist, die erscheinen zurzeit nicht. Für deren Bücher gibt es kein Papier.«
Sie nickt. Wenn nur dieser Krieg bald aus wäre. Vielleicht wäre der Vater dann anders gestimmt. Die Lehrer wären nachsichtiger. Das Leben fröhlicher.
Einen Monat später hält sie das Zeugnis in der Hand: Sie muss im Herbst eine Nachprüfung machen oder das Schuljahr wiederholen. Sie versucht noch mit dem Vater zu verhandeln, vergeblich.
In der ersten Ferienwoche liegt sie jede Nacht lange wach. Wahnwitzige Vorstellungen schießen ihr durch den Kopf. Davonlaufen, wie vor drei Jahren in Venedig. Sie müsste es nur besser planen. Oder: Im Herbst trotzdem hingehen und gegen den Willen des Vaters zur Prüfung antreten. Zu einem Verwandten flüchten, aber die Tante in Rosenheim kennt sie kaum, die anderen Onkel und Tanten in Turin und Halle sind zu weit weg. Oder zu den Geschwistern nach Berlin. Aber die würden sie nur zurückschicken, vielleicht sogar persönlich nach Hause geleiten. Die Niederlage wäre vollkommen.
Es dauert den ganzen August, bis sie den Vater herumgekriegt hat, aber sie schafft es. Zweimal hat er ihr schon das Papier gezeigt, auf dem er bereits unterschrieben hat. Lehrvertrag. Buchhändlerlehre in der Buchhandlung Rosenberg.
Schließlich gibt er klein bei: »Wir warten die Prüfung noch ab. Ich habe dich ja auch noch nicht abgemeldet.«
Sie will nicht Bücher verkaufen. Bücher aus Buchstaben, den Bausteinen des Universums, das ist eine schöne Vorstellung. Aber sie will Ärztin werden und aus dieser Stadt weggehen. Sie hat noch eine Chance. Sie muss diese Prüfung bestehen. Sie muss.