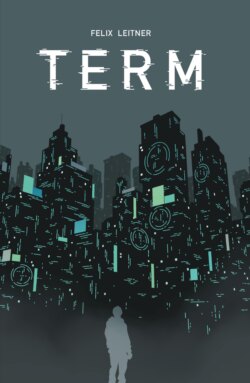Читать книгу TERM - Felix Leitner - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Atlantic Mule III
ОглавлениеEs wäre ein ganz normaler Abend geworden, hätte Terms Vater nicht die Nachrichten eingeschaltet.
Gelangweilt lag Term auf der Couch vor der TV-Wand im Wohnzimmer. Eine Nanofolie klebte wie eine feine Schicht auf der weiß-gestrichenen Wand und mehrere TV-Kanäle liefen in verschiedenen Rechtecken gleichzeitig. Term fühlte sich gut. Er fühlte sich zum ersten Mal, als würde er die Dinge selbst in die Hand nehmen. Dieses Gefühl kannte er sonst nur aus den wenigen Sekunden, wenn er sich den alten Pflegefällen, Erdo oder dem Polizeikommissar Berg widersetzte. Jetzt war das Gefühl nicht mehr so flüchtig, nicht mehr so explosiv, sondern es hatte sich wie ein Vulkan unter die Oberfläche zurückgezogen und brodelte vor sich hin. Es war ein gutes Gefühl. Term zog Kraft aus dieser versteckten Energiequelle.
»Heinrich, schaltest du bitte auf die Nachrichten?!« Terms Mutter machte sich noch einen Tee in der Küche. Sein Vater gab das Kommando und ein Rechteck vergrößerte sich, bis es die ganze Wand einnahm. Term verfolgte nur mit halbem Interesse die Nachrichten. Lassia hatte sich seit Tagen nicht gemeldet. Er war wie normal nach der Schule zu Luks gegangen und hatte seine Pflicht verrichtet. Luks hatte ihn verdächtig angesehen und vermutete nicht zu Unrecht ihn hinter der Tortenattacke. Daher hatte er jedes Fläschchen, jeden Nahrungszapfen und den Flüssigkeitsbeutel dreimal überprüft, während Term seiner Arbeit nachgegangen war. Term hatte es geschafft, seine gehässigen Attacken zu ignorieren. Denn Rolands und Lassias geheime Ziele, die das System verändern sollten, gaben ihm Geduld, Luks zu ertragen. Was war schon ein Gewicht auf der Ladefläche, wenn man vorhatte den ganzen Wagen umzukippen.
»Das können die doch nicht machen«, entfuhr es seiner Mutter mit Entsetzen.
Term blickte auf die Nachrichtensprecherin. Die Dame mit den langen, lockigen braunen Haaren und einem langen, würdigen Gesicht berichtete über irgendeine Gesundheitsmaßnahme. » … so hat sich die ÖSP damit durchgesetzt, Gesundheitsbänder für alle Bürger ab 17 einzuführen. Dazu der Sprecher der ÖSP-Fraktion.« Das Bild wechselte zu einem Mann mittleren Alters, mit weichen Gesichtszügen und knallweiß-gefärbten Haaren, die kurz wie ein englischer Rasen waren. An seinen Ohren hingen zwei silberne Ketten, die ungefähr einen Finger lang waren. Er sprach ins Mikrofon: »Wir sind zufrieden, dass dieses Gesetz in dieser Form Wirklichkeit geworden ist. Das Gesundheitsband wird alle Überschreitungen protokollieren, ob es nun zu viel Alkohol, zu viel Nikotin oder zu viel Cholesterin ist. Jeder Lebensstil, der nicht nachhaltig ist, belastet unser Gesundheits- und Sozialsystem – mit dem Band können wir die Bürger endlich dazu bringen, davon Abstand zu nehmen. Der Fortschritt liegt darin, dass Überschreitungen nicht mehr jährlich, sondern direkt geahndet werden können.« Dann kam die Nachrichtensprecherin wieder in das Bild und tippte mit einem grün lackierten Fingernagel auf ihr Interface. »Zunächst war geplant, dass bereits Kinder im Babyalter, ein solches Band bekommen, da die größten Ernährungssünden an Babys verübt werden, so der Sprecher der ÖSP. Die Partei hofft dies in der nächsten Legislaturperiode zu berichtigen, da erwachsene Bürger diese Art der direkten Gesundheitsüberprüfung bereits kennen. Es sei nur ein logischer Schritt, diese Technik auch auf Kinder und Jugendliche zu erweitern. Kritiker werfen dem Vorhaben vor, dass er den Elternwillen und die individuelle Freiheit Jugendlicher weiter einschränke. ÖSP-Fraktionsführer Lenge kommentierte dies damit – ihn interessiere der Wille der Eltern nur, wenn er nachhaltig sei. Jetzt zum Sport, bei den Olympischen Spielen in Sambia…«
»Zermscheiße, ich soll ab morgen irgendein verdammtes Gesundheitsband tragen?«
»Term.« Seine Mutter ließ sich von ihm nicht aus der Fassung bringen.
»Mensch Term, es geht auch mit weniger Flüchen.«
»Warum soll ich denn so ein … dreckiges Armband tragen? Ich will das nicht«, flehte er seine Eltern an.
»Wir können nichts machen. Gesetz ist Gesetz.« Sein Vater sah ihn grantig und traurig zugleich an. »Du rauchst doch eh nicht.«
»Na und. Früher hätte ich mich auf einer Party gehen lassen können. Ausflippen, wenn ich es gebraucht hätte. Dumme Fehler machen können.«
»Aber das willst du doch gar nicht?«, fragte seine Mutter sorgenvoll nach.
»Ich weiß es nicht. Warum nicht? Manchmal regt mich der Pflegedienst so auf, dass ich etwas zerschmettere. Vielleicht müsste ich das nicht machen, wenn ich am Samstagabend mal mit einem feinen Rausch singend durch die Straßen eiern könnte. Vielleicht will ich mit Freunden einfach nur zusammensitzen, einen Burger braten und mich nicht einmal betrinken. Was weiß ich …, wenn ich jetzt nur ein zweites Bier anlange, kommt die Gesundheitsgestapo und führt mich ab. Im Namen des langen, nachhaltigen Lebens. Für das System. Fickt das System.«
»Verdammt, Term, so kannst du nicht reden.« Aber Term ignorierte seine Eltern und schnappte sich seine Schuhe und seine Jacke. »Wo willst du jetzt hin. Willst du nicht mit uns um Mitternacht feiern?«, rief ihm sein Vater zu. Beide Eltern waren ihm in den Flur gefolgt.
»Ich will nur raus. Mich abkühlen.« Die Lüge kostete ihm viel Kraft. Er wollte brüllen, fluchen und wüten. Die Vorstellung ein Band an seinem Gelenk zu tragen, das ihn ständig kontrollierte, jagte ihm eine gewaltige Angst ein.
»Lass ihn, Heinrich. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Nimm dir deine Zeit.« Term schloss die Augen vor den gut gemeinten Worten seiner Mutter. Die Wörter legten sich wie Ketten um sein Herz, aber er wollte weg.
Die Türen des Bahnhofs schlossen sich wie massive Eisentore. Die Bahnhofshalle war mit Licht durchflutet und erinnerte ihn an ein Krankenhaus. Es war wenig los. Ein großer Minimarkt hatte noch offen, die Bekleidungsläden waren geschlossen. Term ging direkt zum Display und rief die Europa-Karte auf. Sein Finger ruhte über Russland, aber die Angst hielt ihn zurück. Zu gefährlich und ein zu großer Umweg. Dann tippte er auf Istanbul, Türkei. Ein Preis erschien, danach musste er seinen Namen eingeben. Ein schiefes, elektronisches Signal wie eine ungesunde Mischung aus Warnung und Enttäuschung ertönte. Ticketkauf nur am Schalter möglich. Term musste nicht zum Schalter gehen. Er wusste, was ihn dort erwartete. Mit 14 war er ganz naiv hingegangen. Die Dame hatte ihm erklärt, dass er nicht so einfach Europa verlassen könne. Nur von der AW genehmigte Schulausflüge, Reisen mit den Eltern oder Sonderfälle bekamen einen Code zugewiesen, um Tickets ins außereuropäische Ausland zu ziehen.
Das rote Licht des Displays beleuchtete sein Gesicht wie ein Suchscheinwerfer. Kurzatmend und wie ein Verbrecher sah er sich um, doch nur eine Putzkraft leerte die Müllbeutel in der Halle. Der Verkäufer im Minimarkt telefonierte gelangweilt. Keine Chance, er konnte nicht einfach ein Ticket kaufen … das hatte er befürchtet. Term tippte auf Hamburg, gab seinen Namen ein. Das System überprüfte seine Identität. Er musste einmal seinen rechten Zeigefinger auf ein Glas am Automaten legen. Dann wählte er zwischen elektronischem und Papierticket und dann druckte der Automat seine einfache Zugfahrt nach Hamburg aus.
Er hatte noch ein paar Minuten und brauchte dringend Proviant. Hunger hatte er keinen, aber es war die letzte Möglichkeit einzukaufen. Term ging durch die Regale und griff nach Brot, Wasser, Limonade, etwas Fleisch und Käse und Traubenzucker. Traubenzucker soll einen fit halten, hatte Term gehört. Außerdem war er gut portionierbar und würde einige Tage ausreichen für sein Vorhaben.
Genervt beendete der Kassierer sein Telefongespräch: »Mensch Junge, du weißt, dass ich dir so viel nicht verkaufen darf. Ab 20 Uhr darf ich keine einfachen Nahrungsmittel wie Brot und Käse mehr verkaufen. Das Ladenschluss- und Schutzgesetz verbietet eine Konkurrenz zu den allgemeinen Einkaufszeiten. Das sind alles Produkte, die du tagsüber überall bekommst. Aufgrund der Gleichbehandlung darf ich dir die auch nur tagsüber verkaufen. Man, das weiß doch jeder.« Kopfschüttelnd nahm er die Produkte vom Tresen.
»Hast du wenigstens ein Zugticket?« Term zeigte es ihm. »Gut. Zeitschriften darf ich immer verkaufen. Von den anderen Nahrungsmittel, die nicht unter das Schutzgesetz fallen, darf ich dir bis zu fünf Artikel verkaufen: das Wasser, die Limonade und den Traubenzucker.« Der Kassierer scannte die drei Artikel ein. »Sonst noch was?«
Wortlos legte er noch zwei weitere Packungen Traubenzucker dazu und bezahlte. Term fehlte der Wille, um mit dem Kassierer zu diskutieren. Jeder Aspekt des Lebens war vom System vorgedacht, vorgeschrieben und gesetzlich festgehalten. Nach diesen Regeln zu funktionieren, war wie vor einen Magneten gespannt zu sein. Der Magnet zog und zog und ließ einen nicht mehr los.
Die Türen des Schnellzuges schlossen sich leise mit einem Luftzug. Term schnappte nach Luft in der Kabine. Sein Brustkorb fühlte sich eingeklemmt an, als läge ein großer Ziegelstein auf seiner Brust. Er streckte sich und bemühte sich flach und ruhig zu atmen. Aber es war immer zu wenig Luft im Raum.
Die Nacht umgab den Zug wie ein Tunnel. Ihm schien es als fielen pechschwarze Eisenstreben vom Himmel und rammten sich links und rechts der Schienen in die Erde. Ab und zu erhaschte er einen Blick auf hohe Bäume, die sich zu den Schienen beugten. Der Zug hielt nur kurz an den Bahnhöfen. Es war spät und nur wenige Menschen stiegen aus oder zu.
»Alles okay mit dir? Du siehst nicht gut aus.« Ein deutscher Schaffner persischer Abstammung sah ihn mitfühlend an.
»Nur müde«, krächzte Term. Der Druck auf seiner Brust hatte nicht abgenommen. Kurz scannte der Schaffner sein Ticket, warf noch einen Blick auf ihn und ging dann weiter durch die Sitzreihen. Hoffentlich würde er nicht bei seinen ÖSP-Beratern anrufen. Dann wäre seine Flucht zu Ende. Term nickte: Er war auf der Flucht. Starr blickte er in die Nacht hinein. Hoffentlich würde der Zug schneller sein als die Nacht, die ihn von allen Seiten einschloss.
Ein Bus fuhr ihn zum Hamburger Hafen. Ganz absichtlich hatte er sein Handy zu Hause gelassen. So konnten ihn seine Eltern nicht erreichen. Und er konnte nicht geortet werden. Die Hochhäuser Hamburgs machten massiven Stahlkränen Platz. Die Nacht wich einem falschen Tag, so ausgeleuchtet waren die Verladestationen am Hafen. Term stieg aus und es fror ihn sofort. Am Wasser wehte ein kalter, nasser Wind über den Beton. Der Bus verschwand um eine Ecke.
Term blickte durch die Maschen eines grauen Zauns auf den riesigen Güterhafen. Rote, gelbe, blaue, graue und weiße Container stapelten sich aufeinander, oftmals höher als ein Kirchturm. Schatten fielen in langgezogenen Dreiecken auf die Straßengänge zwischen den Containern. Die Kräne griffen nach einzelnen Containern und hievten sie auf die schwimmenden Riesen. Term vergaß die Nässe und die Kälte. Er hatte die Ozeanriesen bisher nur im Web gesehen. Er hatte kein Gespür für ihre tatsächliche Größe. Ohne Vergleich waren die Schiffe kaum beschreibbar. Aber er vermutete man konnte zwei oder drei Häuserblocks seiner Straße problemlos auf der untersten Etage des Güterschiffs unterbringen. Er fühlte sich klein und unbedeutend. Aber die massive Präsenz des dicken Stahls gab ihm Sicherheit. Er müsste es nur auf den Stahlkahn schaffen.
Das Schiff, das sich Term ausgesucht hatte, wurde von drei Kränen gelb angestrahlt und glühte golden in der Nacht. Das Wasser war still und die Scheinwerfer auf dem Umschlagplatz ließen kaum einen dunklen Fleck zu. Term hatte Mühe seinen Blick los zu reißen. Diese gewaltigen Schiffe verbanden die Welt tagtäglich miteinander, indem sie chinesische Nudeln nach Europa, afrikanischen Kaffee in die USA, amerikanische Autos in die Philippinen und europäische Maschinen nach Asien transportierten. Wer auf einem Güterschiff arbeitete, sah die ganze Welt.
Im tiefen Schatten des Güterschiffs erblickte Term einen winzigen Aufgang in den Bauch des Schiffes. Die schmale Zugangsbrücke wirkte wie ein Streichholz neben dem dicken, rot-bestrichenen Eisen des Schiffs. Er suchte nach dem Namen und fand ihn erst nicht, da die Buchstaben so groß waren, dass er sie erst gar nicht als solche erkannte: Atlantic Mule III.
Seine Augen suchten das Gelände ab. An der Einfahrt war ein Kontrollhäuschen für die ankommenden Arbeiter und LKWs. Sicherheitskräfte mit blauen Kappen kontrollierten die Ausweise und Lieferpapiere. Immer wieder strahlten sie mit einer Taschenlampe die Insassen der Fahrzeuge an. Term hakte die Möglichkeit ab: zu gut gesichert. Weiter unten am Wasser hatte eine Imbissbude geöffnet. Mit schnellen Schritten eilte er die Straße hinunter. Er hatte nicht mehr viel Zeit, vielleicht hatten seine Eltern sogar schon die Polizei verständigt, weil er immer noch nicht heimgekommen war. Immerhin war es kurz vor Mitternacht.
»Bub. Was machst du so spät hier.« Der Imbissbudenbesitzer löste seinen Blick von der TV-Wand und runzelte die Stirn. Er hatte mehr braune Haare auf dem Kopf als Term erwartet hatte. Er hatte sich alte Seemänner – und er ging davon aus, dass er einen vor sich hatte – immer mit Glatze und Tattoos vorgestellt. Der Buden-Seemann hatte einen braunen Topfschnitt und war leicht übergewichtig. Er lächelte und kam hinter seiner Theke hervor. Term überlegte zu fliehen, aber eine Handgeste brachte ihn dazu, sich hinzusetzen. »Streuner, nicht wahr?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Hier am Hafen gibt es nur Streuner.« Der Budenbesitzer sah ihn freundlich an. Seine Ohren schlüpften unter seine Haare, wenn er lächelte.
»Sind Sie ein Seemann. Also gewesen?«
»Ha, gewesen. Ich war erst ein Streuner, wie du. Dann war ich Seemann und Streuner gleichzeitig und jetzt bin ich ein Seemann, der die Versorgung der Jungs sicherstellt. Ich bin Johann.« Johanns Händedruck war stark und rau wie das Tau eines Segelschiffes.
»Ist es gefährlich, Johann? Auf See zu fahren?« Term war froh über die Wärme in der Imbissbude und die Gesellschaft des fremden Seemanns.
»Es ist immer etwas gefährlich. Aber auf diesen großen Containerschiffen muss man mehr Angst vor dem Menschen als vor der See haben.« Term verstand nicht. »Piraten. Sie kommen nachts mit Hubschraubern oder kleinen Schlauchbooten und kidnappen oder ermorden die Mannschaft. Aber ein Seemann weiß das, wenn er sich zur See begibt.«
»Warum macht ihr diese Arbeit, wenn ihr die Gefahren kennt?« Term kannte niemanden in seinem Umfeld, der so redete.
»Weil nur die Unfreien sich nicht in Gefahren begeben. Freie Männer gehen Risiken ein«, antwortete Johann, als wäre es die normalste Sache auf der Welt. »Merk dir das, Junge, wenn du wirklich von zu Hause abhauen willst.« Johanns Ohren hüpften wieder unter seine braunen Haare, aber diesmal schlich sich Wehmut in seine Lippen.
Sie schwiegen sich an. Es waren keine Worte nötig, denn Johann schien ihn wie die Signalflaggen eines Schiffes gelesen zu haben. »Du kannst hier gerne solange bleiben wie du möchtest. Durchfüttern kann ich dich nicht. Deinen Weg musst du selbst weitergehen.« Johann nickte ihm zu, als wären Term und der alte Seemann Teil einer Gemeinschaft. Term überlegte. Dankbarkeit füllte sein Inneres aus, dafür dass ihn Johann nicht erziehen wollte. Nicht belehren wollte oder gleich eine Behörde verständigte – wie es seine Pflicht gewesen wäre.
»Bekommst du nicht Ärger, wenn du nicht meldest, dass ich um diese Uhrzeit in deinem Bistro aufgetaucht bin? Wegen dem erweiterten Jugendschutz- und Erziehungsgesetz?«
»Ha, wer zu viele Gesetze kennt, muss sich an zu viele Regeln halten. Das Leben ist viel einfacher, wenn man es von den Paragraphen befreit.« Johann schenkte ihm ein Glas Cola ein und stellte es ihn auf seinen Tisch.
»Danke.« Term trank und dachte über Johanns Worte nach. Wie es wohl wäre als freier Mann seinen eigenen Weg zu gehen? Wenn es keine AW gäbe, die einem alle Entscheidungen abnahm. Wenn er selbst über sein Studium entscheiden würde? Ob er viel oder wenig arbeiten würde und daher viel oder wenig verdienen würde? Wenn er entscheiden würde, was er essen, wohin er reisen und welche TV-Serien er sehen könnte? Wie viel er für später sparen würde oder nicht? Hindernisse, Erfolge, Glück und Leid wären dann nicht mehr vorhersehbar.
»Ich muss aufs Klo.« Term stand auf. Das eigene Schicksal wartete auf den, der sich auf den Weg machte.
Seine Jacke schrubbte über den dicken Maschendrahtzaun. Das Quietschen vom Nylon seiner Turnschuhe auf dem Drahtgewebe war am nächsten Containerberg schon nicht mehr zu hören. Er hatte ein schlechtes Gewissen wegen Johann. Term hatte ihn nicht ausnützen wollen, aber seine Worte hatten ihn geradezu gedrängt, loszulegen. Term war aus dem Klo der Imbissbude geklettert und von dort auf den Hafenzaun gestiegen. Die Spitzen waren nicht so gefährlich, da sie hier klar zu sehen waren und er nach den sicheren Stellen greifen konnte. Auf der anderen Seite angelangt, rannte er weg vom Zaun, denn um ihn herum gab es keine Schatten.
Sehnsüchtig hetzte er zwischen zwei Containerhaufen her. Die Schatten überlappten sich wie Origami über ihm und boten ihm Schutz. Jetzt ging er langsamer. Atmete flacher, es sollte ihn ja keiner hören. Kleine Transporter fuhren zwischen den Containergassen hin und her. Die tatsächliche Arbeit verrichtete der Kran. Das gelb-angestrichene Mechanikmonster hievte die rechteckigen Container auf das Schiff. Die Mule – Terms Rettung.
Es war schwer sich an das Containerschiff heranzuarbeiten. Die Scheinwerfer wanderten den Hafen wie einen Gefängnishof ab. Eigentlich leuchteten sie den Verladungsarbeiten den Weg, aber Term fühlte sich, als hätten sich die Schweinwerfer gnadenlos auf ihn eingeschossen. Zum Glück waren wenig Menschen auf Nachtschicht. Dafür tauchten diese unerwartet und schneller auf, als Term lieb war. Wie eingefroren drückte er sich an Containerwände, wenn ihn ein Arbeiter zu nahekam oder der Schweinwerfer drohte, über ihn zu wandern. Glücklicherweise kam er voran, da niemand auf dem Gelände mit einem einzelnen Teenager rechnete. Kupfer- und Eisendiebe schon eher, aber die kamen nicht alleine.
»Die ganzen Container gehen nach Cox’s Bazar. Die dürfen auf keinen Fall auf die Mule.« Term quetschte sich zwischen zwei Wellen eines dunkelblauen Containers und traute sich nicht zu atmen. Ein Vorabeiter mit gelbem Helm und ein Hafenangestellter waren geräuschlos aus der Nacht um die Ecke eines Containers gebogen. Hätte Term sich nicht sofort herumgerissen und an den Container gedrückt, hätte er mitten in einer Containerschlucht gestanden, gut sichtbar für jeden. Die zwei Männer studierten die Scancodes der Container vor ihnen. Term hetzte weiter. Ohne zu atmen. Cox’s Bazar klang nicht wie eine echte Stadt. Es klang wie aus einem Science-Fiction-Roman. Obwohl er neugierig war, verdrängte er den exotischen Namen. Er musste die Mule erreichen.
Term setzte sich in eine finstere Ecke und atmete durch. Er hatte die Größe des Hamburger Hafens unterschätzt. Die ständige Anspannung machte die kurzen Sprints von Deckung zu Deckung extrem anstrengend. Er war sportlich, flink und hatte eine gute Kondition. Aber mit der Angst im Nacken verbrannte der Körper seine Energien schnell wie ein Buschfeuer. Aber er kam voran. Als er das Schiff zum ersten Mal gesehen hatte, hatte er sich winzig wie ein Käfer gefühlt. Mittlerweile fühlte er sich so groß wie eine Maus im Vergleich zu dem Metallriesen. Das gute an kleinen Mäusen war, sie fanden auf jedes Schiff – er musste nur in den sicheren Bauch des Stahlriesen gelangen. Term fasste Mut, denn er sah schon einen von mehreren Übergängen zum Containerschiff.
Als er den Schutz der letzten Containerschlucht verließ, rannte er gebückt am Wasserrand entlang. Die Wellen im Hafen schlugen wie Hämmer gegen den grauen Beton. Niemand hatte ihn bisher entdeckt. Term keuchte und erschrak wie laut er klang. Jemand würde ihn hören. Mit einem Griff packte er das Geländer des Übergangs und schwang sich um die Ecke. Seine Schuhe krachten auf das Eisengitter. Verdammt, er würde sich auf die letzten Meter wirklich noch verraten. Aber ein Lächeln stahl sich auf sein Gesicht, als er den Eingang zum Schiff sah. Es war nicht mehr als ein rechteckiges Loch in Menschengröße, das aus dem Rumpf geschnitten war. Der Eingang war völlig finster. Nichts war dahinter zu erkennen. Aber Term sah in der Finsternis Rio. Sambarasseln und das dumpfe und sanfte Aufprallen von den Füßen zweier Capoiera-Kämpfer auf dem Sand hallten ihm aus der Finsternis des Schiffes entgegen.
»Term, du bist exakt 421 km von deiner Heimatstadt entfernt. Erkläre deine unerlaubte Entfernung.« Die Stimme schnitt militärisch korrekt durch seine Hoffnung. Er hatte sich das dumpfe Aufprallen von Füßen nicht vorgestellt. Jemand war hinter ihm in Stiefeln vorgetreten.
»Ich darf überall hingehen, wo ich will. Ich bin ein freier Mensch und wir leben in einer Demo…« Term drehte sich angsterfüllt um.
»Erspar mir die Politik. Zwei relevante Fakten: Erstens, du bist noch nicht volljährig. Zweitens stehst du unter Mordverdacht und darfst dieses Land nicht verlassen.«
»Wer sagt denn, dass ich dieses Land verlassen will. Ich besuche nur den Hamburger Hafen.« Term wollte schlau und frech klingen, aber die Worte waren schwach und er wusste es.
»Das ist dumm. Du wirst dafür nicht einmal eine Antwort von mir bekommen. Versuch nicht wegzurennen, ich werde dich nicht einfangen.« Der Polizist, oder Spezialpolizist, denn er hatte unglaublich viele Waffen und Instrumente an seinem Gürtel, ging keinen Schritt auf ihn zu. Ha, sollte er sich nur so selbstbewusst aufführen. Selbstbewusst war Term auch. Er drehte ihm den Rücken zu und rannte auf den Schiffseingang zu.
»Machen Sie es gut.« Term verzichtete auf Beleidigungen, der Polizist führte nur seinen Dienst aus. Auch wenn er ihn gerade für sein Pflichtbewusstsein verfluchen wollte.
»Hier gibt es keinen Ausweg.« Aus der Dunkelheit trat ein weiterer Polizist einer Spezialeinheit hervor. Term hatte sich immer für schnell gehalten. Aber schneller als er denken konnte, befanden sich seine Arme auf dem Rücken und Handschellen legten sich kühl um seine Gelenke.
Er hatte versagt. Die Spezialpolizisten nahmen ihn in die Mitte und gingen langsam durch den Hafen zurück zum Tor. Nur einmal legte der Chef seine militärische Stimme ab, als er Term der Hamburger Polizei übergab: »Alles Gute zu deinem siebzehnten Geburtstag, Term.«
»Zermscheiße. Wie konnten Sie mich finden?«
Polizeikommissar Karl Berg war frisch rasiert. Seine bleiche Haut glänzte im Licht der Straßenlampen. Er blieb wie immer deutlich unter der Kopflehne. Term sah ihn ja gewöhnlich von der Rückbank eines Polizeiwagens. So wie heute früh, als sie aus Hamburg hinausfuhren.
Was ihn heute dagegen verwirrte, war die großbusige Brünette auf der Rückbank neben ihm. Bisher hatte sie nur geschmollt und kein Wort verloren.
»Polizeikommissar Berg, gönnen sie sich heute noch etwas Vergnügen?«
»Du dreckiger Junge«, platzte es aus ihr heraus. Weder Berg noch Term reagierten auf sie, also fand die Frau es angebracht, sich zu erklären. »Die Schönheitsgestapo hier …«
»Hey, hey, hey«, Berg wollte noch mehr sagen, aber die Frau ließ ihn nicht zu Wort kommen.
»Ja genau, Mr. Gestapo hier fährt mich direkt zur AW. Wo mir meine Brüste zwangsreduziert werden!« Ihr Kreischen war kaum auszuhalten.
»Wir würden sie nicht reduzieren, wenn sie ihre Brüste nicht in Thailand maximiert hätten«, fuhr sie Berg hart an.
»Was geht Sie das an?«, schrie die Frau mit aller Kraft von der Rückbank. »Gefallen sie Ihnen nicht?«
»Laut Gesetz sind alle Menschen gleich schön«, murmelte Berg monoton, »Schönheits-OPs sind verboten und alle im Ausland erfolgten Behandlungen sind rückgängig zu machen!« Der Polizeikommissar fühlte sich sicher im Rezitieren von Gesetzestexten.
»Ich rufe meinen Anwalt an!«
»Ja, rufen sie ihn ruhig an.« Diesen Satz hatte Berg so oft gehört, dass er darauf reagierte, wie auf die Frage nach dem Wetter.
»Weswegen ist denn dieser pubertierende Junge im Auto? Wieso bekomme ich nicht eine Fahrt ohne Problemkind?«
Berg drehte sich kurz nach hinten um. Sein Kopf lugte aus dem hohen Fahrersitz nach hinten. »Verdacht auf Mord und Fluchtversuch.«
Die Frau mit den neuen Brustimplantaten sah ihn angsterfüllt an, rückte näher an ihr Seitenfenster und setzte sich schnell ihre Kommunikationsbrille und Ohrstöpsel auf. Dann lehnte sie ihren Kopf zurück.
»Falls du dich geschmeichelt fühlst, dass dich Spezialpolizisten eingefangen haben, so lag das nicht an dir. Im Hafen verrichten immer ein paar von der Spezialeinheit Dienst. Dort treiben sich ganz andere Kaliber als du herum. Du bist wirklich kein gefährlicher Fall«, Berg fand das lustig. »Aber du bleibst ein Spezialfall von mir.«
Die Sonne ging langsam auf. Berg steuerte den Wagen auf die Autobahn. In Hamburg war nur eine weitere Aktennotiz angelegt worden, seine Daten hatten sie sowieso. Unbefugtes Betreten des Betriebsgeländes. Dann war einige Stunden später Berg erschienen und hatte ihn mitgenommen. Er war tatsächlich sein Fall. Das macht Term Angst. Der Polizeikommissar wirkte so unnachgiebig auf ihn.
»Es war gar nicht so einfach dich zu finden. Deine Eltern haben erst sehr spät bei uns angerufen. Sie dachten, du willst dir wirklich nur deinen Kopf abkühlen. Oder feierst mit Freunden in deinen 17ten hinein. Bis zum Hamburger Bahnhof konnten wir dich leicht verfolgen. Danach mussten wir uns durch das Material der Überwachungskameras durcharbeiten, um rauszufinden, wo du wirklich hinwillst. Denn auf die Gesichtserkennungssoftware hat laut Vorschrift nur die Bundespolizei Zugriff, wir nicht.« Term konnte deutlich hören, dass der Zustand Berg äußerst unrecht war. »Und da hatten wir dich dann gefunden … bei der Imbissbude. Es hat uns noch einmal eine gute halbe Stunde gekostet, bis wir bemerkt hatten, dass du vielleicht irgendwie ins Hafengelände gekommen sein könntest. Das hatten wir dir nicht zugetraut. Der Rest war einfach. Sich in den Schatten zu verstecken, hilft bei der heutigen Technologie nur bedingt. Also haben wir bei den Kollegen angerufen.«
Term schwieg, zu sehr spürte er seine Niederlage: Sein Versagen, das Schiff im letzten Moment nicht erreicht zu haben. Weg von einem Leben, das bis ins letzte Detail verplant war.
»Term, du stellst mich vor ein Problem.« Berg brach das Schweigen erst nach einer langen Zeit.
»Wieso, Herr Berg?« Term lehnte sich vor.
»Nun, bei unserem ersten Treffen dachte ich noch, dass du nicht der Mörder von Herrn Hoffmann bist. Eigentlich …«, Berg lachte, » … ich habe das verräterische Wort tatsächlich gesagt. Eigentlich kann ich Menschen recht gut einschätzen. Aber die abschließende Analyse von Dr. Bolz steht ja noch aus.« Term konnte seinen Humor nicht teilen, es ging hier um seine Zukunft. »Aber durch deinen Fluchtversuch nicht lange nach dem Tod des Seniors, dem Tortenvorfall und der Gefährdung der NeoVivo-Patienten in der AW erhärtet sich der Verdacht gewaltig.«
»Was bedeutet das?«
»Die Untersuchung des Todes war schon abgeschlossen. Ich hätte sie zu den Akten gelegt, aber jetzt muss der Vorfall neu aufgerollt werden.« Term bemühte sich keine Regung zu zeigen, denn Berg sah sein Gesicht im Rückspiegel. Er schien jede seiner Regungen zu beobachten. »Das bedeutet mehr Tests. Spezialtests wegen des Mordverdachts – alles, was die Routineuntersuchung in der Regel nicht macht.«
Wieder schwiegen beide länger und wieder brach Berg das Schweigen. »Du bist jetzt 17, Term. Damit trifft dich das Erwachsenenstrafrecht. Bitte überdenke deine nächsten Schritte.«
Als sie von der Autobahn herunterfuhren, sagte Term: »Ich habe ihn nicht umgebracht.«
»Ich wünschte, ich könnte dir glauben. Alles Gute zum Geburtstag, Term.«