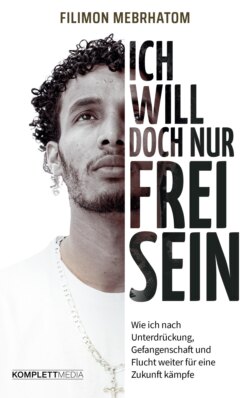Читать книгу Ich will doch nur frei sein - Filimon Mebrhatom - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Meine Ausbildung zum Kameramann
ОглавлениеWieder und wieder fragte ich mich, wie es sein konnte, dass so viele Kinder am Feld und im Wald arbeiten mussten, anstatt zur Schule zu gehen. Ich habe damals oft geweint. Meiner geliebten Familie stellte ich immer wieder die Frage, wie ich mir denn eine bessere Zukunft aufbauen könnte. So kam es, dass ich eines Tages die Entscheidung traf, von zu Hause wegzugehen und Kameramann zu werden.
Meine geliebte Mutter machte sich große Sorgen um mich und weinte viel, als ich ihr meine Entscheidung mitteilte. Ich könne mir doch nicht einmal selbst Essen zubereiten, klagte sie. Aber hinter dieser banalen Sorge verbargen sich noch ganz andere, viel größere Bedenken. Die Ausbildung zum Kameramann fand in der Stadt Senafe statt, die für ihre spektakulären Felsen und ihre Lage am Rand der Berge bekannt ist. Senafe liegt auf beinahe 2500 Meter Seehöhe. Gleich in der Nähe liegt Matara, ein Ort, der für seine archäologischen Funde bekannt ist. Dort finden aber auch oft militärische Kontrollen statt.
Um Senafe gibt es wunderbare Wanderwege. Vielerorts findet man Wasserfälle mit gutem, sauberem Wasser, mit dem man sich abkühlen kann, und kleine Bergwiesel laufen umher. Von den Bergen hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt und die umliegenden Dörfer. In Senafe gibt es christliche Kirchen und Moscheen. Muslime und Christen leben hier friedlich zusammen.
Die Ankunft in der Stadt war für mich nicht einfach: Ich musste zwei Tage im Freien schlafen, da ich kaum Geld hatte und niemanden kannte. Danach fand ich für wenig Geld ein undichtes Zimmer in einem Wohnhaus, mit einem nassen und unangenehmen Bett. Gegessen habe ich in dieser Zeit nur wenig. Für das Zimmer musste ich monatlich 150 Nakfa auftreiben, zusätzlich dazu kostete die Kameraschule im Monat 350 Nakfa Gebühren. Ich bat meinen Vater, mir zu helfen – er schickte mir zwar regelmäßig Geld, die Schulgebühren musste ich aber selbst bestreiten. Ich schlug mich in Senafe mit Gelegenheitsjobs durch, um das Geld zusammenzubekommen.
Die Unterrichtsbedingungen in der Foto- und Kameraschule in Senafe waren alles andere als ideal: Es gab nur eine sehr spartanische Einrichtung und nicht einmal Tische, sodass wir auf dem Schoß schreiben mussten.
Hinzu kam, dass die Regierung oft den Strom abschaltete. Fehlte das elektrische Licht in meinem Dorf zur Gänze, so gab es in einer Stadt wie Senafe bestenfalls stundenweise Strom – dann wieder keinen. Viele Menschen versuchen, sich deshalb mit lauten und stinkenden Dieselgeneratoren durchzuschlagen.
Für unsere Klasse mit 85 Schülerinnen und Schülern standen nur drei Kameras zu Verfügung. Pro Woche konnte jeder Schüler nur rund zehn Minuten mit einer Kamera arbeiten. Wie soll man so lernen können, dachte ich mir oft.
Ich bekam das Gefühl, dass ich mein Geld verschwendete. Nur theoretisch zu lernen, danach stand mir nicht der Sinn. Doch weil ich mein Ziel unbedingt erreichen wollte, blieb ich während der vollen Ausbildungszeit von drei Monaten in der Stadt.
Der Unterricht begann jeden Tag um vier Uhr nachmittags und ging bis halb sieben Uhr abends. Zu Beginn war ich sehr einsam – die meisten Jugendlichen hatten ein soziales Umfeld in Senafe, ich aber kannte niemanden.
Ich vermisste meine Familie, besonders meine Mutter, schrecklich. Ja, ich fühlte mich so einsam, dass ich bereits für das erste Wochenende zu Fuß nach Hause zurückkehrte. Wie groß war die Wiedersehensfreude! Meine Füße schmerzten vom vielen Laufen, meine Kleider waren schmutzig, doch wie schön war es, wieder bei den Eltern zu sein! Zu diesem Anlass wurden eine Henne geschlachtet und ein Fest gefeiert. Ich aß zwar kein Fleisch, war aber trotzdem überglücklich.
Meine Mutter fragte mich Löcher in den Bauch über mein Leben in Senafe: Was isst du? Wie wohnst du? Hast du Freunde? Ich wollte ihr nicht von meiner Einsamkeit erzählen, da ich Angst hatte, dass sie sich zu viele Sorgen machen würde. Aber in Wahrheit fehlte sie mir schrecklich. Zu Hause hatte meine Mutter selbst Brot gebacken; morgens hatte ich es immer frisch, noch warm gegessen. In Senafe hingegen aß ich nur schlechtes gekauftes Essen.
Um meine Mutter zu besänftigen, versuchte ich, ihr zu erklären, dass ich durchhalten müsse, um meinen Traum, Kameramann zu werden, zu erreichen. Dafür sei es eben notwendig, allerlei Entbehrungen auf mich zu nehmen. Doch sie ließ nicht locker und bestand darauf, dass sie mir regelmäßig frische Semmeln und Injera, das eritreische Fladenbrot, nach Senafe bringen würde.
Meine Mutter war damals bereits gesundheitlich angeschlagen, und ich wusste, dass ihr der weite Weg schwerfallen würde. Ich versuchte deshalb, ihr mit allen Mitteln klarzumachen, dass ich meine neue Aufgabe allein würde meistern können. Und so kamen wir an diesem Tag überein, dass sie für mich eine große Ration Brot backen würde, die ich dann nach Senafe mitnehmen würde.
Am darauffolgenden Tag brach ich um vier Uhr morgens auf. Wieder lief und lief ich, viele Stunden lang. Meine Füße schmerzten wegen der schlechten Straßenbedingungen und meines schweren Gepäcks. Ich ging den ganzen Tag, bis es dunkel wurde und ich Angst bekam, von wilden Tieren angefallen zu werden. Irgendwann kam ich endlich in Senafe an und fiel todmüde in mein Bett.
Die Zeit verging wie im Flug. An den Wochenenden besuchte ich weiterhin meine Familie. Meine Mutter hatte niemals die Möglichkeit gehabt, einer Lohnarbeit nachzugehen. Sie war immer zu Hause, umsorgte uns Kinder, kochte und wusch die Wäsche. Meine Sorge um sie erhöhte meine Motivation noch weiter, gut und strebsam zu lernen. Da ich wusste, dass es in Eritrea keinerlei Unterstützung für alte Menschen gab, fasste ich den Vorsatz, später Geld zu verdienen und meine Familie zu unterstützen.
In Senafe konnte ich mich alles andere als frei bewegen, denn das Militär patrouillierte ständig in der Stadt. Ich hatte keinen Pass, und es hätte leicht passieren können, dass ich zu dem berüchtigten »National Service«, also dem Militärdienst, eingezogen wurde. So machte ich niemals lange Spaziergänge und konnte auch die wunderschöne Umgebung der Stadt nicht genießen. Man wusste nie, wann die Militärs auftauchen würden. Unwillkürlich drehte man sich jeden zweiten Moment um – es herrschte eine regelrechte Paranoia.
Ich spürte in Senafe zum ersten Mal in meinem Leben die Einschränkung der Meinungsfreiheit, die in Eritrea auch heute noch vorherrscht. Es war beklemmend und machte Angst, ständig Soldaten zu sehen und zu wissen, dass sie die Macht hatten, mich mitzunehmen und mir vorzuwerfen, etwas gegen das Regime gesagt zu haben.
In dieser Zeit dachte ich oft an meine liebe Schwester zurück. Sie war während meiner Schulzeit auf tragische Weise während der Flucht aus Eritrea gestorben. Meine Schwester war ein sehr guter Mensch gewesen, eine ausgezeichnete Schülerin und besonders fleißig. Sie schrieb großartige Gedichte und trug diese vor. Es beeindruckte mich als Kind ungemein, wie sie es mit Leichtigkeit schaffte, die Leute zum Lachen zu bringen.
Doch dann geschah das Unvermeidliche: Wie alle anderen Menschen in Eritrea wurde sie nach der elften Klasse zur Ausbildung in das Militärcamp Sawa berufen. Meine Schwester hatte den Plan zu heiraten, um der Einberufung zu entgehen. Nie hatte sie vorgehabt, eine Ehe einzugehen, aber nun tat sie es, um dem »National Service« zu entkommen. Der Mann, den sie heiratete, war beim Militär – so erhoffte sie sich, der Einberufung entgehen zu können. Sie sollte sich bitter täuschen. Der Militärdienst war auch für sie unvermeidlich. Sie wurde schwanger, gebar ein Kind und ließ es sechs Monate nach der Geburt bei meiner Mutter zurück. Dann ging sie aus Eritrea fort.
Mir, ihrem kleineren Bruder, hatte sie nichts davon erzählt, um mich nicht zu verletzen. Dann, eines Tages, es war ein Sonntag, bekamen wir die schreckliche Nachricht: Meine Schwester war bei ihrer Flucht im Fluss Tekeze, im Dreiländereck zwischen Eritrea, Äthiopien und dem Sudan, ertrunken. Das war im Jahr 2009 – ich war da gerade einmal zehn Jahre alt.
Selbst die Heirat und ihr Kind hatten meine Schwester nicht vor dem schrecklichen Militärdienst schützen können. Sie hatte keinen anderen Ausweg gesehen, als das Land illegal zu verlassen, und musste dies mit ihrem Leben bezahlen.
Mein Vater bekam die Hiobsbotschaft, als er gerade bei uns im Dorf den Gottesdienst vorbereitete. Er brach zusammen und musste von zwei Männern nach Hause gebracht werden. Ich schlief noch und wurde vom Weinen und Schreien meiner Eltern geweckt.
Es war eine schreckliche Zeit.
Ich konnte die Nachricht nicht fassen und weinte tagelang. Außer mir vor Schmerz wusste ich zeitweise nicht einmal, wo ich war. Alles in mir sträubte sich dagegen, den Tod meiner lieben Schwester zu akzeptieren.
Dieser schwere Schicksalsschlag war der Grund dafür, dass mich meine Mutter unaufhörlich davor gewarnt hatte, von daheim wegzugehen, um den Beruf des Kameramanns zu erlernen. Sie wusste genau, dass es viel wahrscheinlicher war, vom Militär eingezogen zu werden, wenn man in einer Stadt lebte, als wenn man im Dorf blieb. Sie hatte unter keinen Umständen ein weiteres Kind verlieren wollen.
Am Ende der Ausbildungszeit in Senafe mussten wir eine Abschlussarbeit machen und haben zwei Tage lang einen Film gedreht. Ich war überglücklich. Außerdem hatte ich mittlerweile neue Freunde gewonnen. Zur Abschlussfeier lud ich meinen Vater ein. Da ich aufgrund der fehlenden technischen Möglichkeiten nicht zu Hause im Dorf anrufen konnte, musste ich wieder zurückkehren und ihn abholen. Alle in meiner Familie waren stolz, dass ich den Abschluss geschafft hatte. Bei der Feier in Senafe waren dann die Bürgermeister der umliegenden Städte und Dörfer versammelt, und wir bekamen unsere Urkunden überreicht.
Jeder, der den Abschluss geschafft hatte, sollte dann auf der Bühne ein paar Worte sagen und erklären, warum er oder sie den Beruf an der Kamera gewählt hatte. Ich kündigte allerdings noch vor der Feier an, dass ich nichts sagen würde; der Grund war einfach: Ich wusste bereits, wie leicht es passieren konnte, dass man wegen einer unbedachten Aussage ins Gefängnis kam. So nahm ich nur mein Zeugnis entgegen und reiste mit meinem Vater am Tag darauf ab. Ich war erleichtert und froh, nicht vom Militär eingezogen worden zu sein.
EXKURS: Warum fliehen Menschen aus Eritrea?
Eritrea ist ein wunderschönes Land am Horn von Afrika. Seine Größe ist mit etwa 121.000 Quadratkilometern vergleichbar mit der Größe von Bulgarien. Das Land wird von etwas mehr als fünf Millionen Menschen bewohnt und grenzt im Nordwesten an den Sudan, im Süden an Äthiopien, im Südosten an Dschibuti und im Nordosten an das Rote Meer. Rund ein Viertel der Bevölkerung Eritreas konzentriert sich auf die Hauptstadtregion Asmara, die weiteren Städte des Landes sind deutlich kleiner.
Klimatisch ist Eritrea divers: Es reicht von der beinahe wüstenartigen Trockensavanne am Roten Meer über das niederschlagsreiche Hochland im Landesinneren, wo sich die meisten größeren Städte befinden, bis zum im westlichen Teil des Landes gelegenen Anteil an der Sahara.
Eritrea teilt mit den meisten Ländern Afrikas eine unheilvolle Geschichte von Kolonisierung und Unterdrückung durch die Europäer. So wurde das heutige Eritrea im Jahr 1890 zur italienischen Kolonie. Doch diese erste Phase europäischer Herrschaft dauerte nicht lange: Während des ersten italienisch-äthiopischen Krieges besiegte das Kaiserreich Abessinien, zu dem auch Eritrea gehörte, im Jahr 1896 in der Schlacht von Adua das Königreich Italien – das Land konnte seine Unabhängigkeit wiederherstellen.
Kaiser Menelik II. modernisierte das Land während seiner Herrschaft und erweiterte das Kaiserreich. Im Jahr 1923 wurde Äthiopien, neben Liberia und dem Königreich Ägypten der einzige unabhängige Staat Afrikas, in den Völkerbund aufgenommen. Kaiser Haile Selassie führte 1931 die erste Verfassung des Landes ein.
Nach dem Überfall des faschistischen Italiens auf Äthiopien erlebte das Land seine zweite Phase der Kolonisierung. Abessinien, und somit auch das heutige Eritrea, wurde im Jahr 1936 in das neu gegründete Italienisch-Ostafrika eingegliedert und stand somit unter der Kontrolle Roms.
Im Zuge des Zweiten Weltkriegs erkämpfte sich Großbritannien die Vorherrschaft in der Region. Das heutige Eritrea stand somit ab dem Jahr 1941 unter britischer Militärverwaltung und wurde im Jahr 1947 – nach der formellen Aufgabe Eritreas durch Italien – britisches Mandatsgebiet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich Eritreas lange und konfliktreiche Geschichte mit dem großen Nachbarn Äthiopien fort: Der mächtige äthiopische Kaiser Haile Selassie hatte sich zwar große Verdienste im antikolonialen Kampf gegen die faschistische Besatzung durch die Italiener erworben, doch nach einem Votum der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1952, das eine Föderation der Provinz Eritrea mit dem Kaiserreich Abessinien vorsah, wurden die politischen Rechte der eritreischen Bevölkerung systematisch ausgehöhlt. Im Jahr 1961 wurde Eritrea durch die (Selbst-)Auflösung des eritreischen Parlaments an Äthiopien annektiert.
Danach folgte der entbehrungsreiche dreißig Jahre andauernde Kampf des eritreischen Volks um Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.3 Besonders interessant an diesem Befreiungskampf ist meiner Ansicht nach die Analyse des Aufstiegs und der Pervertierung von ursprünglich sozialistischen, nach Freiheit und Gerechtigkeit strebenden politischen Bewegungen. Ich möchte das näher erklären:
Bereits im Jahr 1952 begann in Eritrea der Widerstand gegen den äthiopischen Kaiser Haile Selassie. Ab den späten 1960er-Jahren wurde der Widerstand gegen den autoritären und despotischen Kaiser in erster Linie von der gesamtäthiopischen sozialistischen Bewegung getragen, auch MEISON genannt. Die MEISON wurde im Wesentlichen von sowohl in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, als auch in Europa und Nordamerika lebenden Studenten und Studentinnen gegründet und reihte sich in ihrer Programmatik in die Zielsetzungen der linken antikolonialen Befreiungsbewegungen ein.
Das feudale System von Kaiser Selassie sollte überwunden werden. Vorrangig ging es um Freiheit und Gerechtigkeit, um eine grundlegende Bodenreform, die den armen Bäuerinnen und Bauern zugutekommen sollte, sowie um bessere Bildungschancen für die Jugend.
Am 12. September 1974 gelang das Unwahrscheinliche: Kaiser Haile Selassie wurde gestürzt. Im März 1975 war die Monarchie Geschichte. Äthiopien – und mit ihm das angegliederte Eritrea – wurde zu einer sozialistischen Volksrepublik, und der sogenannte »Derg« – eine von der Sowjetunion unterstützte Militärjunta – übernahm die Macht. Anführer der Derg war der charismatische, aber gefürchtete Mengistu Haile Mariam. (Er regierte Äthiopien bis 1991.) Doch statt eine Gesellschaft zu etablieren, in der die selbst proklamierten Ziele von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verwirklicht wurden, errichtete der Derg eine brutale Gewaltherrschaft.
Die Zeit des sogenannten »Roten Terrors« begann, und Äthiopien sowie das angegliederte Eritrea versanken in einer blutigen Diktatur. Obwohl der Derg behauptete, eine klassenlose Gesellschaft ohne jede Herrschaft errichten zu wollen, wurden Zehntausende Oppositionelle und Gegner des Regimes verhaftet, gefoltert und exekutiert. Besonders tragisch ist, dass jegliche Versuche, in Äthiopien und Eritrea ein sozialistisches System einzuführen, ihr Ziel verfehlten und zu blutigen Diktaturen führten.
Der weltbekannte äthiopische Regisseur Haile Gerima hat das Scheitern des äthiopischen Sozialismus in seinem Spielfilm »Teza« thematisiert. Darin legt er ein eindrucksvolles Zeugnis über die Zeit der kommunistischen Derg-Regierung ab.4
Kurz gesagt: Die Revolution fraß ihre Kinder, und der Derg begann, mit brutalen Methoden zu herrschen. Seine Gewalt richtete sich gegen viele Revolutionäre aus den eigenen Reihen. Die Folge war, dass sich vor allem in den Regionen Tigray und in Eritrea bewaffneter Widerstand formierte.
Im Jahr 1988 gelang es eritreischen Guerilla-Kämpfern bei der berühmten Schlacht von Afebet – einer der größten militärischen Auseinandersetzungen, die jemals auf afrikanischem Boden stattgefunden haben –, einen legendären Sieg über die zahlenmäßig massiv überlegenen Äthiopier zu erringen.5
Mit dieser Schlacht wendete sich das Blatt: Im Jahr 1991, bald nachdem die Sowjetunion ihre Finanzhilfen für Mengistu eingestellt hatte, konnte der Derg entmachtet werden. Eritreische Befreiungskämpfer leisteten einen großen Beitrag zur Überwindung des Regimes.
Meles Zenawi, der in jungen Jahren die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) angeführt hatte und der ab 1989 ein breites Bündnis äthiopischer Oppositionsgruppen anführte, gelang mit der Unterstützung der eritreischen Guerrieros im Mai 1991 der lang ersehnte Sturz des Mengistu-Regimes.
Der Krieg hatte 200.000 Tote gefordert, die einerseits der Waffengewalt, andererseits dem mit dem Krieg einhergegangenen Hunger zum Opfer gefallen waren.
Mengistu floh nach Simbabwe, wo er heute noch lebt, ohne für seine furchtbaren Verbrechen zur Verantwortung gezogen worden zu sein. Doch die neuen Herrscher in Addis Abeba brachten keine Verbesserung: Ohne den Beitrag der eritreischen Kämpfer für die Überwindung des Derg-Regimes zu würdigen, hielten sie Eritrea weiterhin unter ihrer Kontrolle.
Obwohl sich auch diese Regierung als demokratisch-sozialistisch bezeichnete, gab es weder Demokratie noch Gerechtigkeit. Trotz des Sturzes von Mengistu wollte der neue äthiopische Präsident Meles Zenawi Eritrea nicht in die Unabhängigkeit entlassen. So kämpfte Eritrea weiterhin um Selbstbestimmung.
Im eritreischen Befreiungskampf spielte ein Mann mit dem Namen Isayas Afewerki eine maßgebliche Rolle. Er wurde im Jahr 1969 zum Oberbefehlshaber der Eritreischen Befreiungsfront (ELF) ernannt, der damals wichtigsten Guerillaarmee im Kampf gegen den zu dieser Zeit noch herrschenden Kaiser Selassie von Äthiopien. Afewerki vereinte in seiner Person seit jeher ein außergewöhnliches Führungstalent, Charisma, militärische Kompetenz und Durchsetzungsvermögen.
Kurze Zeit später befehligte Afewerki die eritreische Volksbefreiungsfront EPLF, die im Jahr 1970 aus einer Spaltung mit der ELF hervorging und die fortan den Ton im Kampf um die Unabhängigkeit angab. 1988 begann die EPLF ihre Offensive in Richtung Äthiopien. Zusammen mit der Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF, hatte Afewerki einen wesentlichen Anteil am Sturz des Regimes von Mengistu.
Am 24. Mai 1991 nahm die EPLF dann auch Eritreas Hauptstadt Asmara ein und beendete damit den Unabhängigkeitskrieg. Genau zwei Jahre später, am 24. Mai 1993, löste sich Eritrea auch formell endlich von Äthiopien los, nachdem bei einer durch die Vereinten Nationen überwachten Volksabstimmung eine große Mehrheit der eritreischen Bevölkerung für die Unabhängigkeit gestimmt hatte.
Eritrea war somit eines der letzten Länder Afrikas, die sich von einer ausländischen Besatzung befreiten. Der Jubel in Asmara war gigantisch.
Doch in den letzten dreißig Jahren wandte sich die Politik im nun unabhängigen Eritrea immer mehr gegen das eigene Volk. Isayas Afewerki, der zu Beginn als Freiheitsheld gefeiert worden war, wurde immer mehr zu einem brutalen Diktator.6
Schon im Jahr 1998 war es mit dem Frieden zwischen Eritrea und Äthiopien vorbei – ein absurder Territorialkrieg um das Grenzstädtchen Badme, der insgesamt 80.000 Tote fordern sollte, entbrannte. 2002 sprach ein internationales Schiedsgericht Badme Eritrea zu, aber Äthiopien akzeptierte den Entscheid nicht. Eine Periode des Kalten Krieges begann. Afewerki benutzte die Bedrohung durch Äthiopien, um den berüchtigten Militärdienst, der bisher achtzehn Monate betragen hatte, für unbefristet zu erklären, schaltete die freie Presse aus und ließ Regimekritiker verhaften.
Im November 2019 erklärte der eritreische Informationsminister Yemane Gebremeskel, dass der Militärdienst wieder auf die ursprünglichen achtzehn Monate zurückgestuft werden sollte. Doch solche Ankündigungen waren schon früher gemacht worden. Von einer Lockerung der Repression ist bis jetzt nichts zu spüren.
So wichtig und heldenhaft sein Einsatz für die Unabhängigkeit Eritreas auch gewesen war – zunächst im Kampf gegen Kaiser Haile Selassie, dann gegen Mengistu und den »Roten Terror« und schließlich gegen Meles Zenawi –, so schlimm war es für die eritreische Bevölkerung festzustellen, dass auch Afewerki die sozialistischen Ideale missbrauchte und eine Schreckensherrschaft aufbaute.
Heute ist Eritrea eine der schlimmsten Diktaturen der Welt und wird zu Recht als »Nordkorea Afrikas« bezeichnet. Ich durfte zu keinem Zeitpunkt frei meine Meinung sagen. Solange diese Diktatur an der Macht ist, herrscht keine Freiheit – nur politische Unterdrückung und Armut. Afewerki möchte mit allen Mitteln an der Macht bleiben. Und weil er Angst vor einem Regierungswechsel hat, unterdrückt er jegliche andere Meinungen. Die Gesetze formt er nach seinem Willen. Kaum jemand in Eritrea erwartet noch Gutes unter seiner Herrschaft.
Deswegen floh ich in andere Länder, auf der Suche nach Freiheit. Ich hatte keine Möglichkeit, in Eritrea meine Wünsche zu verwirklichen oder mir dort eine Zukunft aufzubauen.
Seit ich geboren bin, sehe ich immer nur Leiden unter dieser Macht. In meiner geliebten Heimat zu leben heißt, sein Leben zu verlieren. Familienväter, Mütter und ihre viel zu jungen Kinder werden ins Militär gezwungen. Die eritreische Regierung sperrt die Menschen nicht nur in Gefängnisse, sondern auch in Arbeitslager. Wer in Eritrea eine andere Meinung vertritt als die der Regierung, wird ins Gefängnis gebracht und verbringt sein restliches Leben in Fesseln. Sogar viele ehemalige Weggefährten des Präsidenten Afewerki wurden einfach weggesperrt.
Unzählige junge Menschen sind in den zahlreichen Gefängnissen des Landes. Sie sehen ihre Familien oftmals nie wieder und leben unter schrecklichen Bedingungen. Die Familien wissen oft nicht, wie es Müttern, Vätern, Söhnen oder Töchtern geht. Sie bringen ihnen Lebensmittel und Geld zu den Gefängnissen, damit sie nicht verhungern, dürfen ihre Verwandten aber nicht sehen. Oft werden die Lebensmittel und Geschenke, die die Verwandten bringen, nicht weitergegeben, sondern von den Wärtern einbehalten. Viele Gefangene sterben an den schrecklichen Haftbedingungen.
Ich frage mich so oft, wie es nach dem Unabhängigkeitskrieg so weit kommen konnte. Die Unabhängigkeit von Äthiopien im Jahr 1993 war ein großer Erfolg, und es gab so viel Hoffnung. Doch seither fanden keine freien Wahlen statt. Warum werden Menschen noch immer eingesperrt? Wieso können sie nicht frei leben in ihrem Land, nach diesem langen und entbehrungsreichen Krieg? Warum dürfen die jungen Menschen in Eritrea nicht über ihr eigenes Schicksal entscheiden? Wenn man keine Freiheit bekommt, ist es nur logisch, dass man flieht und sein Glück in anderen Ländern sucht.
Es stimmt zwar, dass nicht alles schlecht ist in Eritrea. Die HIV-Rate sowie die Mütter- und Säuglingssterblichkeit sind niedrig. Obwohl Eritrea ein sehr armes Land ist, gibt es zumindest in den Städten kostenlose Gesundheitsgrundversorgung. Die Minister und der Präsident leben nicht in dekadentem Saus und Braus, wie das in vielen anderen Ländern der Fall ist. Konflikte zwischen Ethnien und zwischen den Religionen existieren kaum.
Junge Menschen können sich in Eritrea aber nicht frei entwickeln – das Militär ist keine gute Schule. Die Dinge, die junge Menschen dort erlernen, sind grauenvoll. Die Gewalt, die an jungen Mädchen während des Militärdienstes verübt wird, ist schrecklich. Es kommt zu Vergewaltigungen, dabei sind es vor allem Angehörige höherer Dienstgrade, die die Frauen missbrauchen, und sie haben keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Wehrdienstverweigerer werden geschlagen oder getötet. Ich fordere die bedingungslose Einhaltung der Menschenrechte in meinem Land.
Leider wissen nicht viele Menschen in westlichen Ländern, warum so viele Jugendliche aus Eritrea fliehen. Ich möchte es in diesem Buch allen erklären! Niemand verlässt aus Jux und Tollerei sein Land. Der Zwang zum Militärdienst ist der wichtigste Grund, aber auch die fehlende Meinungsfreiheit, die ständige Gefahr, eingesperrt zu werden, und die Not und das Elend in unserem Land.
Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed, der sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, ist es zu verdanken, dass sich die Lage in der Region etwas entspannt hat. Doch auch nach dem berühmten Friedensabkommen zwischen Eritrea und Äthiopien vom Sommer 2018, auf das die Öffnung der Grenzen zwischen den beiden Staaten folgte, scheint sich in Eritrea die Lage nicht wirklich zu verbessern.7
Afewerki bleibt bei seinem paranoiden Kurs. Bereits im Dezember 2018, nur fünf Monate nach dem historischen Friedensabkommen, begann Eritrea damit, die ersten Grenzübergänge zu Äthiopien wieder zu schließen – ohne Angabe von Gründen. Im März 2019 wurde die Abriegelung der Grenze immer lückenloser, seit April sind alle Grenzübergänge wieder geschlossen. Vielfach wird diese neuerliche Grenzschließung vor allem als Zeichen der Angst aufseiten der eritreischen Führung interpretiert, da sie ein Überschwappen von Protestwellen aus den Nachbarländern fürchtet.
Vor allem nach dem Sturz des brutalen Al-Bashir-Regimes im Sudan fürchtet Afewerki, dass er der Nächste sein könnte, der durch eine dynamische soziale Bewegung vom Thron gestoßen werden könnte.
Freiheit bedeutet, dass jeder ohne Probleme seine eigene Meinung äußern kann. Freiheit bedeutet, dass sich jeder Mensch, sei es auf dem Land oder in der Stadt, angstfrei bewegen kann. Alle politischen Gefangenen müssen befreit werden, eine neue Regierung muss demokratisch gewählt werden.
Doch Eritrea belegt seit fünfzehn Jahren einen der letzten drei Plätze auf der Rangliste der Pressefreiheit von »Reporter ohne Grenzen«. In der Ausgabe des internationalen Rankings vom Mai 2019 schnitten nur Turkmenistan und Nordkorea schlechter ab.
Seit 2001, also nur zwei Jahre nach meiner Geburt, gibt es in Eritrea keine unabhängigen Medien mehr. Im Zuge einer politischen Säuberungsaktion schloss die Regierung damals alle nichtstaatlichen Medien und inhaftierte zahlreiche Journalistinnen und Journalisten. Einzig die Staatsmedien dürfen seither Nachrichten verbreiten, doch auch sie sind streng zensiert. Ich habe also praktisch niemals in meinem Leben erlebt, dass es in Eritrea freie Meinungsäußerung gab.
Es gibt kaum Nichtregierungsorganisationen, nur die Regierungspartei und eine einzige von der Regierung kontrollierte Zeitung. Das Rote Kreuz hat nicht das Recht, Gefangene zu besuchen, wie das normalerweise üblich ist. Dazu kommt, dass der Internetzugang sehr eingeschränkt ist.
Freie Wahlen sind nicht existent. Isayas Afewerki, der mittlerweile 73 Jahre alt ist, hat auch nicht im Geringsten vor, in Zukunft Wahlen oder andere Parteien zuzulassen. Eine Verfassung wurde zwar schon im Jahr 1997 geschrieben, sie trat aber nie in Kraft. Präsident Afewerki bezieht seine Legitimität vor allem aus seiner Rolle als Guerilla-Führer. Doch diese Legitimität ist längst verblasst.
3 Stauffer, Hans-Ulrich (2017): Eritrea – der zweite Blick. Rotpunkt-Verlag. https://rotpunktverlag.ch/buecher/eritrea-der-zweite-blick
4 Gerima, Haile (2008): Teza. DVD, Trigon-Film
5 Battle of Afabe 1988. https://www.youtube.com/watch?v=m4Jo5hRHgEA
6 https://www.nzz.ch/international/eritrea-schoene-fassade-vor-harter-repression-eine-reportage-ld.1521984
7 https://www.dw.com/de/ende-des-%C3%A4thiopisch-eritreischen-fr%C3%BChlings/a-48551674