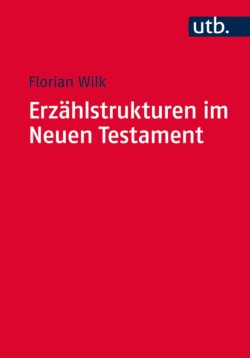Читать книгу Erzählstrukturen im Neuen Testament - Florian Wilk - Страница 11
2.4.1 Metakommunikative Sätze mit folgender direkter Rede
ОглавлениеInnerhalb der Erzählung[61] finden sich folgende Belege: a) Nach Lk 15,12a–c brachte der jüngere Sohn einen Wunsch vor den Vater; anstelle einer Antwort wird vom Vollzug des Erbetenen erzählt. b) In 15,17–19 wird ein Selbstgespräch jenes Sohnes zitiert, in dem er auch eine Ansprache an den Vater konzipierte (15,18afin.–19); es folgt (beginnend mit V. 20a) die Darstellung der Umsetzung seines Vorhabens. c) Laut V. 21 trug der Sohn dem Vater auf dessen wortlose Begrüßung hin den ersten Teil der geplanten Ansprache vor. Die Verse 22–24b bieten dann, statt einer Antwort an den Sohn, einen Auftrag des Vaters an seine Diener, dessen Erledigung V. 24c voraussetzt. d) V. 27 stellt dar, was eine Bursche, den der ältere Sohn gerufen hatte (V. 26init.), auf dessen in indirekter Rede angeführte Frage (V. 26fin.) antwortete; die Reaktion des Sohnes erfolgte ohne weitere Worte (V. 28a). e) Während V. 28b erzählt, wie der Vater diesem Sohn »zuredete«, wird zum Schluss ein Wortwechsel zwischen Sohn (15,29f.) und Vater (15,31f.) wörtlich wiedergegeben.
Die Relevanz der Sequenzen aus Redeeinleitung und direkter Rede erhellt schon daraus, dass sie insgesamt gut die Hälfte des Textes ausmachen.[62] Zudem enthalten sie Wertungen des Geschehens.[63] In der Tat lassen sie sich anhand der Identitäten von Sprecher und Adressat sowie des jeweils Gesagten zu Gruppen verbinden, die den Aufbau der Erzählung erkennbar machen. Zuerst redet nur der jüngere Sohn: Er fordert den Vater auf, ihm sein Erbteil auszuzahlen (Lk 15,12a–c), und bereitet damit seinen Fort- sowie Niedergang vor; er gedenkt im Selbstgespräch seines Vaters und plant Aufbruch und Rückkehr (15,17–19), inklusive einer Ansprache an ihn; angekommen – und voll Mitleid begrüßt –, bekennt er dem Vater, gesündigt und den Sohnesstatus verspielt zu haben (V. 21). Daraufhin spricht der Vater, wendet sich aber an seine Diener (15,22–24b); das in Auftrag gegebene Fest wird sofort begonnen. Ab V. 25 ist es der ältere Sohn, der Gespräche führt: zunächst mit einem der Burschen, der, herbeigerufen und befragt, ihm erklärt, warum es ein Fest gibt (15,26f.); sodann mit dem Vater, der |19|ihm in seinem Zorn zuredet (V. 28a–b) und auf seinen Protest hin (15,29f.) das Schlusswort spricht, das ihn der Gemeinschaft mit dem Vater versichert, zugleich aber das Fest für den »Bruder« für notwendig erklärt (15,31f.). Demnach ist der Text wie folgt zu gliedern:
Diese Betrachtungsweise lässt die Zweiteiligkeit der Erzählung (mit der Grenze zwischen Lk 15,24 und 25) klar zutage treten. Sie macht darüber hinaus deutlich, dass auf der erst entworfenen,[64] dann dem Vater vorgetragenen Ansprache des jüngeren Sohnes (15,18b–19.21) – der Sache nach also auf dessen Reue und Umkehr – ein starker Akzent liegt. Nicht zuletzt vermittelt sie die Einsicht, dass die beiden Hauptteile zum Ende hin parallel strukturiert sind: Beiden Söhnen kam der Vater freundlich entgegen (V. 20b, V. 28b); beide betonten, auf je eigene Weise, ihre innere Distanz zum Vater (V. 21 und 15,29f.); beide vergewisserte er daraufhin ihrer Gemeinschaft mit ihm (V. 22b–c, V. 31b–d)[65], um abschließend hier wie dort von dem Fest zu sprechen, mit dem die Rückkehr des jüngeren Sohnes ins Leben gefeiert wurde (15,23–24b und 32). Freilich richtet sich das Wort des |20|Vaters in 15,22–24b an seine Diener. Ihnen, die er zu Mitfeiernden gemacht hat (V. 23c.24c), wird also in der Erzählung der ältere Sohn gegenübergestellt, der sich fernhielt und von dem am Ende offen bleibt, ob er sich zur Mitfreude bewegen ließ.
Am Beispiel von Lk 15,11b–32 zeigt sich somit: Anhand der Einbindung wörtlich zitierter Äußerungen von und Gespräche zwischen den Protagonisten einer Erzählung kann man einen Überblick über ihre Anlage gewinnen und erkennen, welche Rollen jene Figuren in einzelnen Abschnitten und im Gesamtgefüge des Textes einnehmen. Zudem wird sichtbar, welche Impulse das Fortschreiten der Handlung bewirken. Offen bleibt freilich, in welchem hierarchischen Verhältnis zueinander die einzelnen Sequenzen stehen und welche Sinnlinien sie miteinander verbinden; dabei geraten auch begriffliche Differenzierungen (wie die zwischen »dein Sohn« in V. 30a und »dein Bruder« in V.32b) aus dem Blick. Eine sprachorientierte Analyse muss deshalb auch die »Wiederaufnahmestruktur«[66] eines Textes erheben. Deren auffälligstes Element ist die schlichte Wiederholung; sie ist deshalb als Nächstes zu erörtern.