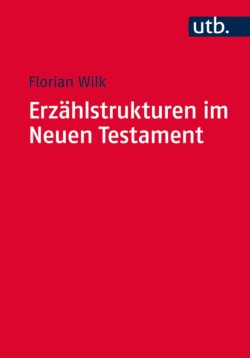Читать книгу Erzählstrukturen im Neuen Testament - Florian Wilk - Страница 16
2.5 Erzählstilorientierte Analyse
ОглавлениеJede Erzählung weist einen bestimmten Stil auf. Für die Frage nach Gliederungsmerkmalen ist dieser Erzählstil zumal in zweifacher Hinsicht relevant. Bezüglich der zeitlichen und logischen Stringenz der dargestellten Ereignisfolge ist zu erheben, ob und ggf. wo der Text Abschweifungen, Prolepsen, Nachträge, Lücken, Brüche o.Ä. enthält. Im Blick auf seine formale Kohärenz muss geklärt werden, ob und ggf. wo ein Wechsel der Textsorte, der Erzählperspektive oder der Darstellungsintensität erfolgt. An Lk 15,11b–32 lassen sich der Nutzen und die Grenzen solcher Betrachtungsweise gut erkennen.
Was die formale Kohärenz betrifft, so ist die Erzählung generell durch eine »auktoriale Fokalisierung«[101] geprägt. Freilich begnügt der Erzähler sich überwiegend damit, den Geschehensverlauf zu beschreiben. Nur je einmal bewertet er einen Vorgang und gewährt Einblick in die Gedanken eines Protagonisten: In Lk 15,13fin. redet er von der »heillosen« Lebensweise, mit der der jüngere Sohn sein Gut »vergeudet« habe, in 15,17–19 gibt er dessen Selbstgespräch wieder. Alle weiteren Kommentare erfolgen seitens der Erzählfiguren; die aber bewerten häufig – und zwar durchweg den Werdegang jenes Sohnes.
In Lk 15,30a wird die Wertung aus V. 13fin. seitens des älteren Sohnes expliziert: Der Jüngere habe das väterliche »Eigentum mit Huren aufgezehrt«. Zuvor interpretiert dieser selbst |35|seine »heillose« Lebensweise als »Sünde« (V. 18c.21c), die zum Verlust der Sohneswürde (V. 19a.21d), ja, wie der Vater formuliert, in Tod und Verderben (V. 24a–b.32b–c) geführt habe. Die Heimkehr ins Vaterhaus hingegen deutet der Bursche als »Gesundung«[102], der Vater als Rückkehr ins Leben (V. 24a–b.32b–c) und deshalb als Anlass zur Freude (V. 32a).
Immerhin zweimal werden Gefühle von Handlungsträgern benannt: in V. 20b das »Mitleid« des Vaters mit dem »verlorenen« Sohn, in V. 28a der Zorn des älteren Sohnes angesichts des Festes für jenen Tunichtgut.[103] Doch auch dies bleibt etwas Besonderes und dient jeweils dazu, zu begründen, wie sich Vater und Bruder jenem Sohn gegenüber verhalten.
Die Erzählperspektive bleibt durchgehend die des Berichterstatters. Freilich fokussiert dieser immer abwechselnd den Vater in seiner Hinwendung zu den Söhnen (Lk 15,11b–12.20b–24.28b–32)[104] und einen Sohn in der Begegnung mit anderen Erzählfiguren (15,13–20a.25–28a).
Die Darstellungsintensität schwankt stark. Nach der einleitenden Angabe zur Figurenkonstellation (Lk 15,11b), die auf jede weitere Charakterisierung verzichtet, wird kurz von der Bitte des jüngeren Sohnes um Auszahlung seines Erbteils und der Teilung des Erbes durch den Vater erzählt (V. 12). Es folgen ein Zeitsprung (»nach wenigen Tagen«), die zusammenfassende Darstellung von Vorbereitung[105], Vollzug und Ziel des Auszugs sowie eine summarische Aussage über die Lebensweise des Sohnes in der Fremde (V. 13). Ursache und Anlass seines Eintritts in eine Mangelsituation werden ebenfalls knapp zusammenfassend benannt (V. 14). Die Aussage »er begann zu darben« (V. 14b) bildet dann jedoch den Horizont für eine konkrete Schilderung seines Elends (15,15f.) und die ausführliche Wiedergabe einer gedanklichen Reflexion darüber (15,17–19), die den Hinweis auf den Aufbruch zum Vater nach sich zieht (V. 20a). Nach einem erneuten, im Wortlaut nur angedeuteten Zeitsprung (»noch«) beschreibt der Erzähler ausführlich, wie der Vater den Heimkehrer empfing (V. 20b),[106] um dann zu zitieren, was der Sohn vor dem Vater bekannte (V. 21) und wozu dieser daraufhin die Diener anhielt (15,22–24b). Die Erfüllung des Auftrags wird weitgehend ausgespart; V. 24c notiert lediglich den Beginn des Festes. Die V. 14b entsprechende Formulierung »sie begannen zu feiern« markiert aber zugleich den Horizont für den Rest der Erzählung.[107] Dieser setzt mit einer Zustandsbeschreibung ein |36|(V. 25a) und schildert dann konkret, wie der ältere Sohn nach Hause kam und auf das laufende Fest reagierte (15,25b–28a).[108] Dabei mündet die Schilderung freilich in eine zusammenfassende Kennzeichnung seiner ablehnenden Haltung (V. 28a), gefolgt von einer zusammenfassenden Darstellung des väterlichen Bemühens, ihn von dieser Haltung abzubringen (V. 28b). Am Ende steht ein ausführlich zitierter Wortwechsel zwischen Sohn (15,29f.) und Vater (15,31f.).
Die Schwankungen der Darstellungsintensität sind nun öfters mit mangelnder zeitlicher oder logischer Stringenz der Erzählung verknüpft. So lassen sich Lk 15,15–19 und 15,26f. als Abschweifungen werten; beide Abschnitte unterbrechen den Handlungsablauf, freilich so, dass das jeweils Mitgeteilte die Fortsetzung des Geschehens in V. 20a (nach V. 14) und V. 28a (nach V. 25) plausibilisiert. Zugleich bildet 15,18f. eine ausgedehnte Prolepse: Hier antizipiert der jüngere Sohn seinen Aufbruch zum Vater (s. V. 20a) und das Bekenntnis, das er ihm vorträgt (s. V. 21); der vorgesehene Schlusssatz (V. 19b) fällt in der Umsetzung jedoch aus.[109] Demgegenüber erfolgt in V. 25a eine Rückblende: Zum Zeitpunkt der Ankunft seines Bruders war der ältere Sohn auf dem Feld. Rückblicke, die zeitlich auf die Einleitung (V. 11b) zurück – und damit über den Zeitrahmen der eigentlichen Geschichte (15,13–32) hinaus – führen, finden sich dann in den Schlussvoten des älteren Sohns und des Vaters (V. 29b–c.31c–d); sie tragen auch in der Sache Informationen nach.
Logische Unebenheiten begegnen zumal in der zweiten Texthälfte. Schon dass der Vater den jüngeren Sohn laut Lk 15,20b »von ferne kommen« sah, »als hätte er immer auf ihn gewartet«[110], sprengt den Rahmen des Erwartbaren. Ein wirklicher Bruch liegt zwischen V. 21 und V. 22 vor: Statt dem Heimkehrer auf sein Bekenntnis zu antworten, wendete sich der Vater sogleich an seine Diener; dabei wird überdies ihre Präsenz beim Vater oder dessen Rückkehr zum Haus vorausgesetzt. Auch der Übergang von V. 24 zu V. 25 erscheint unlogisch: Dass der Vater das Fest für den jüngeren Sohn beginnen ließ, ohne den älteren dazuzuholen, sodass dieser bei der Rückkehr vom Feld erst einen Burschen befragen musste, wieso im Haus gefeiert werde (15,25f.), ist kaum nachvollziehbar. Holperig wirkt ferner der Anschluss von V. 28b an V. 28a, da offen bleibt, wie der Vater erfuhr, dass der ältere Sohn »nicht hineingehen wollte«. All diese Unebenheiten[111] erweisen den Text als Gleichnis: als fiktionale, von der Wirklichkeit Gottes her entworfene Erzählung. Sie haben aber darüber hinaus als Brüche im Geschehensverlauf auch Bedeutung für die Struktur des Textes.
Die Gliederung, die sich aus den notierten Beobachtungen ergibt, lässt sich wie folgt in einer Übersicht darstellen:[112]
|37|
Eine erzählstilorientierte Analyse ermöglicht es also, eine Erzählung in Szenen zu gliedern, dabei die narrativen Verbindungen zwischen ihnen darzustellen und zu erheben, welche Elemente und Passagen der Erzähler mit besonderen Akzenten versehen hat. Eine Unschärfe des Verfahrens erwächst jedoch aus dem Sachverhalt, dass gleichartige Phänomene unterschiedlich verwendet und auf verschiedenen Ebenen der Erzählung angesiedelt sein können.
Unterschiedlich verwendet sind innerhalb von Lk 15,11b–32 z.B. die beiden Einblicke in die Gefühle von Vater (V. 20b) und älterem Sohn (V. 28a): Der erste steht am Beginn, der zweite am Ende einer Szene. Auf verschiedenen Ebenen der Erzählung liegen etwa die Zeitsprünge zwischen V. 12 und V. 13, zwischen V. 20a und V. 20b sowie vor und nach V. 24c, ferner die jeweils das folgende Geschehen vorbereitenden Aussagen in V. 14b und V. 24c.
Infolge dieser Unschärfe erlaubt es eine am Erzählstil orientierte Untersuchung nicht, die identifizierten Szenen und die darin enthaltenen Passagen der Erzählung in eine hierarchische Ordnung zu bringen. Solch eine Analyse ist deshalb ihrerseits darauf angewiesen, durch Beobachtungen zu Thema, Inventar und Sprache des Textes präzisiert zu werden.