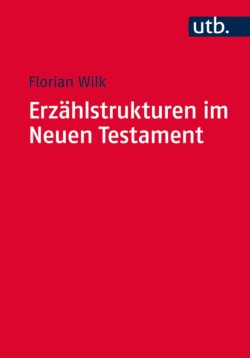Читать книгу Erzählstrukturen im Neuen Testament - Florian Wilk - Страница 9
2.3 Inventarorientierte Analyse
Оглавление»Jede Erzählung entwirft eine eigene kleine Welt mit Personen, Geschehnissen, Orten usw.«[49] Die Struktur der Erzählung hängt deshalb eng mit den Entwicklungen zusammen, die sich in der entworfenen Welt vollziehen. Sollen diese Entwicklungen aber jene Struktur zu erschließen helfen, müssen sie für Lese|14|rinnen und Leser an der Textoberfläche erkennbar, dort also markiert sein. Es müssen, mit anderen Worten, Gliederungsmerkmale vorliegen, die es erlauben, unter formalen Gesichtspunkten kleinere Sinneinheiten innerhalb der Erzählung voneinander abzugrenzen und einander so zuzuordnen, dass ihre Abfolge die dargestellten Entwicklungen nachvollziehbar macht.
Elisabeth Gülich und Wolfgang Raible haben dargelegt, wie solche textinternen »Gliederungsmerkmale« identifiziert und priorisiert werden können:
»Handlungsabläufe [sc. Geschehensabläufe, die belebte Handlungsträger haben] finden in Raum-Zeit-Kontinua statt und lassen sich nach Veränderungen in der Dimension der Zeit, in den Dimensionen des Raumes und nach Veränderungen in der Konstellation der Handlungsträger gliedern. Das heißt, Handlungsabläufe können (1) zu verschiedener Zeit an verschiedenen Orten, (2) zu verschiedener Zeit an gleichen Orten – in beiden Fällen also nacheinander – oder (3) zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten stattfinden.
Jede der drei Möglichkeiten ist ihrerseits kombinierbar mit dem Merkmal ›Veränderung in der Konstellation der Handlungsträger‹. Die Relevanz der genannten drei Parameter der Zeit, des Ortes und der Personenkonstellation erweist sich sehr deutlich darin, daß Dramen, also schriftlich fixierte Handlungsabläufe, nach genau diesen Kriterien in Akte und Szenen gegliedert werden. Die lokalen Parameter eines dargestellten Handlungsablaufs scheinen allerdings weniger wichtig zu sein, als die zeitlichen. Dies ist eine Folge davon, daß sich bei Geschehens- oder Handlungsabläufen mit Notwendigkeit die Zeit verändert, der Ort jedoch gleichbleiben kann. … Berücksichtigt man nun, daß eine Veränderung der Zeit in Geschehens- und Handlungsabläufen auch von einer Veränderung in der Konstellation der Handlungsträger unabhängig ist, so ergibt sich, daß solche Merkmale, welche die Zeitbefindlichkeit – eventuell in der Ko-Okkurrenz mit denjenigen der Ortsbefindlichkeit – anzeigen, in der Hierarchie der Gliederungsmerkmale über den Merkmalen stehen, die eine Veränderung der Personenkonstellation anzeigen.«[50]
Daraus ergibt sich ein klares Verfahren: Um eine Erzählung zu strukturieren, sind nacheinander Signale zur Zeitbefindlichkeit, Signale zur Ortsbefindlichkeit und Veränderungen in der Personenkonstellation zu identifizieren. Da auf diese Weise das Inventar der erzählten Welt hinsichtlich der dargestellten Entwicklung in seinen wesentlichen Bestandteilen erfasst wird, leuchtet dieses Verfahren auf den ersten Blick ein. Es führt allerdings nicht in jeder Hinsicht zu eindeutigen Ergebnissen. Seine Plausibilität tritt bei der Anwendung auf Lk 15,11b–32 ebenso zutage, wie es seine Desiderata tun.
Achtet man zunächst auf den Parameter der Zeit, so entdeckt man eine einzige explizite Zeitangabe: Lk 15,13 zufolge zog der jüngere Sohnes schon »wenige Tage nach« der in V. 12d erwähnten Erbteilung seitens des Vaters von Zuhause fort. Daneben finden sich allerdings zwei weitere ausdrückliche Hinweise auf eine Zeitverschiebung. Der erste erfolgt in 15,24f., insofern hier die Aussage »sie begannen zu feiern« (V. 24c) einen länger andauernden Vorgang anzeigt, in dessen Verlauf der ältere Sohn eintrat, »als er« – seinen Aufenthalt »auf dem Feld« (V. 25a) beendend – »(heim)kam und sich dem Haus näherte« (V. 25b). Der zweite wird in 15,29–31 gegeben, indem dort »so vielen Jahren«, in denen der ältere Sohn dem Vater gedient habe (V. 29b),[51] der Zeitpunkt gegenübergestellt wird, »als« der jüngere Sohn wieder nach Hause »kam« (V. 30a). Freilich steht dieser zweite |15|Hinweis in einer direkten Rede, die die vorhergehenden Ereignisse kommentiert; markiert wird also rückblickend das in V. 20b einsetzende Geschehen.
Verstrichene Zeit zeigen zudem die griechischen Partizipialwendungen in Lk 15,14init. (»nachdem er alles ausgegeben hatte«) und V. 20b (»als er noch weit entfernt war«) an; da dies aber jeweils nur implizit geschieht, sind jene Wendungen an sich allenfalls in untergeordnetem Sinne als Gliederungsmerkmale zu werten.
Ortswechsel werden explizit in Lk 15,13 (»der jüngere Sohn zog fort in ein fernes Land«) und V. 25 (der »ältere Sohn«, der zunächst »auf dem Feld war«, »näherte sich dem Haus«) markiert. Dabei ist von »jenem Land« in 15,13–15 fortlaufend die Rede; dass einer seiner Bürger den jüngeren Sohn in dessen Not zum Schweinehüten »auf seine Felder« schickte (V. 15b), wo ihn dennoch hungerte (V. 17c: »hier«), hat daher als Ortsangabe nur untergeordnete Bedeutung. Andererseits weisen die Verben »herausholen« in V. 22b sowie »hineingehen« und »herauskommen« in V. 28 auf das in V. 25b genannte Haus voraus bzw. zurück, so dass die zugehörigen Szenen mit ihm verknüpft werden.[52] Umso mehr fällt auf, dass der in V. 20a (»er machte sich auf und ging …«) angekündigte Ortswechsel nur implizit – mit der personal gefassten Richtungsangabe »zu seinem Vater« – angezeigt wird; die Notiz in V. 20b: »als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater«, bezieht sich dann ja nur auf einen Bruchteil der tatsächlich vom Sohn überbrückten Distanz und lokalisiert die folgende Begegnung jedenfalls in der Nähe des väterlichen Hauses.
Was endlich die Veränderungen in der Konstellation der Handlungsträger angeht, ergibt sich folgendes Bild: In Lk 15,11b–12 sind der Vater und beide Söhne präsent – auch wenn nur der jüngere spricht und der Vater daraufhin handelt.[53] Ab V. 13 konzentriert sich der Erzähler auf den jüngeren Sohn. Ihm werden zwar in 15,15f. »einer der Bürger jenes Landes« und – mit dem Wort »niemand« – eine Gruppe weiterer, namenloser Personen zur Seite gestellt; beide unterstreichen mit ihrem jeweiligen Verhalten aber nur das Ausmaß des Elends, in dem der Sohn leben muss. Mit dem Selbstgespräch in 15,17–19 tritt er gedanklich wieder in Kontakt zu seinem Vater, wobei er sich mit dessen Tagelöhnern vergleicht (V. 17b.19b). V. 20a notiert daraufhin den faktischen Aufbruch »zu seinem eigenen Vater«. Ab V. 20b wird seine Begegnung mit dem Vater geschildert. Als der das Wort ergreift (V. 22a), spricht er jedoch nicht den Sohn, sondern »seine Diener« an: Sie sollen den Sohn neu einkleiden und ein Fest vorbereiten; und an dessen Durchführung sind sie – der Aufforderung V. 23c: »Lasst uns essen und feiern!«, gemäß – selbst beteiligt (V. 24c: »Und sie begannen zu feiern.«). Ab V. 25 tritt dann der ältere Sohn in Erscheinung und führt zwei Gespräche: Das erste mit »einem der Burschen« (15,26f.) eröffnet er selbst, das zweite mit »seinem Vater« wird von diesem initiiert (15,28b–32).[54] Der jüngere Sohn kommt jetzt nur noch – jeweils im Verein mit dem Vater – als Gesprächsgegenstand in den Blick |16|(V. 27.30.32); und dabei bringt ihn der Ältere einmal mit »Huren« in Verbindung, um ihn so sich selbst und seinen »Freunden« gegenüberzustellen (15,29c–30a).
In der hierarchisch geordneten Zusammenschau aller genannten Gliederungsmerkmale lässt sich Lk 15,11b–32 wie folgt strukturieren:
Die Erzählung setzt also mit einer knappen Einleitung (Lk 15,11b–12) ein, die die grundlegenden Voraussetzungen (Personenkonstellation und Ausgangslage) der folgenden Geschichte benennt. Diese (15,13–32) umfasst zwei Hauptteile, die nacheinander den Lebensweg des jüngeren Sohnes bis zu seiner feierlichen Aufnahme durch den Vater (15,13–24) und deren Ablehnung seitens des älteren Sohnes samt der väterlichen Reaktion darauf (15,25–32) behandeln.[55] Beide Hauptteile bestehen aus je zwei Abschnitten, die jeweils durch Notizen zur Hinwendung des Vaters zu dem im Blickpunkt stehenden, auf je andere Weise heimkehrenden Sohn (V. 20b.28b) miteinander verknüpft sind. Die Abschnitte lassen sich ihrerseits noch einmal feiner untergliedern, sodass der wechselvolle Verlauf der Geschichte bis ins Detail erkennbar wird.
Die Anwendung auf Lk 15,11b–32 macht die Vorzüge einer inventarorientierten Analyse sichtbar: Mit dieser kann man anhand klarer Textmerkmale die Schnittstellen einer Erzählung identifizieren sowie im Verhältnis zueinander gewichten und daraufhin eine hierarchisch geordnete Gliederung erstellen. Das |17|Verfahren eröffnet somit einen Zugang zur Struktur einer Erzählung und erlaubt es, darin Haupt- und Nebenstränge zu unterscheiden.
Es hat freilich auch Mängel. Erstens setzt es eine bestimmte Hierarchie der Gliederungsmerkmale – 1. Angaben zum Zeitverlauf, 2. Angaben zum Ortswechsel, 3. Angaben zur Veränderung der Personenkonstellation – als allgemein gültig voraus. Es ist jedoch zweifelhaft, ob diese Voraussetzung zutrifft.
Im vorliegenden Fall ergibt sich z.B. die Wertung des Neueinsatzes in Lk 15,25 als Eröffnung des zweiten Hauptteils primär aus dem erstmaligen Auftreten des älteren Sohnes – nachdem die Geschichte in 15,13–24 auf den jüngeren Sohn fokussiert war. An dieser Wertung würde sich nichts ändern, wenn am Übergang von V. 24 zu V. 25 kein Hinweis auf eine Zeitverschiebung erfolgte und etwa (statt des in 15,24c–28a Geschilderten) erzählt würde, dass der ältere Sohn unmittelbar auf den Auftrag des Vaters an die Diener reagiert und wutentbrannt den Hof verlassen hätte. Umgekehrt würde die Einfügung einer expliziten Zeitangabe am Beginn von V. 16 kaum zu einer Ausgliederung des Verses aus dem Zusammenhang 15,14–16 führen; entscheidend bleibt dessen Kohärenz in Hinsicht auf Personen und Raum.[56]
Näher liegt es, die Hierarchie der genannten Gliederungsmerkmale von der Eigenart eines Textes her je neu zu bestimmen. Das Verfahren bedarf also der Ergänzung durch eine thematische Analyse, die jene Eigenart erschließt.
In der obigen Gliederungsübersicht habe ich an einer Stelle eine entsprechende Umgewichtung bereits vorgenommen: Da Lk 15,11b–32 eine »Beziehungsgeschichte« darstellt, führt die wiederholte Erwähnung des Vaters als der Person, an die sich der jüngere Sohn in seinem Selbstgespräch (15,17–19) erinnerte und zu der hin er aufbrach (V. 20a), zur Einschätzung von 15,17–20a als eines Passus, der auf derselben Gliederungsebene liegt wie 15,13–16.
Zweitens kann man bei einer inventarorientierten Analyse Angaben von untergeordneter Bedeutung[57] kaum als solche erkennen und gewichten. Dazu müsste die konkrete sprachliche Gestaltung des Textes mit bedacht werden.
Daher sind nun Analyseverfahren vorzustellen, die genau dies gestatten.