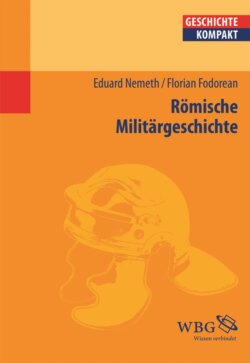Читать книгу Römische Militärgeschichte - Florin Fodorean - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Die Reform des Servius Tullius
ОглавлениеDie Zensusklassen und das Heer
Servius Tullius, der sechste römische König, herrschte – der Überlieferung zufolge – von 578 bis 534 v. Chr. Ihm wird eine Reform des römischen Stadtstaates zugeschrieben, die auch im militärischen Bereich deutliche Spuren hinterließ. Die römischen Bürger, sowohl die Patrizier (Adligen) als auch die Plebejer (angeblich später dazugekommene, gewöhnliche Bürger) wurden gemäß ihrem Vermögen in sechs Zensus-Klassen eingeteilt. Hauptziel dieser Struktur war es, eine Basis zur Besteuerung der Römer zu schaffen. Die Einteilung war jedoch auch für die Rolle und den Platz jedes Römers in der Armee ausschlaggebend. Der König habe, so die Quellen, die drei ursprünglichen Stämme Roms durch vier territoriale Stämme ersetzt. Zugleich habe er den außerhalb der Stadt lebenden römischen Bürgern weitere Stämme zugewiesen, deren Anzahl bei den antiken Autoren zwischen 26 und 31 schwankt. Die territorialen Stämme bestanden aus Zenturien („Hundertschaften“). Diese Zenturien waren auf Grundlage des Vermögens jedes Bürgers aufgestellt und gehörten demnach sechs Vermögensklassen an. Die ersten fünf Klassen umfassten diejenigen Römer, die überhaupt etwas zu versteuern hatten, während der sechsten Klasse diejenigen Bürger angehörten, deren Eigentum als zu klein angesehen wurde, um besteuert zu werden, und die im Prinzip keinen Wehrdienst leisteten (diese unterste Vermögensgrenze lag bei 11.000 As nach dem Historiker Livius oder bei 12.500 As nach Dionysios von Halikarnassos). Jeder Klasse wurde eine gewisse Anzahl von Zenturien zugewiesen. So bestand die erste Klasse aus 80 Zenturien, denen 18 Zenturien von Rittern zugefügt wurden. Jede der Klassen II bis IV bestand aus je 20 Zenturien, während die fünfte Klasse in 30 Zenturien eingeteilt wurde. Außerdem gab es noch vier Zenturien von Handwerkern und Musikern. Die armen Bürger, die keiner der fünf anderen Klassen angehörten, wurden in einer einzigen Zenturie gruppiert.
Eine Versammlung des römischen Volkes (populus Romanus) gemäß dieser Struktur bezeichnete man als comitia centuriata (Zenturienversammlung). Neben den eher politischen Funktionen, die sie innehatte, wie die Wahl der oberen Magistrate mit Kommandogewalt (Konsuln und Prätoren) während der Republikzeit, war die Zenturienversammlung eine ausgeprägt militärische Institution des jungen Staates. Die Bürger hatten für ihre Waffen und Ausrüstung selbst aufzukommen, so dass sich diese je nach Steuerklasse wesentlich unterschieden.
Die Römer kämpften als Fußsoldaten, die 18 Ritterzenturien ausgenommen. Die Bürger der ersten Klasse waren als schwere Infanteristen ausgerüstet, was bedeutete, dass sie im Kampf von einem Helm, einem runden Schild, einem Brustpanzer und Beinschienen, alles aus Bronze, geschützt waren. Als offensive Waffen hatten sie den Speer, das Schwert (gladius) und den Dolch. Diese Ausrüstung war derjenigen des griechischen Fußsoldaten, des Hopliten, sehr ähnlich. Die Angehörigen der II. und der III. Klasse besaßen weniger Ausrüstung, ihnen fehlten also manche Ausrüstungsstücke, aber die Kampfart als Infanteristen blieb dieselbe. Die Angehörigen der IV. Klasse waren nur mit Speeren und Wurfspeeren (pilum) bewaffnet, während die Bürger der V. Klasse mit Schleudern kämpften. Sie bildeten die leicht bewaffnete Infanterie oder die velites. Die Zenturien der Musiker und der Handwerker hatten ihre spezifischen Aufgaben, waren jedoch nicht bewaffnet. Die Römer der VI. Klasse waren zu arm, um ihre Ausrüstung besorgen zu können, und waren daher vom Wehrdienst ausgenommen. Sie wurden capite censi, „die nach dem Kopf Gezählten“, genannt, da sie kein nennenswertes Vermögen besaßen. Die Männer, die jünger als 45 Jahre waren, wurden iuniores genannt und kämpften auf dem Schlachtfeld, während den seniores, die über dieser Altersgrenze lagen, die Verteidigung der Stadt zukam.
E
Hoplit
Der Hoplit (griech. hoplítes von hóplon, „Kriegsgerät“, „schwere Waffe“, „schwere Rüstung“, daher der Soldat als „Schwerbewaffneter“) war der typische Infanterist in den griechischen Armeen in der archaischen und klassischen Epochen. Die typische Kampfformation der Hopliten war die Phalanx. Die wichtigste Schutzwaffe der Hopliten war der große, runde Schild (altgriech. aspís), welcher den ganzen Oberkörper decken konnte. Er bestand aus Holz, war üblicherweise ursprünglich mit einem Bronzerahmen gefasst, später mit Bronzeblech bedeckt und hatte einen Durchmesser von ca. 1 m. Die Angriffswaffen waren eine Stoßlanze mit Stahlspitze und ein Schwert für den Fall, dass die Lanze im Kampf brach. Die Lanze maß im 5. Jahrhundert etwa 2 m, in hellenistischer Zeit, als sie „sarissa“ hieß, sogar bis zu 6 m. Hinzu kamen ein Helm (manchmal mit einem Kammbusch geschmückt), Beinschienen aus Bronze sowie ein Brustpanzer. Der Letztere war ursprünglich ein Leinenpanzer, der später durch einen wirksameren Messingpanzer ersetzt wurde. Reichere Krieger hatten Ober- und Unterarmschienen sowie Knöchel-, Oberschenkel- und Fußschutz. Die frühen römischen Fußsoldaten waren nach dem Hoplitenmodell ausgerüstet und kämpften in einer der Phalanx sehr ähnlichen Schlachtordnung.
E
pilum
Das Pilum (Plural: Pila) war ein Wurfspieß und die übliche Fernwaffe des römischen Legionärs. Die Römer hatten es wahrscheinlich von den Samniten übernommen, möglicherweise während der Samnitenkriege. Diese Übernahme war ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von der Phalanx zur Manipulartaktik. Das Pilum war eine Weiterentwicklung der längeren und schwereren Wurflanze und bestand aus zwei Hauptteilen, nämlich aus einem ca. 1 m langen Holzschaft und einer ungefähr gleich langen Eisenstange, die im Schnitt viereckigoder rund geschmiedet war. An ihrem sich verjüngenden Ende wies sie eine vierkantige Spitze auf. Die in Reihen stehenden Legionäre warfen ihre Pila gleichzeitig aus einer Entfernung von ungefähr 10 bis 20 Schritt (ca. 8 bis 16 m). So wurden wahrscheinlich zumindest einige Feinde bereits vor dem eigentlichen Gefecht verwundet oder getötet, da die kinetische Energie des geworfenen Pilums auf eine kleine Spitze gebündelt war. Es konnte so manchmal auch Panzer und Schilde durchschlagen. Sehr oft wurde aber der gegnerische Krieger wenig oder gar nicht verletzt. Das Pilum verbog sich jedoch in den Schild, da ein Teil des Eisenschaftes, im Gegensatz zur eigentlichen Spitze, absichtlich ungehärtet belassen war. Kurz vor einem Angriff konnte man diese verbogenen Eisenstangen nicht mehr schnell genug entfernen, so dass der betroffene Krieger sich gezwungen sah, seinen Schild fallen zu lassen und ohne dieses wesentliche Schutzelement den Kampf fortzusetzen. Wie Cäsar (Gallischer Krieg, I, 25) berichtet, galt dies insbesondere, wenn Schilde überlappend geführt und von Pila aneinandergeheftet wurden. Durch das Verbiegen des Eisenschaftes wurde außerdem auch verhindert, dass die Pila, die ihr Ziel verfehlten oder die im feindlichen Schild steckengeblieben waren, gegen die Römer selbst wiederverwendet werden konnten.
E
gladius
Der Gladius (lat. „Schwert“, Plural Gladii) war das römische Kurzschwert. Er soll ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. aus einem Schwerttyp der Keltiberer aus Hispanien entwickelt worden sein und einige seiner Versionen waren bis in das 2. Jahrhundert n.Chr. die Standardwaffe der Fußsoldaten aus der römischen Armee. Die Stahlklinge eines Gladius war etwa 50–60 cm lang, ca. 8 cm breit und beidseitig geschliffen, so dass sich zwei Schneiden ergaben. Alle Variationen wurden auf ähnlicher Weise benutzt. Der Gladius wurde von den Soldaten auf der rechten Seite getragen. Dies erforderte mehr Übung beim Ziehen des Schwertes, hingegen bestand keine Gefahr, dass der schwere Schild, den sie trugen, diese Bewegung verhinderte. Centurionen trugen manchmal den Gladius auf der linken Seite. Der Griff war zwar mit einem Schutzteil versehen, doch sollte dieser nicht wie eine Parierstange wirken, wie z.B. bei den mittelalterlichen Schwertern und Säbeln, sondern nur verhindern, dass die Schwerthand auf die Klinge gelangte, wenn mit dem Gladius ein kräftiger Stich ausgeführt wurde. Die Scheide bestand aus Holz, war mit Leder bezogen und mit Metallbeschlägen aus Messing, Bronze oder Silber verziert. Der Gladius war die bestgeeignete Waffe für den Nahkampf in dichten Infanterieformationen, wie die Römer sie aufstellten. Im dichten Kampfengagement der Infanterie war die relativ geringe Länge dieses Schwertes ein Vorteil und verlieh dem Legionär eine gewisse Überlegenheit. Er konnte auch im dichtesten Kampf seine Waffe immer noch verwenden, vor allem indem er damit stach, ohne den Schild fallen lassen zu müssen. Der zweischneidige Gladius war sowohl zum Hieb als auch zum Stich tauglich. Diese Kampfweise erwies sich als entscheidend für die Überlegenheit der römischen Legionen in großen kollektiven Gefechten. Natürlich war das kurze Schwert im Einzelnahkampf nützlich, außerhalb der geschlossenen Formation aber weniger. Das war mit Sicherheit ein Grund dafür, warum beginnend mit dem Ende des 2. Jhs. ein längeres Schwert namens spatha (die bereits die typische Angriffswaffe der römischen Kavallerie war) immer mehr auch von den Infanteristen benutzt wurde, bis sie schließlich während des 3. und 4. Jahrhunderts den Gladius völlig ersetzte.
Gladius und lorica hamata-Kettenhemd
Wenn man die aktiven Soldaten aus allen wehrpflichtigen Zenturien zusammenzählt, kommt man auf 60 Zenturien von schwer und 24 Zenturien von leicht bewaffneter Infanterie (velites). Die Ritter, die auch für ihre Pferde aufkommen mussten, bildeten die Kavallerie, die aber in der frühen römischen Kampftaktik anscheinend keine wesentliche Rolle spielte, da die Römer am Anfang den auf die Infanterie gestützten Kampfstil der Griechen, die Hoplitentaktik, übernommen haben. Somit hätte die römische Armee am Ende der Königszeit und am Anfang der republikanischen Ära die folgende Struktur und Stärke gehabt: 6000 schwer bewaffnete Infanteristen, 2400 leicht bewaffnete Fußsoldaten und 600 Reiter, insgesamt 9000 Mann.
Ob die oben dargestellte Reform tatsächlich von König Servius Tullius durchgeführt wurde, ist ungewiss. Viele moderne Historiker gehen davon aus, dass diese Strukturen eigentlich erst später, während der Republikzeit, vielleicht im 4. oder 3. Jahrhundert v. Chr., vervollständigt wurden.
Manche heutige Historiker glauben, dass es sogar eine ältere Einteilung der römischen Bürger mit Bezug auf ihre Teilnahme an der Armee gab. Bei Aulus Gellius (2 Jahrhundert n.Chr.) und Rufius Festus (4. Jahrhundert n.Chr.) wird eine frühe Einteilung der Bürger aufgrund des Einkommens in classis clipeata und infra classem angedeutet. Die classis clipeata wären die Bürger der ersten Zensusklasse gewesen, die einen clipeus trugen, der dem runden Schild der Hopliten ähnelte, und hätten als einzige über die ganze Ausrüstung des schweren Infanteristen verfügt. Diese Bürger wären ursprünglich in 40 oder 60 Zenturien gruppiert und wären am Anfang die einzigen schwerbewaffneten Fußsoldaten Roms gewesen. Sie hätten die ursprüngliche einzige römische Legion gebildet. Die Bürger infra classem hätten in der Armee folglich nur als leichtbewaffnete Infanteristen dienen können. Diese Situation wird ins 6. Jahrhundert v. Chr. datiert; sie stelle die eigentliche servianische Reform dar. In der Sicht dieser Autoren wäre die von Livius und Dionysios von Halikarnassos beschriebene Lage eines 5-Klassen-Systems eine spätere Entwicklung des eingangs dualen Systems classis bzw. infra classem. Diese Entwicklung hätte schon während der frühen Republikzeit, gegen Ende des 5. Jahrhundert stattgefunden, als die Römer die Phalanx-Formation zugunsten der Manipularaufstellung der Armee (s. weiter unten) aufgegeben hätten und das römische Heer fast alle kampffähige Bürger außer den Proletariern umfasste.