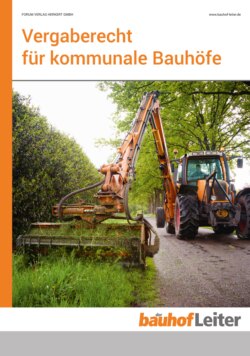Читать книгу Vergaberecht für kommunale Bauhöfe - Forum Verlag Herkert GmbH - Страница 10
ОглавлениеVorbereitung der Ausschreibung
Markterkundung
Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens darf der Auftraggeber Markterkundungen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über seine Auftragsvergabepläne und -anforderungen durchführen.
In vielen Fällen ist eine vorherige Markterkundung auch sinnvoll, um eine fundierte Leistungsbeschreibung auf einer realistischen Kalkulationsgrundlage erstellen zu können.
Zur Markterkundung kann der öffentliche Auftraggeber beispielsweise den Rat von unabhängigen Sachverständigen oder Behörden oder von anderen Marktteilnehmern einholen oder annehmen. Der Rat darf dabei allerdings nicht wettbewerbsverzerrend sein und nicht zu einem Verstoß gegen die Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Transparenz führen.
Die Durchführung eines Vergabeverfahrens zur reinen Markterkundung oder zum Zwecke einer Kosten- oder Preisermittlung, d. h. zu vergabefremden Zwecken, ist jedoch unzulässig.
Vergabereife
Vor der Ausschreibung jedes Vergabeverfahrens ist vom öffentlichen Auftraggeber weiterhin die sog. Vergabereife herzustellen Das bedeutet, dass grundsätzlich eine erschöpfende und eindeutige Leistungsbeschreibung vorhanden sein muss und die sonstigen rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen für einen Beginn des Vergabeverfahrens gegeben sein müssen.
Ein öffentlicher Auftraggeber hat somit dafür Sorge zu tragen, dass ein Auftrag zu Beginn eines Vergabeverfahrens ausschreibungsreif ist, weil er mit Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung stets an den Inhalt des Auftrags gebunden und eine Aufhebung des Vergabeverfahrens nur unter engen Voraussetzungen zulässig ist.
Der Auftraggeber soll daher erst dann ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen fertiggestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden kann.
Eine weitere Grundvoraussetzung für eine Ausschreibung ist ebenfalls, dass die Finanzierung des Vorhabens gewährleistet ist und sämtliche Genehmigungen vorliegen, die für den Beginn der Arbeiten erforderlich sind.
Schätzung des Auftragswerts (§ 3 VgV)
Der Auftragswert eines Auftrags ist zunächst bei einer Ausschreibung i. V. m. den gültigen EU-Schwellenwerten zu sehen.
Die Höhe des Auftragswerts bzw. Auftragsvolumens entscheidet darüber, ob ein nationales oder europaweites Vergabeverfahren durchzuführen ist und ob die Vergabe der Kontrolle durch die Vergabekammern und Oberlandesgerichte unterliegt.
Maßgebend ist, ob der vorab geschätzte Auftrags- oder Vertragswert ohne Umsatzsteuer die jeweils festgelegten Schwellenwerte erreicht oder überschreitet. Die jeweiligen Schwellenwerte ergeben sich aus § 106 Abs. 2 GWB.
Unterhalb der Schwellenwerte gelten die Regelungen nach Abschnitt 1 der VOB Teil A bzw. der UVgO (ggf. der VOL/A).
Bei Erreichen der Schwellenwerte sind EU-weite Ausschreibungen vorzunehmen und die Vorschriften im Abschnitt 2 der VOB/A oder der VgV und des GWB zu berücksichtigen.
Wenn der Auftragswert zu einer Ausschreibung zu schätzen ist, dann gelten hierfür die Regelungen im § 3 VgV – Schätzung des Auftragswerts.
Stellt sich heraus, dass sich gegenüber der Schätzung Abweichungen einstellen werden, dann ist eine Neubewertung vorzunehmen.
Der Auftragswert umfasst zunächst wertmäßig jeweils den Nettobetrag für die Leistung ohne Umsatzsteuer.
Bei der Schätzung des Auftragswerts ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung ohne Umsatzsteuer auszugehen. Zudem sind etwaige Optionen oder Vertragsverlängerungen zu berücksichtigen. Sieht der öffentliche Auftraggeber Prämien oder Zahlungen an den Bewerber oder Bieter vor, sind auch diese zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 VgV).
Ob die Schwellenwerte bei einer Vergabe erreicht werden, entscheidet zunächst einmal der öffentliche Auftraggeber selber, da er den Wert der auszuschreibenden Leistung vor Beginn der Vergabe zu schätzen hat. Allerdings darf der Wert eines beabsichtigten Auftrags nicht in der Absicht geschätzt oder aufgeteilt werden, den Auftrag der Anwendung des GWB-Vergaberechts zu entziehen (§ 3 Abs. 1 und 2 VgV) und den Wert absichtlich zu niedrig zu schätzen. Dabei hat der Auftraggeber aber nicht nur die Preise für alle Einzelleistungen sachgerecht zu schätzen, sondern er muss auch die der Preisermittlung zugrunde liegenden Massen realistisch ermitteln.
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung des Auftragswerts ist der Tag, an dem die Bekanntmachung der beabsichtigten Auftragsvergabe abgesendet oder das Vergabeverfahren auf andere Weise eingeleitet wird (§ 3 Abs. 9 VgV).
Dem Auftraggeber steht bei der Ermittlung des Auftragswerts ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, der auch von den Nachprüfungsbehörden zu akzeptieren ist. Nimmt der Auftraggeber allerdings keine ordnungsgemäße Kostenschätzung vor, so kann dies auf Antrag eines Bieters die Vergabekammer für ihn nachholen.
Schwellenwerte
Die Schwellenwerte werden in den EU-Vergaberichtlinien festgelegt und alle zwei Jahre durch die EU überprüft und im Regelfall auch angepasst, zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2020.
| Auftragsart | Schwellenwert in Euro |
| Bauaufträge | 5.350.000 |
| Konzessionen | 5.350.000 |
| Liefer- und Dienstleistungsaufträge | 214.000 |
| Liefer- und Dienstleistungsaufträge der obersten Bundesbehörden | 139.000 |
| Liefer- und Dienstleistungsaufträge von Sektorenauftraggebern | 428.000 |
| Übersicht der EU-Schwellenwerte für Vergaben |
Die Anpassung betrifft die „klassische“ Vergaberichtlinie, die Sektorenvergaberichtlinie, die Konzessionsvergaberichtlinie sowie die Richtlinie Verteidigung und Sicherheit.
Die EU-Schwellenwerte basieren auf den Schwellenwerten des General Procurement Agreement (GPA), die in einer künstlich vom IWF geschaffenen Währungseinheit, den sog. Sonderziehungsrechten (SZR), angegeben werden. Da sich deren Kurs zum Euro laufend ändert, werden die EU-Schwellenwerte alle zwei Jahre an die Sonderziehungsrechte angepasst. Eine Anpassung erfolgt abhängig von den Kursveränderungen gegenüber dem Euro.
Die angepassten Schwellenwerte gelten ab dem 01.01.2020 und sind im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
Eine Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber ist nicht mehr erforderlich, da die EU-Vorschriften durch die dynamischen Verweisungen in den Vergabeverordnungen unmittelbar gelten.
Bestimmung der Verfahrensart
Im Vergaberecht kommen unterschiedliche Verfahrensarten zur Anwendung, die sich jeweils durch
• eine ein- oder zweistufige Struktur,
• das Vorgehen zur Bestimmung des Bieterkreises und
• hinsichtlich des Ablauf des Verfahrens
unterscheiden.
Die Verfahrensarten richten sich insbesondere nach der auszuschreibenden Leistung und deren Auftragswert.
Teilnahmewettbewerb
Bei einem Vergabeverfahren mit einer zweistufigen Struktur ist ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet, durch den die Anzahl von Unternehmen, die zur Abgabe eines Angebots oder zu Verhandlungen aufgefordert werden sollen, begrenzt wird.
Eine Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb (z. B. Beschränkte Ausschreibung, nichtoffenes Verfahren, Verhandlungsverfahren) beginnt hier mit der Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung, aus der u. a. hervorgeht, welche Eignungsnachweise mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen sind und bis wann die Teilnahmeanträge abzugeben sind (Teilnahmefrist).
Die Bewerber reichen dann mit ihrem Teilnahmeantrag die geforderten Angaben und Unterlagen zum Nachweis ihrer Eignung und zum Nichtvorliegen von Ausschlusskriterien ein.
Im Teilnahmewettbewerb wählt der Auftraggeber aus dem Kreis der Bewerber diejenigen aus, die die in der Bekanntmachung genannten Eignungskriterien erfüllen und fordert diese zur Angebotsabgabe auf.
Der Auftraggeber kann weiterhin die Zahl der Teilnehmer am Wettbewerb begrenzen und gibt die Zahl der Teilnehmer in der Bekanntmachung an.
Bestimmung der Vergabeart (VOB/A) bzw. der Verfahrensart (UVgO)
In den Vergabeverfahren können folgende Vergabearten angewendet werden:
• Verfahren im Unterschwellenbereich – nationale Verfahren unterhalb der Schwellenwerte:
– Öffentliche Ausschreibung
– Beschränkte Ausschreibung mit und ohne Teilnahmewettbewerb
– freihändige Vergabe
– Direktauftrag (Baubereich)
• Verfahren im Oberschwellenbereich – EU-weite Verfahren oberhalb der Schwellenwerte:
– offenes Verfahren
– nicht offenes Verfahren
– Verhandlungsverfahren mit und ohne Teilnahmewettbewerb
– wettbewerblicher Dialog
– Innovationspartnerschaft
Nationale Vergabeverfahren
Öffentliche Ausschreibung
Bei einer Öffentlichen Ausschreibung fordert der Auftraggeber mit der Auftragsbekanntmachung eine unbeschränkte Zahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf. Jedes interessierte und geeignete Unternehmen kann ein Angebot abgeben.
Bei Ausschreibungen nach der UVgO und der VOB/A Ausgabe 2019 1. Abschnitt kann der Auftraggeber die Verfahrensarten „Öffentliche Ausschreibung“ und „Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb“ gleichberechtigt nach seiner Wahl anwenden.
Bei Ausschreibungen nach VOL/A ist die Öffentliche Ausschreibung das Regelverfahren.
Beschränkte Ausschreibung
Die Beschränkte Ausschreibung ist eine Vergabeart nach § 3 Abs. 2 VOB/A bzw. §§ 10 und 11 UVgO, bei der Leistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmern zur Einreichung von Angeboten vergeben werden. Im Gegensatz zu dem nicht offenen Verfahren oberhalb der Schwellenwerte ist bei der Beschränkten Ausschreibung ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb (öffentliche Aufforderung, Teilnahmeanträge zu stellen) fakultativ und nicht zwingender Bestandteil des Vergabeverfahrens.
Der Auftraggeber kann somit ggf. eine Beschränkte Ausschreibung mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb oder eine Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb wählen.
Bei der Beschränkten Ausschreibung mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb wird mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine unbeschränkte Zahl von Interessenten zur Abgabe eines Teilnahmeantrags aufgefordert. Nach Prüfung der Eignung werden die ausgewählten Unternehmen dann zur Abgabe eines Angebots aufgefordert.
Bei einer Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb werden nur geeignete Unternehmen direkt angesprochen und zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Diese Verfahrensart ist nach den Regeln des Vergaberechts nur unter bestimmten Voraussetzungen (Wertgrenzen) oder in begründeten Ausnahmefällen zulässig.
Voraussetzungen für eine Beschränkte Ausschreibung von Bauleistungen ohne Teilnahmewettbewerb:
• bis zu folgendem Auftragswert der Bauleistung ohne Umsatzsteuer (§ 3 a Abs. 2 VOB/A):
a) 50.000 Euro für Ausbaugewerke (ohne Energie- und Gebäudetechnik), Landschaftsbau und Straßenausstattung,
b) 150.000 Euro für Tief-, Verkehrswege- und Ingenieurbau,
c) 100.000 Euro für alle übrigen Gewerke,
• für Bauleistungen zu Wohnzwecken kann bis zum 31.12.2021 eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb für jedes Gewerk bis zu einem Auftragswert von 1.000.000 Euro ohne Umsatzsteuer erfolgen,
• wenn eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb kein annehmbares Ergebnis gehabt hat,
• wenn die Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheimhaltung) unzweckmäßig ist.
Im Liefer- und Dienstleistungsbereich ist eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb zulässig, wenn
• eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat,
• die Öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Bewerber einen Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem Wert der Leistung im Missverhältnis stehen würde.
Freihändige Vergabe oder Verhandlungsvergabe
Bei einer Freihändigen Vergabe gem. § 3 Nr. 3 VOB/A werden Bauleistungen in einem vereinfachten Verfahren vergeben.
Bei einer Verhandlungsvergabe werden Liefer- oder Dienstleistungen mit oder ohne Teilnahmewettbewerb entsprechend § 12 UVgO vergeben.
In der UVgO wird die Freihändige Vergabe als „Verhandlungsvergabe“ bezeichnet.
Eine Freihändige Vergabe (im Baubereich) oder eine Verhandlungsvergabe (im Liefer- oder Dienstleistungsbereich) ist ein Vergabeverfahren, das nur bei Aufträgen, deren Wert unterhalb der Schwellenwerte liegt und auch dort nur in Ausnahmefällen zulässig ist. Bei diesen Vergaben werden Aufträge ohne ein förmliches Verfahren vergeben. Allerdings sind auch hier die allgemeinen Grundsätze des Vergaberechts (z. B. Gleichbehandlungsgrundsatz, Wettbewerbsgrundsatz, Transparenzgebot) anzuwenden.
Eine Freihändige Vergabe von Bauleistungen ist zulässig,
• wenn die Öffentliche Ausschreibung oder beschränkte Ausschreibung unzweckmäßig ist,
• besonders, wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz, besondere Erfahrung oder Geräte) nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht kommt,
• wenn die Leistung besonders dringlich ist,
• wenn die Leistung nach Art und Umfang von der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend festgelegt werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können,
• wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten Ausschreibung eine erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht,
• wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist oder
• wenn sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht ohne Nachteil trennen lässt (§ 3a Abs. 4 VOB/A).
Die Freihändige Vergabe kann außerdem gem. § 3 a Abs. 4 Satz 2 VOB/A bis zu einem Auftragswert von 10.000 Euro ohne Umsatzsteuer erfolgen.
Für Bauleistungen zu Wohnzwecken kann bis zum 31.12.2021 eine Freihändige Vergabe bis zu einem Auftragswert von 100.000 Euro ohne Umsatzsteuer erfolgen.
Eine Verhandlungsvergabe von Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen unterhalb der Schwellenwerte ist zulässig, wenn z. B. einer der folgenden Anwendungsfälle vorliegt (siehe § 8 Abs. 4 UVgO):
• wenn der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst,
• wenn der Auftrag aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der Komplexität oder dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den damit einhergehenden Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen vergeben werden kann,
• wenn die Leistung nach Art und Umfang, insbesondere ihre technischen Anforderungen, vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können,
• wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine Wiederholung kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht,
• wenn die Bedürfnisse des Auftraggebers nicht ohne die Anpassung bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden können,
• wenn es sich um die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zur Erfüllung wissenschaftlich-technischer Fachaufgaben auf dem Gebiet von Forschung, Entwicklung und Untersuchung handelt, die nicht der Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer Dienststelle des Auftraggebers dienen,
• wenn im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge in angemessenem Umfang und für angemessene Zeit an Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt waren, vergeben werden müssen,
• wenn eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb für den Auftraggeber oder die Bewerber oder Bieter einen Aufwand verursachen würde, der zum erreichten Vorteil oder dem Wert der Leistung im Missverhältnis stehen würde,
• wenn die Leistung aufgrund von Umständen, die der Auftraggeber nicht voraussehen konnte, besonders dringlich ist und die Gründe für die besondere Dringlichkeit nicht dem Verhalten des Auftraggebers zuzurechnen sind,
• wenn die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann,
• wenn es sich um eine auf einer Warenbörse notierte oder erwerbbare Lieferleistung handelt,
• wenn Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft werden sollen, die zur teilweisen Erneuerung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen bestimmt sind, bei denen ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, dass der Auftraggeber eine Leistung mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste und bei denen dieser Wechsel eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde.
Der Auftraggeber kann eine Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb durchführen (§ 12 Abs. 1 UVgO).
Bei einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb fordert der Auftraggeber mehrere, grundsätzlich mindestens drei Unternehmen zur Abgabe eines Angebots oder zur Teilnahme an Verhandlungen auf (§ 12 Abs. 2 UVgO).
Direktauftrag
Bauleistungen können bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 3.000 Euro ohne Umsatzsteuer unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden (Direktauftrag).
Der Auftraggeber soll hier allerdings zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln.
EU-weite Vergabeverfahren
Die Vergabeverfahren für EU-weite Vergaben finden nur oberhalb der Schwellenwerte Anwendung und sind u. a. im 4. Teil des GWB aufgeführt.
Die Einzelheiten der Vergabeverfahren ergeben sich für öffentliche Auftragsvergaben oberhalb der Schwellenwerte im Baubereich im 2. Abschnitt der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A – EU) und für Liefer- und Dienstleistungen aus der Vergabeverordnung (VgV).
Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen oberhalb der Schwellenwerte erfolgt
• im offenen Verfahren,
• im nicht offenen Verfahren,
• im Verhandlungsverfahren,
• im wettbewerblichen Dialog oder
• in der Innovationspartnerschaft.
Dem öffentlichen Auftraggeber stehen das offene Verfahren und das nicht offene Verfahren, das stets einen Teilnahmewettbewerb erfordert, nach seiner Wahl zur Verfügung.
Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies durch die Vergabevorschriften zulässig ist.
Offenes Verfahren
Das offene Verfahren ist ein Verfahren, in dem der öffentliche Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auffordert.
Jedes interessierte und geeignete Unternehmen kann ein Angebot abgeben.
Nicht offenes Verfahren
Das nicht offene Verfahren ist ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher europaweiter Bekanntmachung die Unternehmen auffordert, einen Teilnahmeantrag abzugeben. Die Bewerber reichen dann mit ihrem Teilnahmeantrag die geforderten Angaben und Unterlagen zum Nachweis ihrer Eignung und zum Nichtvorliegen von Ausschlusskriterien ein.
Alle interessierten und geeigneten Unternehmen dürfen Teilnahmeanträge einreichen. Der Auftraggeber wählt dann nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien eine beschränkte Zahl geeigneter Unternehmen aus und fordert diese zur Abgabe von Angeboten auf.
Verhandlungsverfahren
Das Verhandlungsverfahren ist ein Verfahren, bei dem sich der öffentliche Auftraggeber mit oder ohne Teilnahmewettbewerb an ausgewählte Unternehmen wendet, um mit einem oder mehreren dieser Unternehmen über die Angebote zu verhandeln.
Im Laufe der Verhandlungen kann die Zahl Angebote verringert werden.
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Bei einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb fordert der öffentliche Auftraggeber eine unbeschränkte Zahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte und geeignete Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung ihrer Eignung.
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
Bei einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb erfolgt keine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Teilnahmeanträgen. Hier fordert der Auftraggeber die ausgewählten Unternehmen unmittelbar zur Abgabe von Erstangeboten auf.
Im Verhandlungsverfahren verhandelt der öffentliche Auftraggeber mit den Bietern über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei darf über den gesamten Angebotsinhalt verhandelt werden, mit Ausnahme der vom öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien
Wettbewerblicher Dialog
Der wettbewerbliche Dialog ist ein Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge mit dem Ziel der Ermittlung und Festlegung der Mittel, mit denen die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers am besten erfüllt werden können.
Im wettbewerblichen Dialog können besonders komplexe Aufträge vergeben werden. Dieses Vergabeverfahren setzt zwingend einen Teilnahmewettbewerb voraus. Die Lösungsmöglichkeiten für die Vergabeaufgabe werden hier im Dialog zwischen Auftraggeber und Unternehmen entwickelt.
Dieses Vergabeverfahren ist besonders für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen geeignet, die konzeptionelle oder innovative Lösungen erfordern. Das Verfahren bietet sich an, wenn der öffentliche Auftraggeber nicht in der Lage ist, die Mittel für seinen Bedarf genau zu definieren oder zu beurteilen, was der Markt an technischen, finanziellen oder rechtlichen Lösungen zu bieten hat.
Im wettbewerblichen Dialog fordert der öffentliche Auftraggeber mit einer europaweiten Bekanntmachung eine unbeschränkte Zahl von Unternehmen zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann hier einen Teilnahmeantrag abgeben und darin die geforderten Informationen für die Prüfung der Eignung übermitteln. Nur vom öffentlichen Auftraggeber ausgewählte und aufgeforderte Unternehmen können dann am Dialog teilnehmen.
Im Dialog mit den Unternehmen bestimmt der Auftraggeber, ggf. in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen, wie seine Bedürfnisse und Anforderungen am besten erfüllt werden können. Dabei kann er mit den ausgewählten Unternehmen alle Aspekte des Auftrags erörtern. Wenn eine befriedigende Lösung ermittelt wurde, schließt der Auftraggeber den Dialog ab.
Nach Abschluss des Dialogs fordert der öffentliche Auftraggeber die verbliebenen Unternehmen auf, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot vorzulegen. Die eingegangenen Angebote werden dann anhand der in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien bewertet.
Innovationspartnerschaft
Die Innovationspartnerschaft ist ein Verfahren zur Entwicklung innovativer, noch nicht auf dem Markt verfügbarer Bau-, Liefer- und Dienstleistungen und zum anschließenden Erwerb der daraus hervorgehenden Leistungen.
Die Innovationspartnerschaft soll es somit öffentlichen Auftraggebern ermöglichen, eine innovative Lösung zu entwickeln.
Nach einem Teilnahmewettbewerb verhandelt der öffentliche Auftraggeber in mehreren Phasen mit den ausgewählten Unternehmen über die abgegebenen Erst- und Folgeangebote.
Der öffentliche Auftraggeber beschreibt bei diesem Verfahren in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen die Nachfrage nach der innovativen Leistung.
Dabei ist anzugeben, welche Elemente dieser Beschreibung Mindestanforderungen sind.
Weiterhin sind auch hier Eignungskriterien vorzugeben, die die Fähigkeiten der Unternehmen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung sowie die Ausarbeitung und Umsetzung innovativer Lösungen betreffen.
Der öffentliche Auftraggeber fordert auch hier eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen auch die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung ihrer Eignung.
Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge einer Bewertung der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Angebot in Form von Forschungs- und Innovationsprojekten einreichen.
Der öffentliche Auftraggeber kann die Zahl geeigneter Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, begrenzen.
Der öffentliche Auftraggeber verhandelt dann mit den Bietern über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern.
Dabei darf über den gesamten Auftragsinhalt verhandelt werden, mit Ausnahme der vom öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien.
Sofern der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen darauf hingewiesen hat, kann er die Verhandlungen in verschiedenen, aufeinanderfolgenden Phasen abwickeln, um so die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern.
Die Innovationspartnerschaft wird durch Zuschlag auf Angebote eines oder mehrerer Bieter eingegangen. Eine Erteilung des Zuschlags allein auf der Grundlage des niedrigsten Preises oder der niedrigsten Kosten ist ausgeschlossen.
Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend dem Forschungs- und Innovationsprozess in zwei aufeinanderfolgenden Phasen strukturiert:
1. eine Forschungs- und Entwicklungsphase, die die Herstellung von Prototypen oder die Entwicklung der Dienstleistung umfasst
2. eine Leistungsphase, in der die aus der Partnerschaft hervorgegangene Leistung erbracht wird
Auf der Grundlage der gesteckten Ziele kann der öffentliche Auftraggeber am Ende jedes Entwicklungsabschnitts entscheiden, ob er die Innovationspartnerschaft beendet oder, im Fall einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern, die Zahl der Partner durch die Kündigung einzelner Verträge reduziert, sofern der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen darauf hingewiesen hat, dass diese Möglichkeiten bestehen und unter welchen Umständen davon Gebrauch gemacht werden kann.
Nach Abschluss der Forschungs- und Entwicklungsphase ist der öffentliche Auftraggeber zum anschließenden Erwerb der innovativen Leistungen nur dann verpflichtet, wenn das bei Eingehung der Innovationspartnerschaft festgelegte Leistungsniveau und die Kostenobergrenze eingehalten werden.