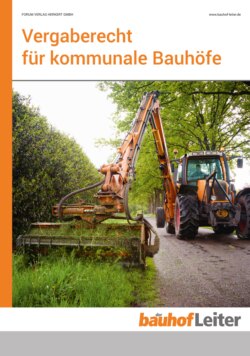Читать книгу Vergaberecht für kommunale Bauhöfe - Forum Verlag Herkert GmbH - Страница 9
ОглавлениеVergaberechtliche Ausgangssituation
Rechtsrahmen
Das Vergaberecht umfasst alle Vorschriften und Regeln über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen.
Hierunter fallen die Beschaffung von
• Bauleistungen,
• Lieferleistungen,
• Dienstleistungen,
• freiberuflichen Leistungen,
• Bau- und Dienstleistungskonzessionen.
Die wichtigsten Vorschriften und Regelungen für das Vergaberecht sind im
• Haushaltsrecht des Bundes, der Länder und der Kommunen und
• Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), in dem insbesondere die Umsetzung vom europäischen Vergaberecht in das deutsche Recht erfolgt ist,
enthalten.
Daneben gelten insbesondere für die Vergabe von
• Bauleistungen
die VOB Teil A Ausgabe 2019 – Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen –,
• Liefer- und Dienstleistungen
– die Verfahrensordnung für die nationale Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO), ggf. die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A), sofern die UVgO noch nicht eingeführt ist,
– die neue UVgO ersetzt für Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte die VOL/A, 1. Abschnitt,
– die früher geltende EG-VOL/A für Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte wurde abgeschafft und die hier enthaltenen Regelungen wurden in die neue Vergabeverordnung (VgV) integriert,
– die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge für EU-weite Vergaben (Vergabeverordnung – VgV),
• freiberuflichen Leistungen
– für nationale Vergaben (unterhalb der EU-Schwellenwerte) sieht die Unterschwellenvergabeordnung lediglich in § 50 UVgO eine Sonderregelung für freiberufliche Leistungen vor, wonach diese Vergaben grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben sind (mindestens drei Angebote, sofern am Markt vorhanden),
– die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge für EU-weite Vergaben (Vergabeverordnung – VgV),
• Bau- und Dienstleistungskonzessionen Die Vorgaben zur Vergabe von Konzessionen sind in § 105 GWB und weiterhin noch in der KonzVgV und der VOB geregelt.
| Gesetz | Abkürzung |
| Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen | GWB |
| Unterschwellenvergabeverordnung | UVgO |
| Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen | VOL/A |
| Vergabeverordnung | VgV |
| Verordnung über die Vergabe von Konzessionen – Konzessionsvergabeverordnung | KonzVgV |
| Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen | VOB |
| Sektorenverordnung | SektVO |
| Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit | VSVgV |
| Vergabestatistikverordnung | VergStatVO |
| Übersicht der wichtigsten Gesetze im Vergabebereich |
Vergabegrundsätze
Als Grundsätze der Vergabe werden allgemein der Rechtsrahmen des Vergaberechts und die allgemeinen Vergabeprinzipien und Verfahrensgrundsätze bezeichnet, die in jedem Stadium des Verfahrens zu beachten sind.
Die wesentlichen Grundsätze der Vergabe sind insbesondere in § 97 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) aufgeführt.
Hiernach sind öffentliche Aufträge im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren zu vergeben, wobei auch die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden müssen.
• Gleichbehandlungsgrundsatz
Der Gleichbehandlungsgrundsatz gem. § 97 Abs. 2 GWB gehört zu den elementaren Grundsätzen des deutschen Vergaberechts und dient dazu, die Vergabeentscheidung im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs auf willkürfreie und sachliche Erwägungen zu stützen.
Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz müssen alle am Verfahren beteiligten Unternehmen gleich behandelt werden und denselben Zugang zu Informationen haben. Weiterhin sind an sie auch dieselben Bewertungsmaßstäbe zu legen. Insbesondere ist eine Diskriminierung aufgrund der Herkunft eines Bieters auszuschließen, wobei nicht zwischen Bietern aus Deutschland, aus EU-Staaten oder aus Nicht-EU-Staaten unterschieden wird.
Eine Ungleichbehandlung ist nur dann gestattet, wenn sie aufgrund dieses Gesetzes (GWB) ausdrücklich geboten oder gestattet ist.
• Transparenzgebot
Das vergaberechtliche Transparenzgebot verpflichtet den öffentlichen Auftraggeber, öffentliche Aufträge und Konzessionen im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren zu vergeben, wobei ein angemessener Grad an Öffentlichkeit herzustellen ist, sodass die Vergabe öffentlicher Aufträge für den Wettbewerb geöffnet wird.
Die Einhaltung transparenter Verfahren dient zugleich auch der Korruptionsprävention und der Verhinderung anderer unlauterer Verhaltensweisen.
• Wettbewerbsgrundsatz
Durch den Wettbewerbsgrundsatz wird gewährleistet, dass so viele Marktteilnehmer wie möglich am Vergabeverfahren teilnehmen können. Je größer der Wettbewerb ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Auftraggeber auch die bestmögliche Qualität der nachgefragten Leistungen zu günstigen Preisen angeboten bekommt.
Bieter, die nachweislich wettbewerbsbeschränkende Abreden getroffen haben, werden zwingend vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.
• Geheimwettbewerb
Informationen aus dem Verfahren unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung. Insbesondere sind die Angebote auch nach Öffnung unter Verschluss zu halten.
Zu den weiteren Grundsätzen der Vergabe zählen entsprechend § 97 GWB außerdem
• der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz (ein bestimmter Erfolg soll mit dem geringstmöglichen Mitteleinsatz erzielt werden),
• der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (ergriffene Maßnahmen müssen zumutbar und angemessen sein),
• die Berücksichtigung von mittelständischen Interessen (Leistungen sind möglichst in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben), damit kleine und mittlere Unternehmen eine faire Wettbewerbschance haben).
Auftragsgegenstand
Dem Auftraggeber steht grundsätzlich ein Bestimmungsrecht zu, welchen Auftragsgegenstand er beschaffen will, da das Vergaberecht zwar die Art und Weise der Beschaffung regelt, nicht jedoch, was der Auftraggeber beschaffen möchte.
Der Auftraggeber ist also berechtigt, den Inhalt der Leistung gemäß seinen Erfordernissen und Wünschen auszugestalten. Ihm steht daher bei der Leistungsbestimmung ein weites Ermessen zu. Zum Beispiel liegen häufig Kompatibilitätsanforderungen vor, die die Beschaffung einer bestimmten Leistung rechtfertigen.
Allerdings gilt das Leistungsbestimmungsrecht nicht unbegrenzt. Seine Grenzen findet das Leistungsbestimmungsrecht in dem sog. Gebot der produktneutralen Ausschreibung.
Dies bedeutet, dass der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das die Erzeugnisse oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens kennzeichnet, oder auf gewerbliche Schutzrechte, Typen oder einen bestimmten Ursprung verweisen darf, wenn dadurch Unternehmen oder bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden.
Wenn der Auftraggeber in seiner Leistungsbeschreibung ein konkretes Produkt beschreibt, wird i. d. R. der Wettbewerb eingeschränkt, oder es entsteht ein Wettbewerbsvorteil für ein bestimmtes Unternehmen, das die aufgeführten Produkte anbieten kann.
Nur ausnahmsweise kann von dem Gebot der Produktneutralität abgewichen werden, wenn dies z. B. aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist.
Eine Abweichung aus sachlichen Gründen setzt voraus, dass
• die Abweichung durch den Auftragsgegenstand sachlich gerechtfertigt ist,
• vom Auftraggeber dafür nachvollziehbare objektive und auftragsbezogene Gründe vorhanden sind und die Entscheidung nicht willkürlich getroffen wurde,
• die Gründe hierfür tatsächlich vorhanden sind,
• die Bestimmung die Unternehmen nicht diskriminiert und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten wird,
• die Entscheidung ausreichend dokumentiert wird.
Bauleistungen, Lieferleistungen, freiberufliche Leistungen, Konzessionen
Bauleistungen
Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand gehalten, geändert oder beseitigt wird.
Bauleistungen werden von öffentlichen Auftraggebern allgemein nach der VOB Teil A Ausgabe 2019 – Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen – vergeben.
Lieferleistungen und Dienstleistungen
Lieferleistungen
Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere
• Kauf oder Ratenkauf oder
• Leasing von Waren,
• Mietverhältnisse oder
• Pachtverhältnisse mit oder ohne Kaufoption
betreffen. Die Verträge können auch Nebenleistungen umfassen.
Lieferleistungen umschreiben somit Aufträge, in denen vertraglich Lieferinhalte und deren Abwicklung bestimmt werden, für die vom Auftraggeber ein Entgelt an den Auftragnehmer gezahlt wird.
Lieferleistungen werden i. d. R. nach der Verfahrensordnung für die nationale Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO) vergeben, ggf. nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A), sofern die UVgO noch nicht eingeführt ist.
Für die Vergabe öffentlicher EU-weiter Vergaben ist die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV) anzuwenden.
Dienstleistungen
Bei einer Dienstleistung handelt es sich um eine besondere Art von Leistung, die in Form einer Dienstleistung erbracht wird. Es findet hier Herstellung und Verbrauch gleichzeitig statt. Die Dienstleistung setzt sich aus „Dienst“ und „Leistung“ zusammen.
Eine Dienstleistung ist die Tätigkeit eines Wirtschaftsteilnehmers (Unternehmens) im Auftrag eines anderen.
Eine Dienstleitung ist somit ein immaterielles Gut, bei dem die Leistungserbringung im Vordergrund steht. Eine Dienstleistung kann sowohl von natürlichen Personen wie auch von juristischen Personen erbracht werden. Beide Personenkreise werden gleichbedeutend als Dienstleistender bezeichnet.
Allgemein werden vier Arten von Dienstleistungen unterschieden:
• Personenbezogene Dienstleistungen
Als personenbezogen werden die Dienstleistungen bezeichnet, die entweder an einer Person oder zusammen mit einer Person erbracht werden und nur durch eine direkte Beteiligte des Dienstleistungsempfängers durchgeführt werden können.
Personenbezogene Dienstleistungen sind z. B. die Leistungen, die Lehrer, Ärzte oder Pfleger erbringen.
Diese Form der Dienstleistung kommt ausschließlich dadurch zustande, dass der Kunde in die Vorbereitung und den Ablauf einer Maßnahme einbezogen wird, wobei die persönliche Beteiligung des Kunden unabhängig davon ist, ob sie aktiv oder passiv ausgestaltet ist.
• Sachbezogene Dienstleistungen
Bei der sachbezogenen Dienstleistung tritt der Dienstleister nicht oder nur in untergeordneter Form in Erscheinung. Die Leistung ist somit unabhängig von der Person des Dienstleisters und richtet sich nach einem Gegenstand aus. Zu den sachbezogenen Dienstleistern gehören z. B. Versicherungen, Lieferdienste, Speditionen, Banken.
• Produktbegleitende Dienstleitungen
Produktbegleitende Dienstleistungen sind alle Dienstleistungen, die von Unternehmen ergänzend zu materiellen Gütern, sowohl selbst produzierten wie auch gehandelten Gütern, angeboten werden.
Produktbegleitende Dienstleistungen gehören zu den industrienahen Dienstleistungen, die Unternehmen als Serviceleistung im Zuge des Verkaufs ihrer Produkte bereitstellen. Sie sind damit Teil der sog. sekundären Dienstleistungen, die neben dem materiellen Produkt einen zusätzlichen Nutzen für den Kunden bieten.
Dies können z. B. Wartungsarbeiten (Leistungen nach dem Kauf) und Beratungsgespräche (Leistungen vor dem Kauf) sein.
• Originäre Dienstleistungen
Originäre Dienstleistungen werden von Unternehmen oder Dienstleistern erbracht, die selbst keine Güter produzieren oder mit Gütern handeln und die ausschließlich Dienstleistungen erbringen.
Die originären Dienstleistungen konzentrieren sich ausschließlich auf die Erbringung von Leistungen, die dem Kunden unmittelbar dienen und sich exklusiv an dessen Bedürfnissen orientieren. Hierzu zählen z. B. Reinigungsdienste, Dienste von Krankenhäusern oder Abschleppunternehmen.
Eine besondere Form der originären Dienstleistungen sind die sog. wissensintensiven Angebote von Freiberuflern, z. B. Anwälten.
Anschauliche Beispiele für gängige Dienstleistungen sind Leistungen, die z. B. Verkäufer, Reinigungskräfte, kaufmännische Angestellte, Ärzte, Rechtsanwälte, Handwerker usw. erbringen.
Bei gemischten Leistungen (z. B. Liefer- und Dienstleistungen) handelt es sich um eine Lieferleistung, wenn der Anteil der zu liefernden Leistung wertmäßig überwiegt.
Freiberufliche Leistungen
Als freiberufliche Leistungen werden geistig-schöpferische Leistungen bezeichnet, die von Personen aus der Berufsgruppe der freien Berufe erbracht werden.
Ein ausführlicher Katalog aller freien Berufe, die freiberufliche Leistungen anbieten dürfen, ist im Einkommensteuergesetz unter § 18 Abs. 1 Nr. 1 (EStG) zu finden.
Freiberufliche Leistungen werden z. B. im Wesentlichen von folgenden Berufsgruppen erbracht: Ärzte, Hebammen, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Ingenieure, Architekten, Journalisten, Dolmetscher.
Konzessionen (Bau- und Dienstleistungskonzessionen)
Konzessionen sind entgeltliche Verträge, mit denen ein oder mehrere Konzessionsgeber (Auftraggeber) ein oder mehrere Unternehmen mit der Erbringung von Bauleistungen (Baukonzessionen) oder mit der Erbringung und der Verwaltung von Dienstleistungen betrauen (Dienstleistungskonzessionen).
Bei Konzessionen besteht die Gegenleistung für die erbrachte Leistung
• entweder allein in dem Recht zur Nutzung des Bauwerks oder
• in diesem Recht zuzüglich einer Zahlung (Baukonzession) oder
• entweder allein in dem Recht zur Verwertung der Dienstleistungen oder
• in diesem Recht zuzüglich einer Zahlung.
In Abgrenzung zur Vergabe öffentlicher Aufträge geht bei der Vergabe einer Bau- oder Dienstleistungskonzession das Betriebsrisiko für die Nutzung des Bauwerks oder für die Verwertung der Dienstleistungen auf den Konzessionsnehmer über.
Das Betriebsrisiko kann ein Nachfrage- oder Angebotsrisiko sein.