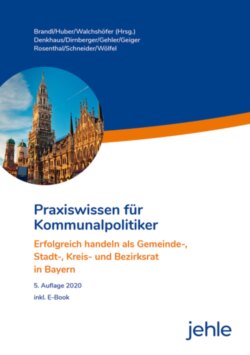Читать книгу Praxiswissen für Kommunalpolitiker - Franz Dirnberger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inhaltsverzeichnis
ОглавлениеTeil 1 ABC der kommunalen Praxis
Teil 2 Die kommunale Selbstverwaltung
1. Einführung
2. Selbstverwaltung und die verfassungsmäßige Verankerung im Grundgesetz und in der Bayer. Verfassung
2.1 Selbstverwaltung – was ist das?
2.2 Selbstverwaltung – wo steht was?
2.3 Selbstverwaltung – was ist das im Einzelnen?
2.3.1 Selbstverwaltung und Pflichtaufgaben
2.3.2 Selbstverwaltung und freiwillige Aufgaben
2.4 Selbstverwaltung – gibt es Grenzen?
2.4.1 Selbstverwaltung – welche Handlungsformen gibt es?
2.4.2 Selbstverwaltung – welchen Rang haben die Handlungsformen in der Normenhierarchie?
2.4.3 Selbstverwaltung – wie wird sie kontrolliert?
2.4.4 Selbstverwaltung und die Rolle des Bürgers
2.5 Selbstverwaltung – was sind Kernbereiche?
3. Gebietskörperschaften
3.1 Kommunale Gebietskörperschaft – was ist das?
3.2 Kommunale Gebietskörperschaft – wo steht was?
3.3 Kommunale Gebietskörperschaft im Staatsaufbau
3.4 Die kommunale Gebietskörperschaft: Gemeinden, Landkreise, Bezirke
4. Die kommunale Zusammenarbeit
4.1 Kommunale Zusammenarbeit – was ist das?
4.2 Kommunale Zusammenarbeit – wo steht was?
4.3 Kommunale Zusammenarbeit – wozu?
4.4 Einzelne Formen der kommunalen Zusammenarbeit
4.4.1 Privatrechtliche Formen
4.4.2 Die Arbeitsgemeinschaften
4.4.3 Die Zweckvereinbarung
4.4.4 Zweckverband
4.4.5 Verwaltungsgemeinschaft
4.4.6 PPP als Form der Zusammenarbeit zwischen privater und öffentlicher Hand
4.4.7 Grenzen der interkommunalen Zusammenarbeit
4.5 IT in der Kommunalverwaltung
5. Das Verhältnis Staat – Kommunen
5.1 Bund, Länder und Kommunen im System der Gewaltenteilung
5.2 Wo steht was?
5.3 Der eigene Wirkungskreis
5.4 Der übertragene Wirkungskreis
5.5 Finanzierung der Aufgaben
5.6 Finanzen … ein ewiges Thema
5.6.1 Kommunaler Finanzausgleich und Verteilungsgerechtigkeit
5.6.2 Die bayerische Konnexität
5.6.3 Die Gewerbesteuer
5.6.4 Das kommunale Haushaltsrecht
5.6.5 Die neue Politik der vollen Hände
5.7 Der Staat als Kontrolleur
5.7.1 Die Rechtmäßigkeit der Verwaltung
5.7.2 Die Rechtsaufsicht
5.7.3 Die Fachaufsicht
5.7.4 Checkliste – Aufsichtliche Maßnahmen
5.8 Sonstige Kontrolle kommunalen Handelns
5.8.1 Die strafrechtliche, zivil- und verwaltungsrechtliche Verantwortung der Kommune
5.8.2 Formlose Rechtsbehelfe, Widerspruch, Abhilfe
5.8.3 Verwaltungsgerichtliche Kontrolle
5.8.4 Medien
6. Europa und die Kommunen
6.1 Warum sind Kommunen zunehmend europabetroffen?
6.2 Das Europabüro der bayerischen Kommunen als direkter Ansprechpartner in Brüssel
6.3 Grundzüge des Europarechts (Rechtsquellen des Unionsrechts und Institutionen der Europäischen Union)
6.4 Auswirkung der EU-Binnenmarkt- und EU-Wettbewerbsregeln sowie weiterer EU-Rechtsbereiche und EU-Politiken auf die Kommunen
6.4.1 EU-Vergaberecht
6.4.2 EU-Konzessionsrichtlinie
6.4.3 EU-Beihilferecht
6.4.4 EU-Umweltrecht und EU-Klimaschutz- und Energieziele
6.4.5 Sozialer Bereich in der Europäischen Union
6.4.6 EU-Migrationspolitik
6.4.7 Digitalisierung und EU-Datenschutzgrundverordnung
6.4.8 Einheimischenmodelle und Bauleitpläne versus EU-Recht
6.5 EU-Fördermittelpolitik – Grundsätze und Förderbereiche
6.5.1 Geplante EU-Regionalpolitik/Strukturfondsförderung 2021 bis 2027
6.5.2 Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2021–2027
6.5.3 EU-Aktionsprogramme in der neuen Förderperiode 2021–2027
7. Die kommunalen Spitzenverbände
7.1 Kommunale Spitzenverbände – was ist das?
7.2 Spitzenverbände im eigentlichen Sinn
8. Zusammenfassung
Teil 3 Der kommunale Mandatsträger
1. Das Verhältnis zwischen Bürger und Mandatsträger
1.1 Repräsentation und Wahlen
1.1.1 Was hat es mit dem Repräsentationsprinzip auf sich?
1.1.2 Wo steht etwas über Kommunalwahlen?
1.1.3 Wer wird gewählt?
1.1.4 In welchen Fällen werden Ortssprecher gewählt?
1.1.5 Die Bezirksausschüsse in Großstädten
1.1.6 Wer darf wählen?
1.1.7 Wer kann gewählt werden?
1.1.8 Besondere Bedingungen für erste Bürgermeister und Landräte
1.1.9 Wann wird gewählt?
1.1.10 Was passiert, wenn ein erster Bürgermeister oder Landrat vorzeitig ausscheidet?
1.1.11 Wie werden die Wahlvorschläge aufgestellt?
1.1.12 Wie verhält es sich mit Wahlvorschlägen für erste Bürgermeister und Landräte?
1.1.13 Was muss bei der Nominierung der Kandidaten beachtet werden?
1.1.14 Wer sind die Wahlorgane, wie setzen sie sich zusammen und welche Aufgaben haben sie?
1.1.15 Was geschieht nach der Einreichung der Wahlvorschläge?
1.1.16 Wie werden erste Bürgermeister und Landräte gewählt?
1.1.17 Wie werden Mitglieder des Gemeinderates und des Kreistages gewählt?
1.1.18 Wie geht die Briefwahl vor sich?
1.1.19 Was ist ein „beweglicher Wahlvorstand“?
1.1.20 Was hat es mit den Sonderstimmbezirken auf sich?
1.1.21 Wie wird das Wahlergebnis ermittelt?
1.1.22 Wie errechnet sich die Sitzverteilung?
1.1.23 Wer überprüft das Wahlgeschehen?
1.2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
1.2.1 Wo steht etwas über Bürgerbegehren und Bürgerentscheid?
1.2.2 Wer kann was beantragen?
1.2.3 Wann führt ein Bürgerbegehren zu einem Bürgerentscheid?
1.2.4 Was geschieht nach einem erfolgreichen Bürgerbegehren?
1.2.5 Wie kommt die Entscheidung zustande?
1.2.6 Welche Wirkung hat der Bürgerentscheid?
1.3 Sonstige Mitwirkungsmöglichkeiten des Bürgers
1.3.1 Wie kann sich der Bürger informieren?
1.3.2 Die Bürgerversammlung als regelmäßige Mitberatungsmöglichkeit
1.3.3 Der Bürgerantrag als Initiativrecht des Bürgers
1.3.4 Welche Mitwirkungsmöglichkeiten hat der Bürger bei der Bauleitplanung?
1.3.5 Welche Mitbestimmungsrechte gibt es sonst?
1.3.6 Wie kann sich der Bürger außerdem Gehör verschaffen?
1.4 Der Mandatsträger als Anlaufstelle für den Bürger
1.4.1 Was erwartet der Bürger vom Mandatsträger?
1.4.2 Was verlangt die Ausübung des Mandats?
1.4.3 Welche Konflikte muss der Mandatsträger bewältigen?
1.5 Exkurs: Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kommune
1.5.1 Was ist kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit?
1.5.2 Wo steht etwas über kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit?
1.5.3 Gibt es für die kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Regeln?
1.5.4 Wie macht man kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit?
1.6 Exkurs: Die Pflichten des Bürgers
1.6.1 Wo steht etwas über die Pflichten des Bürgers?
1.6.2 Welche Ehrenämter muss ein Bürger übernehmen?
1.6.3 Welche Gemeindelasten muss ein Bürger tragen?
2. Die Stellung des Mandatsträgers
2.1 Mandatsträger, was ist das?
2.1.1 Mandatsträger, wo steht was?
2.1.2 Aufgaben und Zuständigkeiten
2.1.3 Mandatsträger – was sind Referenten?
2.1.4 Mandatsträger und Ausschüsse
2.2 Mandatsträger: Hauptamt/Ehrenamt
2.2.1 Hauptamt/Ehrenamt – wo steht was?
2.2.2 Mandatsträgerschaft als öffentliches Amt
2.2.3 Besoldung/Entschädigung/Versorgung
2.3 Haftungsfragen
2.3.1 Haftung, was ist das?
2.3.2 Wo steht was?
2.3.3 Haftung – wie entsteht sie, wen trifft sie?
2.3.4 Strafrechtliche Verantwortlichkeit
2.3.5 Welchen Schutz vor Haftungsansprüchen gibt es?
2.4 „Rechtliche Haftung der Kommune“ und „politische Haftung“
2.5 Steuerliche Behandlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister und Gemeinderats-, Kreistags- und Bezirkstagsmitglieder
2.5.1 Ehrenamtliche Mitglieder eines Gemeinde- oder eines Stadtrats
2.5.2 Ehrenamtliche erste Bürgermeister
2.5.3 Ehrenamtliche weitere Bürgermeister
2.5.4 Ehrenamtliche Mitglieder eines Kreistags
2.5.5 Gewählte Stellvertreter der Landräte
2.5.6 Mitglieder mehrerer kommunaler Vertretungsorgane
2.5.7 Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaften
2.5.8 Ehrenamtliche Mitglieder eines Bezirkstags
3. Die Arbeit des Mandatsträgers in der Gemeinde
3.1 Der Gemeinderat – ein Parlament?
3.1.1 Wo steht etwas über den Gemeinderat?
3.1.2 Inwiefern arbeitet der Gemeinderat wie ein Parlament?
3.1.3 Warum ist der Gemeinderat kein Parlament?
3.1.4 Welche Ausschüsse gibt es?
3.1.5 Wie werden die Ausschüsse gebildet?
3.1.6 Welche Rolle spielen die politischen Parteien?
3.2 Die Aufgabenverteilung zwischen Gemeinderat und Bürgermeister
3.2.1 Um welche Kompetenzen geht es?
3.2.2 Wer nimmt die Vorbereitungsfunktion wahr?
3.2.3 Wer nimmt die Entscheidungsfunktion wahr?
3.2.4 Wer nimmt die Vollzugsfunktion wahr?
3.2.5 Wer nimmt die Kontrollfunktion wahr?
3.2.6 Die besondere Rolle des ersten Bürgermeisters
3.3 Der Geschäftsgang im Gemeinderat
3.3.1 Wo steht was über den Geschäftsgang?
3.3.2 Wie und wann muss eingeladen werden?
3.3.3 Die Sitzung im Mittelpunkt der Entscheidungsfindung
3.3.4 Öffentliche und nicht-öffentliche Sitzung
3.3.5 Wie wird die Sitzung eröffnet?
3.3.6 Die Abwicklung der Tagesordnung
3.3.7 Wer darf Anträge stellen?
3.3.8 Wie wird abgestimmt?
3.3.9 Wie geht man mit Störern um?
3.3.10 Was geschieht nach der Sitzung?
3.4 Der kommunale Entscheidungsprozess
3.4.1 Wer hat Anteil am kommunalen Entscheidungsprozess?
3.4.2 Welche Rolle spielen die Parteien und Interessengruppen?
3.4.3 Welche Rolle spielen die Medien?
3.4.4 Wer bringt den kommunalen Entscheidungsprozess in Gang?
3.5 Exkurs: Die Satzung als Ausdruck der Rechtsetzungshoheit
3.5.1 Wo steht etwas über die Rechtsetzungshoheit?
3.5.2 Was ist eine Rechtsverordnung, was eine Satzung?
3.5.3 Wie wird eine Satzung erlassen?
3.5.4 Was enthalten die Satzungen?
4. Die Arbeit des Mandatsträgers im Landkreis
4.1 Der Landkreis als Selbstverwaltungskörperschaft
4.2 Was ist für den Mandatsträger im Landkreis anders als in der Gemeinde?
4.2.1 Das Landratsamt als Staatsbehörde
4.2.2 Der Kreisausschuss ist Hauptorgan
4.2.3 Der Landrat kann nicht auf den Vorsitz in einem Ausschuss verzichten
4.2.4 Der einzelne Kreisrat hat ein Auskunftsrecht
Teil 4 Die Kommunen als eigenständige Körperschaften
1. Die Selbstverwaltung der Kommunen
1.1 Grundsätzliches zu Umfang und Abgrenzung der kommunalen Aufgaben
1.1.1 Kommunale Aufgabenzuständigkeit allgemein
1.1.2 Eigener Wirkungskreis und übertragener Wirkungskreis – was ist der Unterschied?
1.1.3 Eigener Wirkungskreis – wofür ist die Gemeinde, der Landkreis, der Bezirk zuständig?
1.1.4 Im eigenen Wirkungskreis gibt es Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben
1.1.5 Übertragener Wirkungskreis
1.1.6 Abgrenzung zwischen Landratsamt, kreisfreier Stadt und Großer Kreisstadt
1.1.7 Rechtsaufsicht und Fachaufsicht
1.2 Ehrenamtliches Engagement
1.3 Schule und Bildung
1.3.1 Grund- und Mittelschule
1.3.2 Errichtung und Finanzierung von Schulen
1.3.3 Erwachsenenbildung
1.3.4 Digitalisierung im Bereich der Bildung
1.4 Kulturarbeit und Kulturförderung
1.5 Umweltschutz
1.5.1 Natur- und Landschaftsschutz
1.5.2 Immissionsschutz
1.5.3 Abfallwirtschaft
1.5.4 Agenda 21
1.6 Straßen und Verkehr
1.6.1 Straßenrecht
1.6.2 Straßenverkehrsrecht
1.6.3 Öffentlicher Personennahverkehr
1.7 Soziale Aufgaben
1.8 Kinder, Jugend und Familie
1.9 Weitere kommunale Aufgaben
1.9.1 Gesundheitswesen/Krankenhäuser
1.9.2 Bauen und Stadtentwicklung
1.9.3 Freizeit und Sport
1.9.4 Fremdenverkehr
1.9.5 Sicherheit und Ordnung
2. Die Finanzhoheit der Kommunen
2.1 Die Kommunalfinanzen in Bedrängnis
2.2 Begriff der Abgaben
2.3 Reihenfolge der Einnahmebeschaffung
2.4 Gewerbesteuer
2.4.1 Allgemeines
2.4.2 Wer wird besteuert?
2.4.3 Wie lauten die Rechtsgrundlagen?
2.4.4 Wie hoch ist die Steuer und wer setzt sie fest?
2.4.5 Gewerbesteuerhebesätze 2018 im Landesdurchschnitt
2.4.6 Hinzurechnungen und Kürzungen des Gewerbeertrags
2.4.7 Freibetrag für natürliche Personen
2.4.8 Freibetrag für juristische Personen
2.4.9 Abrundung
2.4.10 Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags
2.4.11 Steuerermäßigung wegen Gewerbesteuerzahlung (§ 35 EStG)
2.4.12 Die Gewerbesteuerumlage
2.4.13 Berechnungsbeispiel/Gewerbesteuer im Jahr 2020
2.4.14 Die Zukunft der Gewerbesteuer
2.5 Grundsteuer
2.5.1 Allgemeines
2.5.2 Wie lautet die Rechtsgrundlage?
2.5.3 Was wird besteuert?
2.5.4 Wie hoch ist die Steuer bis Ende 2024?
2.5.5 Festsetzung der Grundsteuerhebesätze A und B
2.5.6 Grundsteuerhebesätze 2018 im Landesdurchschnitt
2.5.7 Grundsteuererlass
2.6 Einkommensteuer
2.6.1 Allgemeines
2.6.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2.6.3 Verteilungsmodus
2.6.4 Einkommensteuerstatistik
2.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2.7.1 Allgemeines
2.7.2 Wie lautet die Rechtsgrundlage?
2.7.3 Verteilung auf die Gemeinden
2.7.4 Verteilung des Umsatzsteueranteils an Gemeinden ab 2018
2.8 Hundesteuer
2.9 Zweitwohnungssteuer
2.10 Beiträge – was man wissen muss
2.10.1 Allgemeine Einführung
2.10.2 Was sind Erschließungsbeiträge?
2.10.3 Anschlussbeiträge für leitungsgebundene öffentliche Einrichtungen
2.10.4 Ausbaubeiträge für Straßen wurde zum 1.1.2018 abgeschafft
2.10.5 Fremdenverkehrsbeitrag
2.10.6 Kurbeitrag
2.11 Gebühren – was man wissen muss
2.11.1 Benutzungsgebühren
2.11.2 Erhebung von Verwaltungskosten
2.12 Kommunaler Finanzausgleich
2.12.1 Wozu benötigen die Gemeinden einen Finanzausgleich?
2.12.2 Aufgaben und Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs in Bayern
2.12.3 Übersicht über die Finanzausgleichsleistungen 2020 in Euro
2.12.4 Allgemeines zur Entwicklung der Kommunalfinanzen 2019
2.12.5 Wie lautet die Rechtsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich?
2.12.6 Der allgemeine Steuerverbund (Art. 1, 2 bis 6 BayFAG)
2.12.7 Die Schlüsselzuweisungen, ein Buch mit sieben Siegeln?
2.12.8 Berechnungsbeispiel Gemeindeschlüsselzuweisung für das Jahr 2019
2.12.9 Berechnungsbeispiel Landkreisschlüsselzuweisungen für das Jahr 2019
2.12.10 Beteiligung der Kommunen an der Grunderwerbsteuer
2.12.11 Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich, Art. 1b BayFAG)
2.12.12 Beteiligung der Kommunen am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund
2.12.13 Finanzzuweisungen (Art. 7 BayFAG)
2.12.14 Zuweisungen für Gesundheits-, Veterinär- und Wasserwirtschaftsämter sowie Heimaufsicht
2.12.15 Förderung kommunaler Hochbaumaßnahmen (Art. 10 BayFAG)
2.12.16 Weitere Zuweisungen im Finanzausgleich
2.12.17 Die Kreisumlage
2.12.18 Die Bezirksumlage
2.13 Der Haushalt
2.13.1 Die Haushaltssatzung
2.13.2 Kameralistik
2.13.3 Der Haushaltsplan
2.13.4 Wie gliedert sich ein Haushalt?
2.13.5 Anlagen des Haushalts
2.13.6 Werdegang des Haushalts
2.13.7 Haushaltslose Zeit
2.13.8 Was bedeutet mittelfristige Finanzplanung?
2.13.9 Allgemeine Haushaltsgrundsätze
2.13.10 Unvorhergesehene Ausgaben – was tun?
2.13.11 Reform des kommunalen Haushaltsrechts
2.13.12 Doppik
2.14 Umsatzsteuerpflicht für Kommunen ab 1.1.2021
3. Die Personalhoheit der Kommune
3.1 Was ist Personalhoheit?
3.2 Wo steht etwas über die Personalhoheit?
3.3 Personalplanung und Personalauswahl
3.3.1 Was finde ich an Personalstruktur vor?
3.3.2 Personalplanung
3.3.3 Personalentscheidung
3.3.4 Methoden der Personalgewinnung
3.3.5 Personalführung
3.3.6 Leistungsgerechte Vergütung
3.4 Kommunalbedienstete
3.4.1 Die Kommunalbeamten
3.4.2 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes
3.4.3 Geringfügig Beschäftigte
3.4.4 Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
4. Bauen in der Kommune
4.1 Allgemeine Fragen
4.1.1 Welche Gesetze sind wichtig?
4.1.2 Wie kommt die Gemeinde mit dem Baurecht in Berührung?
4.1.3 Wer ist in der Gemeinde zuständig?
4.2 Bauleitplanung
4.2.1 Welche Arten von Bauleitplanung gibt es?
4.2.2 Wie läuft das Verfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen?
4.2.3 Die wesentlichen inhaltlichen Bindungen der Bauleitplanung
4.2.4 Die Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
4.2.5 Was kann man in einem Bebauungsplan festsetzen?
4.2.6 Die Baugebietstypen
4.2.7 Das Maß der baulichen Nutzung
4.2.8 Die Bauweise
4.3 Einzelbauvorhaben
4.3.1 Genehmigungsfreiheit und Genehmigungspflicht
4.3.2 Die drei planungsrechtlichen Bereiche
4.3.3 Wie werden Innen- und Außenbereich voneinander abgegrenzt?
4.3.4 Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans
4.3.5 Zulässigkeit von Vorhaben im Innenbereich
4.3.6 Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich
5. Vergaberecht
5.1 Ziele und Grundsätze des Vergaberechts
5.2 Auftrag
5.2.1 Begriffe
5.2.2 Einzelne Aufträge
5.2.3 Los
5.3 Vergabeverfahren
5.4 Maßgebliche Rechtsvorschriften und Verfahren
5.5 Einzelheiten zum Verfahren
5.5.1 Zuschlag
5.5.2 Bekanntmachung
5.5.3 Präqualifikationsverfahren
5.5.4 Vergabevermerk
5.5.5 Folgen bei vergaberechtlichen Verstößen
6. Kommunales Marketing
6.1 Komplexe Herausforderungen für Kommunen
6.1.1 Dynamik des Wandels
6.1.2 Zwischen Wettbewerb und Zusammenarbeit
6.1.3 Auswirkungen der Handelsentwicklung
6.1.4 Fokus Online-Handel
6.2 Grundlagen und Weiterentwicklungen
6.2.1 Idee und Entwicklung des Instrumentariums
6.2.2 Säulen eines integrierten Stadtmarketings
6.2.3 Öffentlich-private Zusammenarbeit
6.2.4 Spielregeln
6.2.5 Förderkulisse
6.3 Der Werkzeugkasten
6.3.1 Der gelungene Auftakt
6.3.2 Bestands- und Potentialanalyse
6.3.3 Strategische Ziele und Konzepte
6.3.4 Flächen- und Leerstandsmanagement
6.3.5 Quartiersmanagement
6.3.6 Gemeinschaftsaktionen
6.3.7 Organisationsfindung und Installation
6.3.8 Finanzierung
6.4 Thesen zur Perspektive Innenstadt 2035
6.5 Wo steht Ihre Kommune? Ein Schnelltest
6.6 Quellen und weiterführende Informationen
Teil 5 Die kommunale Wirtschaft
1. Kommunale und private Aufgabenerledigung
1.1 Die Diskussion um die Alternativen
1.1.1 Das Diktat der leeren Kassen
1.1.2 Wirtschaften Private günstiger?
1.1.3 Worin besteht der prinzipielle Unterschied?
1.2 Rahmenbedingungen für private Aufgabenerledigung
1.2.1 Die Subsidiaritätsklausel
1.2.2 Daseinsvorsorge als Kern der kommunalen Selbstverwaltung
1.2.3 Welche Aufgaben eignen sich für private Erledigung?
2. Überblick über das kommunale Unternehmensrecht
3. Zulässigkeitsvoraussetzungen
3.1 Allgemeines
3.2 Zweck
3.3 Umfang des Tätigkeitsbereiches des Unternehmens
3.4 Anzeige
4. Die einzelnen Unternehmensformen
4.1 Abgrenzung der kommunalen Unternehmen zum Regiebetrieb
4.1.1 Was ist das?
4.1.2 Wer ist zuständig?
4.1.3 Haushalt und Wirtschaftsführung
4.1.4 Personalwesen
4.2 Der Eigenbetrieb
4.2.1 Was ist das?
4.2.2 Wer ist zuständig?
4.2.3 Haushalt und Wirtschaftsführung
4.2.4 Personalwesen
4.3 Das Kommunalunternehmen
4.3.1 Was ist das?
4.3.2 Wer ist zuständig?
4.3.3 Haushalt und Wirtschaftsführung
4.3.4 Personalwesen
4.4 Unternehmen in Privatrechtsform
4.4.1 Was ist das?
4.4.2 Wer ist zuständig?
4.4.3 Haushalt und Wirtschaftsführung
4.4.4 Personalwesen
5. Vergleich der Unternehmensformen
5.1 Steuerrecht
5.1.1 Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer
5.1.2 Grunderwerbsteuer
5.2 Personalwesen
5.2.1 Dienstherrnfähigkeit
5.2.2 Tarifrecht
5.3 Vergabewesen
6. Vorteile und Nachteile der verschiedenen Rechtsformen
6.1 Vorteile des Eigenbetriebs
6.2 Vorteile und Nachteile des Kommunalunternehmens gegenüber dem Eigenbetrieb
6.2.1 Vorteile
6.2.2 Nachteile
6.3 Vorteile und Nachteile des Kommunalunternehmens gegenüber den Unternehmensformen des Privatrechts
6.4 Vorteile und Nachteile von Privatrechtsunternehmen gegenüber dem Kommunalunternehmen
Teil 6 Reformbestrebungen
1. Verwaltungsreform – was ist das?
2. Die Phasen des Reformprozesses
2.1 Wie läuft ein Reformprozess ab?
2.2 Bestandsaufnahme
2.2.1 Worum geht es?
2.2.2 Mitarbeiterbefragung
2.2.3 Bürgerbefragung
2.3 Organisation des Reformprozesses
2.4 Ziele des Reformprozesses
2.5 Die Umsetzung von Projekten
2.5.1 Welche Ansatzpunkte gibt es?
2.5.2 Personal
2.5.3 Qualität der Arbeit
2.5.4 Wirtschaftlichkeit
2.5.5 Bürgerfreundlichkeit
2.5.6 Bürgerbeteiligung
2.5.7 Reformierte Politik?
2.6 Das Reform-Controlling
2.6.1 Reformideen müssen umsetzbar sein
2.6.2 Reformen brauchen Motivation und Akzeptanz
Teil 7 Digitale Verwaltung
1. Rechtliche, politische und organisatorische Grundlagen
1.1 Begriffe: E-Government und digitale Verwaltung
1.2 Digitalstrategie des Freistaats Bayern
1.2.1 Der Masterplan „Bayern-Digital“ und „Hightech-Agenda“
1.2.2 Montgelas 3.0 als Ausgangspunkt der Digitalisierung der Verwaltung
1.2.3 Ziele des Gesetzgebers bzw. der Staatsregierung im E-Government
1.3 BayernPortal (www.freistaat.bayern)
1.3.1 Informationen im BayernPortal
1.3.2 Suchfunktion im BayernPortal
1.3.3 Datenpflege über das Redaktionssystem
1.3.4 Die Basisdienste des BayernPortals
1.3.5 Die „BayernID“ (Bürgerkonto) als zentraler Zugang zur digitalen Verwaltung in Bayern
1.3.6 Der Postkorb: Nachrichten und Bescheide der Behörden an den Bürger
1.3.7 Antragsmanager: Nachrichten und Anträge des Bürgers an die Behörden
1.3.8 E-Payment
1.4 Nutzen für Bürger, Unternehmen und Verwaltung
1.5 Aktuelle Herausforderungen für die digitale Verwaltung
1.5.1 Ausbau der digitalen Angebote des Freistaats
1.5.2 OZG-Umsetzung in Bayern
1.5.2.1 Onlinezugangsgesetz und Portalverbund
1.5.2.2 Novelle Bayerisches E-Government-Gesetz
1.5.2.3 OZG-Umsetzung in den Kommunen
1.5.3 Barrierefreie Angebote der Informationstechnik
1.5.3.1 Anforderungen
1.5.3.2 Unverhältnismäßige Belastung im Einzelfall
1.5.3.3 Erklärung zur Barrierefreiheit, Kontaktmöglichkeit
1.5.3.4 Inkrafttreten und Übergangsvorschriften
1.6 Fördermaßnahmen
1.6.1 Basisdienste und zentrale Dienste des BayernPortals
1.6.2 Förderungprogramm „Digitales Rathaus“
1.6.2.1 Förderrichtlinie digitales Rathaus (FöRdR)
1.6.2.2 Grundkurs Digitallotse
1.6.3 Fördermaßnahme „Digitaler Werkzeugkasten“
1.6.4 Einführung Informationssicherheits-Managementsystem
1.6.5 Erweiterung der Glasfaser/WLAN-Richtlinie (GWLANR)
1.7 Umsetzungsfristen und Handlungsbedarfe
2. Digitale Verwaltung – Vom Antrag zum Bescheid
2.1 Recht der Bürger und Unternehmen auf E-Government
2.2 Elektronische Kommunikation
2.2.1 Elektronische Erreichbarkeit
2.2.2 Schriftformersatz („digitale Unterschrift“)
2.2.3 Verschlüsselte elektronische Kommunikation
2.2.4 Elektronischer Rechtsverkehr (E-Justice)
2.3 Elektronische Identifizierung
2.4 Elektronische Antragstellung
2.4.1 Elektronische Formulare
2.4.2 Elektronische Vorlage von Nachweisen
2.4.3 Elektronisches Bezahlen und E-Payment
2.4.4 Analoge Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen
2.4.5 Exkurs: Elektronische Dienste
2.4.6 Förderrichtlinie digitales Rathaus (FöRdR)
2.5 Elektronische Aktenführung
2.5.1 Anforderungen an die elektronische Aktenführung
2.5.2 Übermitteln elektronischer Akten
2.5.3 Ersetzendes Scannen von Papierdokumenten
2.5.4 Elektronische Führung von Personalakten
2.6 Elektronische Bekanntgabe
3. E-Rechnung
3.1 Pflicht zur Entgegennahme von E-Rechnungen
3.2 Keine Pflicht zur elektronischen Verarbeitung
4. Aspekte der Informationssicherheit und des Datenschutzes
4.1 Informationssicherheit
4.1.1 Informationssicherheit als öffentliche Aufgabe
4.1.2 Umzusetzende Maßnahmen/ Informationssicherheitskonzepte
4.1.3 Informationssicherheits-Managementsysteme
4.1.4 Förderrrichtlinie zur Einführung eines Informationssicherheits-Managementsystems
4.1.5 Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
4.1.6 Bayerisches Behördennetz (BYBN)
4.1.7 Förderung für Rathäuser (Glasfaser/Behördennetz)
4.2 Datenschutz
4.2.1 Verantwortlicher
4.2.2 Behördlicher Datenschutzbeauftragter
4.2.3 Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten
Teil 8 Diverse Themen von Interesse
1. Demographischer Wandel
1.1 Was ist demographischer Wandel?
1.2 Welche Ursachen hat der demographische Wandel?
1.3 Medizinischer Fortschritt
1.4 Wanderungsbewegungen
1.5 Wie wirkt sich der demographische Wandel aus?
1.6 Demographischer Wandel und Kommunen
1.7 Was ist zu tun?
1.8 Bewältigung des demographischen Wandels als Chance
2. Ländlicher Raum
2.1 Was ist „ländlicher Raum“?
2.2 Warum ist der „ländliche Raum“ Gegenstand der politischen Diskussion?
2.3 Was ist eine „Metropolregion“?
2.4 Die Metropolregionen und der ländliche Raum in Bayern
2.5 Stärkung des ländlichen Raumes
3. Kinder und Bildung
4. Arbeit und Cluster
4.1 Gleichwertige Arbeitsbedingungen
4.2 Cluster
4.3 Die digitale Zukunft Bayerns
5. Public-Private-Partnership (PPP)
5.1 Was ist PPP?
5.2 Welche Formen von PPP gibt es?
5.3 Was spricht für PPP?
5.4 Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
5.5 Was ist bei PPP-Modellen kritisch zu sehen?
5.6 Welche Vorschriften müssen bei Realisierung von PPP beachtet werden?
6. Bürgerdialog
6.1 Bürgersprechstunden
6.2 Bürgerforen
6.3 Bürgerbefragungen
6.4 Digitale Plattformen (Contentmanagement/Feedbacksysteme)
6.5 Facebook, Twitter und Co
6.6 Radio und Fernsehen
6.7 Infobroschüren
7. Energiewende
7.1 Standortentscheidung
7.2 Geplantes Vorgehen
7.3 Stromnetze
7.4 Energiewende vor Ort
8. Neuer Politikstil
8.1 Ordnungspolitische Aushöhlung der Selbstverwaltung
8.2 Wählerbindung durch Finanzentlastung zu Lasten der Kommunen
8.3 Bewusste Umgehung der Konnexität
9. Biodiversität